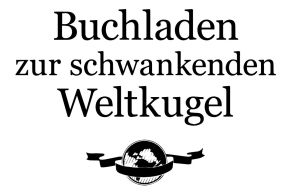Britta Stroh (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. )
Straßenzeitungen - von, für oder über Wohnungslose?
Eine Untersuchung zu den Konzeptionen und der Rolle von Sozialpädagogen[1]
Darmstadt 1996
Diplomarbeit zur Abschlußprüfung an der Fachhochschule Darmstadt, Fachbereich Sozialpädagogik
(Hauptreferent: Prof. Dr. jur Albrecht Brühl)
Anstelle eines Vorworts
1. EINFÜHRUNG IN DIE THEMATIK
2. DER MARKT BOOMT (noch immer)
3. VORSTELLUNG DER AUSGEWÄHLTEN INITIATIVEN
4. ANSPRUCH UND REALITÄT - UMSETZUNG DER ZIELVORSTELLUNGEN IN DER DISKUSSION
5. STELLENWERT DER ZEITUNGSINITIATIVEN IN DER WOHNUNGSLOSENHILFE
6. ROLLE DER SOZIALEN ARBEIT
7. RESÜMÉE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN
8. ANHANG
Anmerkungen
Vollständiges Inhaltsverzeichnis
Anstelle eines Vorworts
EIN GROSSES DANKESCHÖN
an alle, die direkt oder indirekt zu dieser Diplomarbeit beigetragen haben. Dies gilt vor allem den engagierten Menschen, die ich in der Vorbereitung dieser Arbeit kennenlernte, die sich Zeit nahmen und mir für Fragen zur Verfügung standen:
Von der Wohnungslooser-Redaktion
- Joachim Hinterreiter
Hans Klunkelfuß
Werner Picker
Von der TagesSatz-Redaktion
- Manfred Baumert
- Rüdiger Herkt
- Andrea Mentel-Winter
- Sven Schmidt
- Karlheinz Uttenreuther
Von der Hinz & Kunzt-Redaktion
- Stephan Karrenbauer
- Nina Kreuzfeld
- Verena Schmidt
Die Dach-Redaktion
sowie
- Stefan Schneider, der mir Zugang zu weiterem Material verschaffte
meine Mutter, die für Nachschub an Kalorien & Vitaminen sorgte
Ingrid, meine gewissenhafte Korrekturleserin, "Hey nonny nonny"
Alexander für seine moralische Unterstützung
Nicole für fachlichen Austausch
1. EINFÜHRUNG IN DIE THEMATIK
Wohnungslosenzeitungen - die Idee erscheint schlicht und doch eindrucksvoll: Wohnungslose gestalten eine Zeitung (mit) und/oder verkaufen diese auf der Straße[2]. Dadurch ist Wohnungslosen die Möglichkeit gegeben, sich in der Öffentlichkeit zu äußern und sich ein Zubrot zu verdienen.
Es stellt sich die Frage, inwieweit für eine solche Zeitung das Prädikat "Wohnungslosenzeitung" zutrifft. Nur in wenigen Fällen wird eine Zeitung maßgeblich von Wohnungslosen getragen, die Regel ist aber, daß wohnungslose MitarbeiterInnen vornehmlich mit dem Verkauf betraut werden. Kann man in diesem Fall von "Wohnungslosenzeitung" sprechen, wenn Redaktion und Entscheidungsbefugnisse von Nicht-Betroffenen ausgeübt werden?
Bis zur vorläufigen Klärung dieser Frage in Kapitel 2 und einer abschließenden Betrachtung im Resümée erscheint der Begriff "Straßenzeitung" am neutralsten.
Wird das Thema Wohnungslosigkeit benutzt, um eine publizistische Marktnische zu erschließen oder tragen Straßenzeitungen zu Ent-Stigmatisierung von Wohnungslosen bei? Welche Wirkung und Nutzen haben die Straßenzeitungen für wohnungslose Menschen? In dieser Arbeit soll aufgezeigt werden, in welchem Umfang Wohnungslose an Straßenzeitungen beteiligt und inwiefern hier ein Medium der parteilichen Öffentlichkeitsarbeit geboten wird.
Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, die Vielfalt der Straßenzeitungen zu erfassen und zu kommentieren. Eine kurze Übersicht über die etwa 30 bundesdeutschen Publikationen wird jedoch in Kapitel 2 gegeben.
2. Der Markt boomt (noch immer) -
Ein Überblick über die Straßenzeitungen in Deutschland
Um das Spektrum der unterschiedlichen Ansätze und Arbeitsweisen zu verdeutlichen, werden vier unterschiedliche Zeitungsprojekte vorgestellt. Jeweils wird auch der Träger mit dargestellt, um die England (The Big Issue) nach Deutschland. Derzeit gibt es etwa 30 Zeitungen in 27 Städten[3] mit einer Auflagenstärke von stolzen 400.000 Stück im Monat.
Der Berber-Brief war die erste Straßenzeitung in Deutschland. Er entstand im Jahr 1987 als Protestschrift gegen sozialhilferechtliche Praxis direkt auf der Straße. Ohne jedwede finanzielle Unterstützung wurden die handgeschriebenen, fotokopierten Blätter 1989 eingestellt.
Im Juni 1992 erschien die erste Ausgabe der Kölner Zeitung Bank-Express (heute Bank-Extra). Der weitreichende Erfolg von Straßenzeitungen in Deutschland wurde aber erst mit der Gründung der Münchner BISS ("Bürger In Sozialen Schwierigkeiten") im Oktober 1993 eingeleitet. Seitdem sind in fast allen größeren west- und ostdeutschen Städten Straßenzeitungen veröffentlicht worden.
Einige sind nach kurzem Auftritt wieder von der Bildfläche verschwunden (z. B. Sackgasse, Lobby, beides Frankfurt/M), andere werden in einer Stadt nebeneinander verkauft (Platte, mob und haz in Berlin). Die von Kindern und Jugendlichen gestalteten Zeitungen Zeitdruck/Berlin und Domplatt/Köln kooperieren, d. h. Domplatt wird ausschließlich im Zeitdruck veröffentlicht.
Einen Sonderfall stellt die Platte aus Bingen dar. Sie wird vom rheinland-pfälzischen Sozialministerium finanziert und herausgegeben. Der Projektleiter, Ralf Blümlein, formuliert als Ziel der Zeitung: "Selbstdarstellung der Betroffenen fördern, Bild der Obdachlosen geraderücken, eine Lobby schaffen"[4] . Zwar schreiben Wohnungslose für die Zeitung, es gibt aber keinen festen Redaktionsstamm. Im Gegensatz zu allen anderen Straßenzeitungen ist man hier auf den Verkauf nicht angewiesen, die Zeitung wird kostenlos verteilt. Ähnliches galt früher auch für Das Dach/Chemnitz. Deswegen muß die Platte nicht mit vielen der finanziellen Probleme kämpfen, die andere Zeitungen betreffen. Auch diese eher untypische Ausnahmeerscheinung zu untersuchen, würde den Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen.
Auf Einladung der BAG Wohnungslosenhilfe und der Evangelischen Akademie Loccum trafen sich im Oktober 1995 erstmals MitarbeiterInnen aus 21 Zeitungsprojekten zu einer gemeinsamen Arbeitstagung. Es wurde ein Gebietsschutz und zukünftige Kooperation in mehreren Bereichen (Anzeigenpool, Artikelaustausch usw.) vereinbart[5].
Alle Projekte erheben den Anspruch, "Hilfe zur Selbsthilfe" zu fördern. Konzeptionell besteht aber ein breites Spektrum: Hier lassen sich zwei hauptsächliche Kategorien unterscheiden:
- verkaufsorientierte Publikationen, die möglichst vielen Wohnungslosen durch den Straßenverkauf eine Möglichkeit eröffnen wollen, "sich selbst zu helfen". Diese Blätter sind mehr als andere auf eine hohe Auflage und regelmäßiges Erscheinen angewiesen. Dies setzt ein weitgehend professionelles MitarbeiterInnenteam sowie Inhalte mit großer Breitenwirkung voraus.
-
aufklärungsorientierte Publikationen, die die Öffentlichkeit aufklären wollen und sich in erster Linie als Medium und Sprachrohr Betroffener verstehen[6].
Diese Einteilung kann natürlich nur Tendenzen angeben. Auch aufklärungsorientierte Zeitungen wollen verkaufen und umgekehrt haben auch verkaufsorientierte Blätter den Anspruch, Information und Aufklärung über Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit zu bieten.
Unabhängig von der Publikationsform ist sowohl der Umgang mit der Thematik Wohnungslosigkeit als auch die Beteiligung Wohnungsloser bei den einzelnen Blättern unterschiedlich intensiv (dies wird in Kapitel 3 noch einmal verdeutlicht).
Meiner Ansicht nach sollte der Begriff "Wohnungslosenzeitung" für die Publikationen reserviert bleiben, deren inhaltliche Schwerpunkte bei Wohnungslosigkeit und auch verwandten Problematiken liegen. Wenn Wohnungslose redaktionell und organisatorisch nur am Rande eine Rolle spielen, kann nicht von einer Zeitung VON Wohnungslosen gesprochen werden.
Dies ist noch keine endgültige Wertung, sondern eine genauere Begriffsdefinition. Daher erscheint der Terminus "Straßenzeitung" als Oberbegriff am passendsten, da dies ein allgemeines Charakteristikum der Blätter, den Straßenverkauf, aufgreift.
3. VORSTELLUNG DER AUSGEWÄHLTEN INITIATIVEN
In diesem Abschnitt werden vier Straßenzeitungen einzeln vorgestellt. Es sind dies
- Hinz & Kunzt, Hamburg: die auflagenstärkste auf dem deutschen Markt
- TagesSatz, Kassel: herausgegeben von einem Verein mit wohnenden und wohnungslosen Mitgliedern
- Wohnungslooser, Michelstadt: eine reine Selbsthilfeinitiative
- Das Dach, Chemnitz: angegliedert an eine Tagesaufenthaltsstätte für Wohnungslose
Die Zeitungen können nicht unabhängig von den übrigen Aktivitäten des Vereins bzw. Trägers betrachtet werden. Die einzelnen Projekte sind, teils inhaltlich, teils finanziell, miteinander verbunden. Daher werden zunächst die jeweiligen Träger (kurz) vorgestellt.
Zum grundsätzlichen Verständnis der Straßenzeitungen werden Struktur und Organisationsform dargestellt. Selbstverständnis und Ziele werden nach eigenen Aussagen bzw. Selbstdarstellungen erläutert. Die Behandlung des Themas Wohnungslosigkeit wurde durch eine Inhaltshanalyse[7]. untersucht. Die ausgewählten Beispiele möglicher Konzeptionen werden in Kapitel IV kritisch diskutiert.
Weiter wird die Beteiligung von SozialarbeiterInnen bzw. die Zusammenarbeit von Straßenzeitungen mit Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe geschildert. Diese Angaben werden in Kapitel 6 (Rolle der Sozialarbeit) wieder aufgenommen.
Für alle Straßenzeitungen und nicht nur für Das Dach gilt, daß sie sich ständig weiterentwickeln. Dies wurde an neuen Ideen und Erfahrungen sowie kleinen Veränderungen bereits innerhalb des letzten Vierteljahres deutlich. Diese Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen, die Beschreibung der Zeitungsprojekte beruht daher auf dem Stand von April 1996.
3.1 Hinz & Kunzt
Herausgeber: Hinz & Kunzt gemeinnützige Verlags- und Vertriebsgesellschaft mbH, Hamburg
3.1.1 Entstehung
Hinz & Kunzt, das "Hamburger Straßenmagazin", wurde nach dem englischen Vorbild The Big Issue vom Leiter des Diakonischen Werks Hamburg 1993 initiiert.
Während des vorangegangenen Jahres entwickelte eine Arbeitsgruppe im Diakonischen Werk ein Konzept, jedoch fehlte der Kontakt zu Wohnungslosen, die sich beteiligen wollten. Nach der Nacht der Wohnungslosen im Juni 1993 entstand eine Selbsthilfegruppe Wohnungsloser (OASE), die sich zur Zusammenarbeit bereit erklärte[8].
3.1.2 Selbstverständnis und Ziele des Trägers - "Hilfe zur Selbsthilfe"
Anfangs unter der Trägerschaft des Diakonischen Werks, ist Hinz & Kunzt seit dem 01.01.1996 eine selbständige gemeinnützige GmbH[9].
Hinz & Kunzt sieht sich "...als Vertreter der Interessen von Wohnungslosen in Gremien (Arbeitskreis Wohnraumversorgung, d. Verf.( an. Beispielsweise als Initiator einer bundesweiten Unterschriften-Aktion gegen Sozialhilfekürzungen."[10]
"Hilfe zur Selbsthilfe ist das Prinzip dieses Projektes."[11] Dabei wird der Zeitungsverkauf und die damit verbundenen Auswirkungen auf die VerkäuferInnen ein erster Schritt sein (dazu mehr unter 3.1.3).
Unterstützende Angebote an die wohnungslosen VerkäuferInnen sind:
- ein Rechtshilfefonds (wöchentlich ehrenamtliche Beratung durch Rechtsanwälte, Übernahme von Gerichtskosten ist möglich)
- ein Gesundheitsfonds (Behandlungskosten können übernommen werden)
- Wohnprojekt Warthenau (der Sozialarbeiter steht den dort wohnenden derzeit neun Verkäufern sieben Stunden pro Woche zur Verfügung)
- und seit Oktober 1995 die Einrichtung eines "Wohnungspools" (Wohnraumvermittlungsstelle)
- Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe bzw. sozialen Einrichtungen (dazu mehr unter 3.1.7)
1995 wurde der "Hinz und Kunzt Freundeskreis" initiiert: Die Fördermitglieder erhalten zweimal jährlich einen Infobrief, in dem über die Verwendung ihrer Spende berichtet wird.
3.1.3 Selbstverständnis und Ziele der Zeitung - "Stadtmagazin und Sprachrohr"
"Das Blatt mit seiner Mischung aus sozialen und kulturellen Themen sowie Berichten von Obdachlosen wendet sich an alle Hamburgerinnen und Hamburger"[12] Hinz & Kunzt will ein "Straßenmagazin", d. h. eine "Mischung aus Stadtmagazin und Sprachrohr der Betroffenen (Kulturthemen und Soziales möglichst ausgewogen)" und politische Lobby für sozial Benachteiligte sein[13].
Möglichst viele Menschen sollen mit der Zeitung angesprochen und "für das Thema sensibilisiert werden"[14]. Eine hohe Auflage ist notwendig, "denn nur wenn die Zeitung ihr Geld wert ist, funktioniert das Projekt langfristig."[15]
Die Hilfe zur Selbsthilfe soll durch verschiedene Komponenten verwirklicht werden.
Zusatzverdienst
"Das wichtigste Motto von Hinz & Kunzt ist dem Betteln Konkurrenz zu machen."[16] "Durch den Zeitungsverkauf verdienen die Hinz & Küntztler Geld. Das bedeutet eine materielle Verbesserung ihrer Lebenssituation..."[17]
Die Zeitung erscheint monatlich zum Preis von DM 1,80, davon ist 1 Mark für den Verkäufer. Daneben können Wohnungslose für eingebrachte Artikel das Zeilenhonorar für freie Journalisten von DM 1, 20 je Zeile erhalten.
Diese Einkünfte werden ein halbes Jahr lang nicht auf die Sozialhilfe angerechnet[18].
Umgang mit Geld
"Jeder Verkäufer entscheidet völlig eigenständig, wieviele Zeitungen er kauft. Dadurch haben die Betroffenen die Möglichkeit, mit ihren Mitteln wirtschaften zu lernen."[19]
Einstieg in ein geregeltes Leben
VerkäuferInnen könnten die Erfahrung machen, "daß ihre Arbeitskraft doch noch einen Wert hat."[20] Dabei könnten Fähigkeiten entdeckt oder wiederentdeckt werden, die ihnen den Einstieg in ein geregeltes Leben ermöglichen.[21]
Persönliche Zufriedenheit
Durch aktive und kreative Beteiligung bestehe die Möglichkeit, persönliche Zufriedenheit kennenzulernen. Gleichzeitig wird angemerkt, daß zu wenig Wohnungslose für die Zeitung schreiben.[22]
Kontakte
"Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Kontakte zu normalen Bürgern, mit denen sie vorher als Bettler keinen Kontakt hatten."[23] Die Kontakte zwischen wohnender und wohnungsloser Bevölkerung sollen auf einer geschäftlichen gleichwertigen Beziehung[24] basieren: Nicht mehr mildtätige Gabe, sondern ein Austausch von Ware gegen Geld.
Selbstwertgefühl
"Das Selbstwertgefühl vieler Verkäufer wird langsam wieder gestärkt und ermöglicht ihnen so, sich schrittweise aus ihrer Isolation zu befreien."[25] Die Betroffenen sollen aus der "Erstarrtheit der Wohnungslosigkeit und ihrer Einsamkeit geweckt werden, wieder in die Gemeinschaft hineinkommen, wieder Selbstbewußtsein entwickeln, wieder jemand sein, wieder einen Sinn im Leben finden und wieder Spaß am Leben haben."[26]
3.1.4 Organisation und Struktur
3.1.4.1 MitarbeiterInnen
"Hinz & Kunzt wird von professionellen Journalisten, Fotografen, Layoutern gestaltet.... Eine Betriebswirtin macht die Projekt- und Anzeigenleitung, ein Sozialarbeiter steht den Verkäufern für praktische Hilfe zur Verfügung."[27] Weiterhin werden eine Redaktionsassistentin und ein Zivildienstleistender beschäftigt. Die MitarbeiterInnen arbeiten entweder hauptamtlich oder auf Honorarbasis.[28]
Beiträge werden hauptsächlich von professionellen MitarbeiterInnen recherchiert und geschrieben. Etwa drei sogenannte "Forum-Seiten" sind für Beiträge von Wohnungslosen reserviert.
3.1.4.2 Produktion und Vertrieb
Hinz & Kunzt erscheint monatlich in einer Auflage von durchschnittlich 110.000 Exemplaren. Sie wird ausschließlich in Hamburg vertrieben.
Zur Organisation des Vertriebs wurden vier ehemalige Wohnungslose aus der Selbsthilfegruppe OASE eingestellt.[29] Von den über 1.000 registrierten VerkäuferInnen sind etwa 100-300 regelmäßig aktiv[30]. Der Frauenanteil bei den VerkäuferInnen liegt bei etwa 2,5%[31].
Zum Vertrieb gehört das Ausstellen von VerkäuferInnenausweisen, die Vergabe der ersten zehn Gratis-Exemplare, die wochenweise Einteilung der Verkaufsgebiete und Kontrolle der Einhaltung der Verkaufsregeln.
Zu den Verkaufsregeln muß sich jede/r VerkäuferIn schriftlich verpflichten, um einen Verkaufsausweis zu erhalten. Die Regeln beziehen sich auf den Zeitraum des Zeitungsverkaufens: Nachweis der Wohnungslosigkeit, Tragen des Verkäufer-Ausweises, kein Alkohol- oder Drogengenuß, keine Bettelei, kein störendes Verhalten, kein Verkauf in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in anderen Personen zugewiesenen Verkaufsgebieten.[32]
Vertriebsmitarbeiter kontrollieren gelegentlich selbst bzw. gehen etwaigen Beschwerden von KäuferInnen nach. Bei Nichteinhaltung kann die Verkaufserlaubnis (der Verkäuferausweis) von einer Woche bis zu zwei Monaten entzogen werden.[33]
3.1.4.3 Finanzierung
Nach einer Anschubfinanzierung in Höhe von DM 170.000 der Nordelbischen Landeskirche finanziert sich die Zeitung heute "aus Verkaufserlösen der Zeitung, Anzeigenerlösen und Spenden."[34] Die Stelle des Sozialarbeiters wird aus Mitteln der "Glücksspirale" finanziert[35].
Von den Erlösen werden die MitarbeiterInnen sowie die laufenden Nebenkosten, wie Büroräume etc., bezahlt und die anderen Projekte von Hinz & Kunzt unterstützt.
3.1.5 Erscheinungsbild und Inhalte
Hinz & Kunzt erscheint auf 40 Seiten: innen zweifarbig, die Titelseite im 4-Farbendruck, meist mit einem Foto oder Comic.
Nach eigener Einschätzung liegen die Schwerpunkte der Berichterstattung bei "Armut, Wohnungslosigkeit, soziale Mißstände, Initiativen, Veranstaltungskalender" sowie bei Themen mit "Hamburg-Bezug" (Hamburger Künstler, Stadtkultur, Literatur).[36] Zwei bis drei Forumseiten werden von Wohnungslosen gestaltet.
Eine Analyse von sechs Ausgaben (vgl. Anhang Nr. III.1) ergab, daß der größte Teil der Zeitung von Veranstaltungskalender und Anzeigen (jeweils ca. 17%) eingenommen wird. Der Kulturanteil beträgt ca. 14%, das Feuilleton nimmt mit ca. 13%, Themen aus Politik und Gesellschaft mit ca. 6% ebenfalls breiten Raum ein. Institutionen der Wohnungslosenhilfe sind mit ca. 4%, Berichte über die Lebenssituation von Wohnungslosen mit 4% und Einzelschicksale bzw. Biografien mit ca. 7% vertreten.
3.1.6 Beteiligung von SozialarbeiterInnen
Ein Hinz & Kunzt Mitarbeiter beschreibt das Verhältnis zur Sozialarbeit folgendermaßen: "Wir machen hier jeden Tag Sozialarbeit, wir, die wir mit den Verkäufern zu tun haben. Mit allen Problemen kommen die zu uns..."[37]
Ursprünglich sollten hilfesuchende Verkäufer an Beratungstellen für Wohnungslose verwiesen werden. Dieses Vorhaben funktionierte nicht, zum einen weil Beratungsstellen - mit Kunden ausgelastet - die große Anzahl von Verkäufern nicht habe übernehmen können, zum anderen seien unter den Verkäufern viele, die im offiziellen Hilfesystem zuvor nicht aufgetaucht waren. Ein Teil davon entwickelte Vertrauen zu den Leuten im Vertrieb und wollte auch mit niemand anderem über Probleme sprechen. Dies habe sich sehr belastend auf den Vertrieb ausgewirkt.[38]
Es wurde sowohl die Notwendigkeit von Beratung und Hilfe-Vermittlung erkannt, als auch die Tatsache, daß diese Art von Arbeit von der Redaktion allein nicht zu bewältigen wäre.[39]
Seit Dezember 1994 ist ein Dipl. Sozialarbeiter innerhalb des Projekts beteiligt. Er ist "Ansprechpartner für Verkäufer", seine Aufgaben bestehen in der "Beratung z.B. bei Schulden-, Sucht-, Rechtsproblemen, Vermittlung an andere Beratungsstellen/Einrichtungen, "Betreuung" des Wohnprojektes"[40]. "Eher selten" stellt er auch die "fachliche Beratung bei sozialpolitischen Themen."[41]
3.1.7 Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen
Mit der Einrichtung der Stelle eines Sozialarbeiters wurden die personellen Voraussetzungen zur Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen geschaffen. Verbindungsglied ist der Sozialarbeiter. Der Vernetzungsgedanke ist hier offensichtlich stark vorhanden.
Es bestehen Kontakte zur Drogen- und Schuldnerberatung (Weitervermittlung) und zum Sozialamt (Einladungen von Sachbearbeitern zur Information).
Daneben wird mit Beschäftigungsgesellschaften zusammengearbeitet. Dadurch konnte unter anderem eine Stelle für einen ehemaligen Wohnungslosen im Wohnungspool eingerichtet werden.[42]
Die Hinz & Kunzt GmbH ist außerdem auch sozialpolitisch engagiert, sie ist Mitglied im Arbeitskreis Wohnraumversorgung, einem Zusammenschluß Hamburger Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe.
3.2 Der "TagesSatz" -
Herausgeber: Verein zur Förderung der Integration sozial und kulturell benachteiligter Menschen (Sozial Kultureller Förderverein), Kassel
3.2.1 Entstehung
Ende 1993 trafen sich erstmals Kasseler BürgerInnen mit dem Ziel, die Idee einer Wohnungslosenzeitung aus anderen Städten aufzugreifen und zu verwirklichen. Der sozial-kulturelle Förderverein wurde gegründet und im September 1994 erschien die erste Ausgabe des TagesSatz[43].
3.2.2 Selbstverständnis und Ziele des Vereins - "Armut benötigt Aufmerksamkeit"[44]
Der Verein wurde explizit gegründet, um eine rechtliche Grundlage zur Publikation einer Zeitung zu haben. Zu den 20 Mitgliedern des Vereins zählen " interessierte Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Wohnung und Sozialarbeiter aus den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe"[45]. Im Vorstand sind keine Wohnungslosen, da sich niemand dafür bereit fand. Um mitzuarbeiten ist aber keine Mitgliedschaft erforderlich.
"Zweck des Vereins ist die Förderung sozial und kulturell benachteiligter Bürgerinnen und Bürger, besonders Wohnungslose, Obdachlose und Strafentlassene."[46]
Dieses Ziel soll verwirklicht werden durch "Öffentlichkeitsarbeit, durch Herausgabe von Druckschriften, Veranstaltungen von Seminaren für Betroffene und interessierte Bürgerinnen und Bürger und die Fortbildung von Mitarbeitern im Bereich der Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe."[47] In Planung ist derzeit die Schulung von MitarbeiterInnen in Fragen, die mit der Herausgabe der Zeitung verbunden sind, z. B. Umgang mit dem Computer. Der Verein ist als "mildtätig" anerkannt[48] .
3.2.3 Selbstverständnis und Ziele der Zeitung - "Hilfe zur Selbsthilfe"[49]
Anliegen des TagesSatz ist es, soziale Mißstände aufzuzeigen und die Öffentlichkeit mit Themen und Fakten zu beliefern, die häufig übersehen oder überhört werden. "Er dient als Sprachrohr für alle sozial Benachteiligten und Ausgegrenzten und versucht dadurch, zur Änderung der sozialen (Miß-) Verhältnisse beizutragen."[50] Dadurch soll "Mitgefühl und Solidarität mit den Betroffenen gestärkt werden."[51]
"Über den Erfolg der Zeitung entscheidet ... nur ihre Qualität und ihr Bestehen am Markt... aus diesem Grunde bemühen wir uns um einen Standart, der zum Kaufen einlädt, denn nur wenn unser Produkt gekauft wird, können die Verkäufer etwas verdienen."[52]
"Hilfe zur Selbsthilfe" ist auch das Motto des TagesSatz.
Zusatzverdienst
Zum einen können sich die wohnungslosen Verkäufer einen Teil ihres Lebensunterhalts verdienen. Sie müssen "nicht mehr herumsitzen und betteln."[53]
Vom Verkaufspreis des TagesSatz von DM 2,80 behalten die VerkäuferInnen DM 1,30. Für Beiträge von Betroffenen wird ein Autorenhonorar von bis zu DM 50 gezahlt. Zur Anrechnung dieser Einküfte auf Sozialhilfe siehe 4.3.3.2.
Soziale Anerkennung
Ein weiterer Effekt ist, daß die wohnungslosen Verkäufer im Straßenbild (positiv) auf sich aufmerksam machen können[54]. Damit seien "Kontakte außerhalb des 'Milieus' und direkte soziale Anerkennung in den Verkaufsgesprächen verbunden."[55]
Gesellschaftliche Reintegration
"Der Verkauf des Straßenmagazins soll insgesamt die gesellschaftliche Wiedereingliederung der Verkäufer fördern. Für einzelne kann diese Aufgabe ein Schritt auf dem Weg zu einer regulären Arbeit sein."[56]
3.2.4 Organisation und Struktur
3.2.4.1 MitarbeiterInnen
Aus dem Kreis der Vereinsmitglieder hat sich mittlerweile ein fester Redaktionskern herausgebildet. Mitglied zu sein ist aber keine Voraussetzung, um mitarbeiten zu können. Da alle Beteiligten ehrenamtlich arbeiten und Zeitungslaien sind, wird kein Unterschied gemacht zwischen "Betroffenen" und "Nicht-Betroffenen". Zwar gibt es teilweise Differenzen bei der Gestaltung von Artikeln, aber nicht aufgrund von erfahrener bzw. nicht-erfahrener Wohnungslosigkeit[57]. Wohnungslose bzw. ehemals wohnungslose Mitarbeiter sind "gleichberechtigte Kollegen". Dies wird auch von Ex-Betroffenen so empfunden[58].
Wöchentlich findet eine Redaktionssitzung statt.
3.2.4.2 Produktion und Vertrieb
Der TagesSatz erscheint in einer Auflagenhöhe von 7.000 Exemplaren sechs mal pro Jahr. Er wird in Kassel und Göttingen vertrieben, die Verbreitung auch in Marburg befindet sich im Aufbau.
Das Layout wird von einem Vereinsmitglied gestaltet, der als Grafiker auch die Verbindung zu einer Druckerei herstellte, die zu günstigen Konditionen arbeitet.
Der Vertrieb wird jetzt von einem ehemaligen Wohnungslosen organisiert. Wöchentlich findet ein VerkäuferInnentreffen statt.
80 Verkäuferausweise wurden ausgestellt, darunter sind ca. 10 Stammverkäufer. Von den eingetragenen VerkäuferInnen sind etwa 15% Frauen. Laut den Vertriebsrichtlinien dürfen nicht nur Menschen ohne Wohnung sondern "Bürger in sozialen Schwierigkeiten"[59] die Zeitung verkaufen. Die Zeitung kann auch abonniert werden.
Zu den Verkaufsregeln gehört das Tragen des Verkaufsausweises, kein störendes Verhalten, kein Alkohol- oder Drogenkonsum während des Verkaufs, kein Verkauf in öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei Verstoß kann der Verkaufsausweis eingezogen werden[60].
3.2.4.3 Finanzierung
Die Arbeit wurde mit Hilfe von Spenden und Sachspenden zur Einrichtung der Redaktionsräume aufgenommen.
Die Zeitung finanziert sich aus Spenden, Anzeigen, Einnahmen aus dem Verkauf sowie Förderbeiträgen. Davon werden auch die laufenden Kosten, wie Miete, Telefon etc., bezahlt.
3.2.5 Erscheinungsbild und Inhalte
Der TagesSatz erscheint alle zwei Monate auf 36 gehefteten Seiten. Die Zeitung ist innen schwarz-weiß gehalten, außen zweifarbig.
Der Schwerpunkt liegt auf (lokal- und bundes-) sozialpolitischen und gesellschaftlichen Themen (22%) (siehe Anhang III.2). Internes nimmt ca. 12% des Magazins ein. Berichte über Institutionen der Wohnungslosenhilfe sind mit ca. 7%, die Lebenssituation von Wohnungslosen ebenfalls mit 7%, Einzelschicksale und Biografien mit 6% vertreten. Außerdem wird berichtet über Sucht (13%), wohnunglose Frauen (5%), Kinder auf der Straße (5%).
In jeder Ausgabe ist eine Seite für Adressen inklusive Kurzbeschreibungen von Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, Hilfe für Frauen und Suchtberatung reserviert.
3.2.6 Beteiligung von SozialarbeiterInnen
Die ehrenamtlich mitwirkenden SozialarbeiterInnen können AnsprechpartnerInnnen sein: Bei Problemen der wohnungslosen VerkäuferInnen können sie durch ihr Fachwissen an die entsprechenden Hilfeeinrichtungen weiterleiten.
Es soll keine Sozialarbeit im Projekt selbst stattfinden. Unter den wohnenden und nicht-wohnenden MitarbeiterInnen sind keine "Zeitungs-Profis", daher war die Zusammenarbeit "von Anfang an auf einer gleichberechtigten Basis."[61]
Allerdings wurde festgestellt, daß SozialarbeiterInnen teilweise versuchten, "unbewußt" Klientenarbeit zu betreiben, d. h. eine eher "betreuende" Rolle einnahmen. Dies sei aber weder gewollt noch häufig[62].
Einer der Sozialarbeiter sieht den Grund seines Engagements in der Möglichkeit, Mißstände in die Öffentlichkeit zu bringen, was als Angestellter eines Wohlfahrtsverbandes nicht geht, da dort Rücksichten auf interne Strukturen genommen werden müßten.
3.2.7 Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen
Es besteht keine offizielle Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen, aber eine Verbindung ist gegeben durch die ehrenamtliche Beteiligung von SozialarbeiterInnen aus Einrichtungen der Kasseler Wohnungslosenhilfe, so daß Informationen weitergegeben und z. B. Mißstände, wie rechtswidrige Praktiken der Wohnungsvermittlung aufgezeigt werden können.
3.3 Der "Wohnungslooser" -
Herausgeber: Selbsthilfeförderverein Arbeit und Wohnen e. V., Michelstadt
3.3.1 Entstehung
Gegründet wurde der Verein 1994, ursprünglich, um den wohnungslosen Gründungsmitgliedern eine Unterkunft zu verschaffen. Die Rechtsform Verein bildete das Zwischenglied von Mietern und Vermietern.
Fast zeitgleich mit der Aufnahme der Arbeit des Vereins wurde die Zeitung gegründet. Der Auslöser zur Veröffentlichung einer Zeitung war "eine öffentliche Veranstaltung, auf der wir (die wohnungslosen Vereinsmitglieder, d. Verf.) mit einer eigenen Presse erscheinen wollten."[63]
Im August 1995 wurde dem Verein Gemeinnützigkeit[64] zuerkannt.
3.3.2 Selbstverständnis und Ziele des Vereins - "Wir wollen, daß Menschen aktiv werden."[65]
Der Name ist Programm und Ziel: Der Selbsthilfe-FÖRDER-Verein will Selbsthilfe fördern und initiieren, vor allem in den Bereichen Arbeit und Wohnen.
Um sich aktiv zu beteiligen, ist eine Mitgliedschaft nicht verpflichtend. "Mitgestalten kann jeder durch seine Arbeit." Die Entscheidung ob und wieviel man sich engagiert, liegt bei den Einzelnen[66].
Ein Vorstandsvorsitzender und ein Chefredakteur, beide Ex-Wohnungslose, wurden zwar formal benannt; beide betonen jedoch, daß notwendige Entscheidungsprozesse unbürokratisch gehandhabt werden[67].
Der Verein wird in der Rolle einer Geschäftsführung gesehen, d.h. er ist für die Organisation zuständig[68], bietet ein "Instrument, um arbeiten zu können"[69]. Dies erweise sich als einfacher, wenn ein Verein vorgeschaltet ist[70].
Neben der Zeitung hat der Verein noch andere Aktivitäten entwickelt:
- Anmietung von Wohnraum
- mit Hilfe von Architekturbüros Entwurf von Häusern; die kostengünstig selbst auszubauen sind
- Einrichtung eines Baukontos, auf das unter anderem DM 0,30 jeder verkauften Zeitung fließen
- Holzwerkstatt
- Trödelladen
- eine Druckerei, in der auch der Wohnungslooser gedruckt wird
- Öffentlichkeitsarbeit,z. B. mit Studenten, in Schulen, Kontaktbörse, Diskussionsveranstaltung, Info-Stand unter dem Motto: "Sich Gedanken machen, Menschen zusammenführen, Erfahrungen austauschen und was machen."[71]
Arbeitsbeschaffende Projekte sollen nur so lange seitens des Vereins unterstützt werden, bis sie gewinnbringend arbeiten und dann aus dem Verein ausgegliedert werden[72]. Der Verein soll sich dann selbst überflüssig gemacht haben. "Wir wollen aus Leuten, die keine Arbeit haben, Unternehmer machen."[73]
Die Rolle des Vereins wird wie folgt charakterisiert: "Der Verein ist immer nur ein Bindeglied zwischen den einzelnen Projekten."[74]
3.3.3 Selbstverständnis und Ziele der Zeitung - "Jeder kann zu Wort kommen."[75]
Auch bei der Zeitung versteht sich der Verein als Organisator eines Forums, das jeder nutzen kann[76].
"(Wir wollen andere, d. Verf.) animieren zu schreiben. Und wir sind nur die Organisatoren der Zeitung. Wir stellen das (Material, d. Verf.) zusammen."[77] Eingesandte Beiträge werden danach beurteilt, ob sie zum jeweiligen Hauptthema der nächsten Ausgabe passen, "aber große Auswahl und Zensur findet nicht statt."[78]
Beim Wohnungslooser handelt es sich um eine "überregionale Zeitung, die sich nur auf Wohnungslosigkeit konzentriert ... Wir wollen Fachorgan für Obdachlosigkeit sein...vielleicht Fachzeitung für billiges Bauen"[79].
Der Wohnungslooser wendet sich an die interessierte, sozial engagierte Öffentlichkeit mit dem Ziel, Verständnis zu wecken: "Öffentlichkeitsarbeit für das ganz normale Verständnis zwischen Betroffenen ... und der Normalbevölkerung."[80]
Aus Sicht des Vereins ist die Zeitung auch Mittel zum Zweck: Sie dient zum einen als Werbeträger für die einzelnen Projekte des Vereins, zum anderen werden die Projekte mit Gewinnen aus der Zeitung unterstützt[81]. "Die Menschen sollen's verstehen, langsam."[82]
Für die Verkäufer ergäben sich daraus folgende Vorteile:
Zusatzverdienst bzw. finanzielle Lebensgrundlage[83]
DM 1,10 jeder verkauften Zeitung erhalten die VerkäuferInnen. Da der Wohnungslooser bundesweit verkauft wird, gibt es keine einheitliche Regelung im Umgang mit Sozialhilfe.
Unter den VerkäuferInnen sind einige, die "leben da richtig davon, komplett, mit Wohnung bezahlen und allem was dazugehört und es gibt Leute, die holen sich nur ein bißchen Taschengeld."[84]
Letzteres sei besonders für überschuldete Menschen interessant, die bei der Aufnahme eines regulären Arbeitsverhältnisses wieder bis auf den Sozialhilfesatz heruntergepfändet würden[85].
Ansporn
Der mögliche Verdienst motiviere, es mit dem Verkauf von Zeitungen, statt zu betteln zu versuchen[86].
Einstieg in ein geregeltes Leben
Der Zeitungsverkauf könne zur Folge haben, daß ein wohnungsloser Verkäufer sich "auf die Art und Weise wieder an ein normales geregeltes Leben gewöhnt, wobei ich normal in seinem Sinne meine... Das ist ein Erfolg in sich."[87]
Selbstbestätigung
Den mehr oder weniger regelmäßigen Zeitungsverkauf durchzuhalten bedeute Selbstbestätigung[88].
Kontakte
Weiter ergäben sich Kontakte zu Stammkundschaft, dadurch auch Angebote in Bezug auf Wohnung und Arbeit: "Das ist also nicht das große Märchen, ..., sondern das ist nachweislich oft genug passiert."[89]
3.3.4 Organisation und Struktur
3.3.4.1 MitarbeiterInnen
Aktiv bei der Zeitung sind hauptsächlich drei ehemals Wohnungslose. Darunter ist Hans Klunkelfuß, der Ende der 80er Jahre den Berber-Brief herausgab und somit bereits Erfahrung mit Straßenzeitungen hatte.
Die Beiträge stammen "von Sozialarbeitern über Kirchenleute, bis zu Politikern und Betroffene schreiben ja nicht unerheblich in dem Blatt."[90]
3.3.4.2 Produktion und Vertrieb
Der Wohnungslooser erscheint monatlich in einer Auflage von 35.000 Exemplaren. Die Zeitung kann nach Bedarf der örtlichen Wohnungslosen durch eine Lokalausgabe ersetzt oder ergänzt werden (z. B. Mannheim, Frankfurt). Die Zeitung kann von ihren Inhalten her bundesweit vertrieben werden, es gibt sie auch im "Freundschaftsabonnement" (DM 100 pro Jahr).
Die Zeitung wird in Eigenarbeit gesetzt und gedruckt.
Der Verkauf wird von etwa 50 Wohnungslosen übernommen; eine Frau ist darunter. Die Verkäufer holen sich die fertigen Exemplare entweder direkt beim Verein in Michelstadt oder bei "Verteilstationen" ab, wie z. B. der "Teestube" in Darmstadt. Die Wahl des Verkaufsgebiets ist den Verkäufern überlassen.
3.3.4.3 Finanzierung
Die erste Ausgabe von 200 Stück wurde aus privaten Mitteln finanziert.
Die Zeitung trägt sich selbst ausschließlich von ihrem Verkaufspreis von mittlerweile DM 2,50. Davon gehen DM 0,30 für das Baukonto ab; DM 1,10 behält der Verkäufer. Von dem Überschuß werden die Druckkosten und laufende Ausgaben bezahlt sowie andere Aktivitäten unterstützt.
Seit April 1996 bietet sich der Wohnungslooser auch als Werbepartner an, zuvor waren keine kommerziellen Anzeigen (außer Eigenwerbung, Suchanzeigen, Bettelanzeigen, Spendenaufrufe etc.) enthalten.
3.3.5 Erscheinungsbild und Inhalte
Die 32 Seiten sind durchgängig schwarz-weiß gehalten. Zur Titelblattgestaltung dient meist ein Foto. Es finden sich großformatige Bilder, die Schrift ist durchgängig groß gehalten.
Es wird versucht, in jeder Ausgabe ein Hauptthema ("einen roten Faden"[91]) beizubehalten. Alle Beiträge befassen sich direkt (z. B. Einzelschicksale, Vorstellung von Institutionen der Wohnungslosenhilfe) oder indirekt (z. B. Besprechung eines Buches, das sich mit Wohnungslosigkeit befaßt, politische Veranstaltungshinweise) mit sozialen Themen, insbesondere Wohnungslosigkeit.
Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt mit ca. 29% (Durchschnitt von 5 Ausgaben, siehe Anhang III.3) bei vereinseigenen Projekten: Vorstellung von Bauplänen, Werbung für die Druckerei usw. Der Schilderung von Einzelschicksalen (ca. 11%), politisch-gesellschaftliche Themen (ca. 8%) und Institutionen der Wohnungslosenhilfe (9%) sowie der Lebenssituation von Wohnungslosen (9%) wird ebenfalls viel Platz eingeräumt.
Ab der März-Ausgabe 1996 wird der Lobby e. V.[92] in jeder Zeitung Hintergründe zu sozialpolitischen Themen aufzeigen.
3.3.6 Beteiligung von SozialarbeiterInnen
Zu den Gründungsmitgliedern zählt auch ein Sozialarbeiter. Besonderheit ist hier, daß er sich nicht in seiner Funktion als Sozialarbeiter der Nichtseßhaftenberatung im Odenwaldkreis beteiligte, sondern "aus reinem persönlichem Engagement und Interesse", also ehrenamtlich mitarbeitet.[93]
Der Sozialarbeiter sah in der Beteiligung an dem Selbsthilfeverein die Chance, weitergehende Hilfe zu praktizieren, z. B. Wohnraum anzumieten, die unter seinem Arbeitgeber (Arbeitskreis Suchtkrankenhilfe) nicht möglich gewesen wären. [94]
Einer Einschätzung des Vorstandsvorsitzenden nach war er mehr eine "Begleitperson", der aber "nicht maßgebend, kein Ideenträger"[95] gewesen sei. "Aus taktischen Gründen" führte er jedoch z. B. Verhandlungen im größeren Rahmen mit Ämtern wegen Wohnraumbeschaffung - er werde ernster genommen als Betroffene[96].
Der Sozialarbeiter selbst sah spezifische Hilfen, die er in seiner Eigenschaft als Sozialarbeiter leisten konnte, in zweierlei Hinsicht: auf der einen Seite materielle und organisatorische Unterstützung, z. B. das Telefon der Wohnungslosenberatungsstelle. Andererseits habe er "vortherapeutisch" arbeiten können, d. h. Einzelhilfe, "begleiten auf Selbstentdeckung", Reflektion[97].
3.3.6 Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen
Die Fachberatungsstelle und Teestube "Konkret" in Darmstadt dient als eine unter mehreren Verteilstationen für die Zeitungen[98].
Die Verbindung wird als eine beiden Seiten nützliche definiert:
Anfänglich versuchte der Verein, in der Teestube Redaktionssitzungen abzuhalten, und andere Wohnungslose zur Mitarbeit zu bewegen, was sich damals nicht als erfolgreich erwies[99]. Bis heute ist dennoch der ein oder andere Artikel von Besuchern der Teestube eingesandt worden.
Der Vorteil für die in der Teestube arbeitenden Sozialarbeiter besteht aus der Sicht Werner Pickers zum einen in der Möglichkeit, Besucher zu motivieren und aus dem Milieu "rauszukriegen". Der zweite Vorteil sei, daß Artikel veröffentlicht werden und die Teestube "Reklame für sich selbst machen" könne[100].
3.4 "Das Dach"
Herausgeber: Arbeiterwohlfahrt- Kreisverband Chemnitz e. V., Chemnitz
3.4.1 Entstehung
Die "Zeitschrift Chemnitzer Wohnungsloser" wurde 1994 in der Tagesstätte für Wohnungslose konzipiert, in Anlehnung an Vorbilder aus Hamburg und München. Anfang 1994 nahm ein Gast der Tagesstätte für Wohnungslose die Projektarbeit auf, die mit Hilfe von Sozialarbeitern gestartet und vorangetrieben wurde."[101]
Die erste Ausgabe wurde im Mai 1994 herausgegeben. Vier mal pro Jahr erschien eine achtseitige Zeitung im DIN A5 Format. "Sie trug eher den Charakter eines Informationsblattes, vor allem für Obdachlose [der, d. Verf.] Stadt."[102] Sie wurde kostenlos verteilt.
Für die derzeitige Ausgabe 1/96 wurde das Konzept leicht geändert: Das Dach ist umfangreicher und soll erstmals verkauft werden. Die jetzigen Bedingungen werden im folgenden dargestellt.
3.4.2 Selbstverständnis und Ziele des Trägers - "Teil der Öffentlichkeitsarbeit"
"Das Dach" ist auch der Name der Tagesaufenthaltsstätte für Wohnungslose, getragen von der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Chemnitz e. V. Die Arbeiterwohlfahrt ist lediglich Finanzier, organisiert und geplant wurde die Zeitung innerhalb und mit Besuchern des Tagestreffs. Die Zeitung Das Dach wird als Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit des Tagestreffs verstanden.
3.4.3 Selbstverständnis und Ziele der Zeitung - "Sprachrohr sozialer Probleme"
Das Dach versteht sich als "Sprachrohr sozialer Probleme in der Stadt, aufgelockert durch kulturelle und stadtbezogene Themen"[103] Diese "Szenezeitung" soll dazu beitragen, "Nischen und Randgruppen der Gesellschaft zu finden und darzustellen."[104]
Ein Ziel der Zeitung ist es, "in der Bevölkerung die vielschichtigen Probleme der 'Armen' in unserer Gesellschaft und speziell in... [Chemnitz bekanntzumachen, d. Verf.] und die Bürgerschaft dazu bringen, über dieses wachsende Problem nachzudenken."[105] Die Sichtweise derer von unten soll gezeigt werden und es ihnen ermöglichen, "selbst ihre Stimme zu heben."[106] Damit soll die Öffentlichkeit für soziale Probleme sensibilisiert werden[107].
Ziele für die VerkäuferInnen sind:
finanzieller Zuverdienst
Von jeder verkauften Zeitung erhalten die VerkäuferInnen DM 1. Sofern in der Zukunft weitere Gelder zur Verfügung stehen sollten (z. B. durch Spenden) sollen auch Honorare für Verfasser von Artikeln gezahlt werden.
Auf Beschluß des Chemnitzer Sozialamtes werden Einnahmen aus dem Zeitungsverkauf nicht auf Sozialhilfe angerechnet.
soziale Kontakte
Bei zwei der sechs Verkäufer dient der Zeitungsverkauf auch zur Tagesstrukturierung und zur
Ablenkung von Alkohol
3.4.4 Organisation und Struktur
3.4.4.1 MitarbeiterInnen
Beteiligt sind Sozialarbeiter, ein freischaffender Mediendesigner, ein arbeitsloser Grafiker, Journalisten und Wohnungslose. Wohnungslose sind nur bedingt in der Redaktion vertreten, dies soll aber weiter ausgebaut werden. Die Sozialarbeiter arbeiten zum Teil in ihrer Arbeitszeit alle anderen MitarbeiterInnen ehrenamtlich[108].
Für die beteiligten Journalisten "bietet sich die Möglichkeit, Themen intensiver als in der Tagespresse aufzubereiten."[109]
3.4.4.2 Produktion und Vertrieb
Die Auflage beträgt zur Zeit 1.000 Exemplare. Geplant ist weiterhin eine vierteljährliche Erscheinungsweise. Das Dach soll in der Stadt Chemnitz im Straßenverkauf und durch Abonnements vertrieben werden.
Der Vertrieb mit insgesamt 6 Verkäufern, darunter 2 Frauen, wird im Tagestreff organisiert. Der Druck wird bei einer Druckerei in Auftrag gegeben.
3.4.4.3 Finanzierung
Das Dach nach altem Konzept wurde von der AWO Chemnitz finanziert. Das neue Dach begann mit einer Anschubfinanzierung der "Robert-Bosch-Stiftung".
Zukünftig soll die Zeitung sich selbst tragen; es ist jetzt aber noch nicht abzusehen, inwiefern dies funktionieren wird.
3.4.5 Erscheinungsbild und Inhalte
Die Zeitung erscheint vierteljährlich im DIN A4 Format auf jetzt 16 gehefteten Seiten. Sie ist außen dreifarbig, innen schwarz-weiß gedruckt. Da sie von einem Grafiker gestaltet wird, verfügt sie über ein professionelles Erscheinungsbild.
Das Dach richtet sich an "die gesamte Chemnitzer Bevölkerung, um die sozialen Themen ...allen, die sonst damit nicht in Berührung kommen, näherzubringen."[110]
Die Themenschwerpunkte sind zum einen die Darstellung sozialer Probleme und Randgruppen, zum anderen sollen Defizite und Fehler im System benannt werden. Durch Kultur und Unterhaltung (z. B. Kreuzworträtsel) wird die Zeitung aufgelockert[111]. Werbung wurde nicht geschaltet.
Themen in der bislang einzigen Ausgabe der "neuen" Art sind vier Seiten Rätsel, Satire und Kultur, "Wohnungslosigkeit in Chemnitz" auf zwei Seiten, ein Interview mit dem Vorsitzenden der AWO, "Quo Vadis, Sozialstaat Deutschland", ein einseitiger Bericht über das Treffen der Straßenzeitungen in Loccum, ein Rückblick auf die Weihnachtsfeier im Tagestreff, eine Seite mit Adressen der Wohnungslosenhilfe.
Über die Hälfte der Berichte nehmen Bezug auf die Problematik Wohnungslosigkeit. Von Wohnungslosen verfaßte Berichte sind in der ersten "neuen" Ausgabe nicht enthalten.
3.4.6 Beteiligung von SozialarbeiterInnen
Mit Hilfe von SozialarbeiterInnen des Tagestreff wurde das Projekt gestartet und auch vorangetrieben. Sie übernehmen redaktionelle und organisatorische Aufgaben, wie z. B. Beiträge und Finanzierung.
Nach Aussagen des Tagestreffs ist es leichter, Wohnungslose für ein Projekt zu gewinnen, wenn eine Bezugsperson vorhanden ist. Sozialarbeiter sind "nötig, um Defizite und Probleme in der sozialen Arbeit, (speziell "Behördenwillkür mit Klienten" u. ä.) anzusprechen."[112]
3.4.7 Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen
Angestrebt ist eine Zusammenarbeit aller Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe der Stadt, die aber bisher noch nicht realisiert wurde.
3.5 Zusammenfassung
An dieser Stelle sollen die wichtigsten Merkmale der vier Zeitungen noch einmal zusammengefaßt und daran in die eingangs (Kapitel 2) angegebenen Richtungen "Verkauf" bzw. "Aufklärung" eingeordnet werden.
Hinz & Kunzt, Hamburg
wird von professionellen Zeitungsmachern publiziert, (Ex-) Wohnungslose sind für Vertrieb und Verkauf zuständig. Ein Sozialarbeiter kümmert sich um ihm zugetragene Probleme der VerkäuferInnen.
Inhaltlich wird der Thematik Wohnungslosigkeit im Vergleich zu den anderen drei Initiativen äußerst wenig Platz eingeräumt, Ausnahme sind die zwei bis drei "Forum-Seiten", die für Beiträge von Wohnungslosen reserviert sind. Dies entspricht dem Selbstverständnis von Hinz & Kunzt, das kein "Betroffenheitsblatt", sondern ein Stadtmagazin sein will. Man kann sagen, daß Hinz & Kunzt soziale Themen über das Medium Kultur transportiert.
Mit weiteren Projekten (der Wohnraumbeschaffung, rechtlicher Hilfe etc.) und durch die Mitgliedschaft im Arbeitskreis Wohnungslosenhilfe ist es Hinz & Kunzt gelungen, sich als Bestandteil der Wohnungslosenhilfe zu etablieren.
Hinz & Kunzt kann als verkaufsorientierte Straßenzeitung eingestuft werden, es bietet immerhin mindestens 100-300 "festen" VerkäuferInnen die Möglichkeit, etwas dazuzuverdienen.
Der TagesSatz, Kassel
wird hingegen von wohnenden und wohnungslosen Menschen, darunter mehrere SozialarbeiterInnen aus Kasseler Einrichtungen für Wohnungslose, gemeinsam herausgegeben. Alle MitarbeiterInnen arbeiten ehrenamtlich. Da kein Zeitungsprofi dabei ist, waren die Anfangsvoraussetzungen für alle gleich. Im Vorstand des "Sozial-kulturellen Fördervereins" sind Nicht-Betroffene.
Der TagesSatz konzentriert sich auf regionale und bundespolitische soziale Thematiken plus etwas Kultur. Sein Anliegen ist es, Sprachrohr für sozial benachteiligte BürgerInnen zu sein, Mißstände publik zu machen und bei der Bevölkerung Solidarität zu wecken.
Der TagesSatz ist eindeutig aufklärungsorientiert.
Wohnungslooser, Michelstadt
(Ex-)Wohnungslose sind Initiatoren der Zeitung und anderer Projekte und stellen auch den Vorstand des Vereins. "Zeitungsprofis" sind nicht dabei. Ein ehemals in der Wohnungslosenhilfe tätiger Sozialarbeiter arbeitet ehrenamtlich mit.
Die Inhalte befassen sich ausschließlich mit Wohnunglosigkeit und verwandten sozialen Themen. Die Berichterstattung der letzten Zeit befaßte sich hauptsächlich mit Aktivitäten des Vereins, vor allem dem geplanten Wohnungsbauprojekt. Damit tendiert die Zeitung vielleicht tatsächlich in Richtung einer "Fachzeitschrift für billiges Bauen". Durch die Zusammenarbeit mit Lobby e. V. sollen verstärkt Hintergrundinformationen gegeben werden.
Der Wohnungslooser will Verständnis wecken für die Belange wohnungsloser Menschen, dennoch ist die Hauptintention nicht die Aufklärung, sondern auch den "Kollegen und Kolleginnen" auf dem Land ein Mittel zur Verfügung zu stellen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen[113]. Auch sollen durch Einnahmen aus der Zeitung weitere Projekte und die Arbeit des Vereins finanziert werden.
Somit kann der Wohnungslooser sowohl den verkaufs- als auch den aufklärungsorientierten Straßenzeitungen zugeordnet werden.
Das Dach, Chemnitz
ist angegliedert an Tagestreff für Wohnungslose der AWO und dort Teil der Öffentlichkeitsarbeit geworden. Bis auf die angestellten SozialarbeiterInnen arbeiten Journalisten, Grafiker usw. ehrenamtlich mit. Die Beteiligung von Betroffenen soll weiter ausgebaut werden.
Inhaltlich sind soziale Themen bestimmend, die durch Kulturelles und Unterhaltung ergänzt werden. Damit sollen Informationen über Wohnungslosigkeit verbreitet und Verständnis bei der Bevölkerung geweckt werden.
Da das neue Konzept erstmalig Anfang dieses Jahres umgesetzt wurde, konnten bislang noch keine Erfahrungen gesammelt werden, wie die Straßenzeitungen von Wohnungslosen und der übrigen Bevölkerung aufgenommen wird.
Das Dach war und ist als eher aufklärungsorientierte Zeitung zu bezeichnen.
4. ANSPRUCH UND REALITÄT - UMSETZUNG DER ZIELVORSTELLUNGEN IN DER DISKUSSION
4.1 Einleitung
Im vorangegangenen Kapitel wurden vier ausgewählte Straßenzeitungen vorgestellt und in das Spektrum zwischen "Aufklärungsorientierung" und "Verkaufsorientierung" eingeordnet. Anhand dieser Beispiele soll nun die Umsetzung der selbstgesteckten Ziele erörtert werden.
An erster Stelle steht das Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe". Was verstehen die Zeitungsinitiativen darunter? Wo spiegelt es sich in den Konzeptionen wieder?
Die wichtigsten Aspekte der Hilfe zur Selbsthilfe werden in folgenden Unterabschnitten gesondert untersucht:
- 4.2 Das Arbeitsangebot der Straßenzeitungen
- 4.3 Zusatzverdienst
- 4.4 Psychosoziale Auswirkungen - das Selbstwertgefühl
- 4.5 Öffentlichkeitsarbeit
4.2 Hilfe zur Selbsthilfe
4.2.1 Selbsthilfe - eine Definition
"Hilfe zur Selbsthilfe", bei den vorgestellten Zeitungsprojekten durchgängig eines der obersten Ziele, ist ein Begriff, der häufig als Schlagwort verwendet wird. Das führt zu der Frage: Was versteht man eigentlich unter Selbsthilfe und was ist bei den einzelnen Projekten damit gemeint?
Allgemein wird bei den Hilfesystemen unterschieden zwischen primärer Hilfe, d. h. private/familiale Solidarität und sekundären offiziellen Hilfesystemen. Unterstützung auf familiärer Ebene wird in unserer Gesellschaft zunehmend durch Institutionen, gesamtgesellschaftlich organisierte Funktionssysteme ersetzt (z. B. in den Bereichen Bildung, Erziehung, Altersvorsorge, d. h. auch und vor allem Sozialarbeit). Häufig sind kleinere Bezugssysteme bei auftretenden Lebenskrisen überfordert[114].
Die Lücke, die entsteht, wenn familiäre Hilfe nicht mehr und gesellschaftlich organisierte Hilfe noch nicht greift, kann durch Selbsthilfeinitiativen gefüllt werden. Unter Selbsthilfe versteht man das Prinzip, "eigene Probleme aus eigener Kraft bzw. gemeinsame Probleme mit gemeinsamer Anstrengung zu bearbeiten"[115].
Nach Pankoke ist organisierte Selbsthilfe ein "bewußtes Gegenkonzept zu bürokratisch oder professionell organisierter "Fremdhilfe", also eher alltagsorientiert.
Selbsthilfegruppen haben die "Entwicklung der Sozialen Arbeit... geprägt und bereichert, allerdings nicht als Alternative zu ihren bestehenden Formen, sondern als Komplement."[116]
4.2.2 Hilfe zur Selbsthilfe bei Straßenzeitungen
Mit Ausnahme des Wohnungsloosers handelt es sich bei den Zeitungsprojekten nicht um Selbsthilfeprojekte im oben definierten Sinn. Beim Wohnungslooser ging die Initiative maßgeblich von Betroffenen aus, die sich zwar Unterstützung seitens der wohnenden Bevölkerung verschaffen konnten, das Projekt aber in Eigenregie leiten und organisieren.
Die meisten anderen Straßenzeitungen wurden auf Initiative bzw. mit Unterstützung von sozialen Einrichtungen gegründet. Folglich werden die Macht und Entscheidungsgewalt hauptsächlich von anderen, d. h. Nicht-Wohnungslosen getragen[117].
Dies können Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe sein (so bei dem Dach/Chemnitz, der Kippe/Leipzig, dem BISS/Augsburg und früher bei mob/Berlin,) von sozialen Vereinen (z. B. TagesSatz) oder, wie in Hamburg, einer als gemeinnützig anerkannten GmbH, also einer marktwirtschaftlich organisierten Firma. Beim TagesSatz und beim Dach wird die Arbeit jedoch weitgehend ehrenamtlich geleistet, auch von Seiten der beteiligten SozialarbeiterInnen.
Straßenzeitungen können als organisierte Hilfe zur Selbsthilfe oder "Fremdhilfezusammenschlüsse"[118] charakterisiert werden[119].
Es wird ein Medium angeboten mit der Erwartung, bei Betroffenen bestimmte Prozesse einzuleiten, die es ermöglichen sollen, ihre Lebenslage zu verbessern bzw. sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern.
Die Definition, wie diese Hilfe zur Selbsthilfe konkret aussehen soll, ist bei den einzelnen Zeitungsprojekten unterschiedlich:
Bei Hinz & Kunzt wird Selbsthilfe als ein Stufenmodell des Auf- bzw. Ausstiegs gesehen[120]. Dies kann ein Aufstieg innerhalb des Projekts sein: "Ex-Obdachlose im Vertrieb"[121] oder die neugeschaffene ABM-Stelle der angegliederten Wohnraumvermittlung oder auch ganz allgemein: "durch den Verkauf von Zeitungen die erste Hürde auf dem Weg zur eigenen Existenzsicherung... nehmen... Wer viel und regelmäßig Hinz & Kunzt verkauft, will in der Regel auch bald aus dem Sozialhilfebezug aussteigen."[122] Dazu wird Beratung und Hilfe bei der Wohnraumbeschaffung angeboten.
Auch der Wohnungslooser sieht die Chance zu einem qualitativen Aufstieg gegeben: "Heute noch als Bettler am Straßenrand, morgen schon als selbstbewußter Verkäufer des Wohnungslooser"[123]. Der zusätzlichen Verdienst sei nicht nur Ansporn und Motivation, auch könnten sich Kontakte im Hinblick auf Wohnung und Arbeit ergeben. Es wird betont, daß hauptsächlich Menschen das Verkaufsangebot annehmen, die "sich nicht eingerichtet haben, die nie richtig abgestürzt sind"[124]. Teilweise lebten Menschen von den Verkaufseinnahmen.
Der Herausgeber "Selbsthilfeförderverein Arbeit und Wohnen" gibt auch anderen potentiell die finanzielle Hilfe zur Selbsthilfe, d. h. Hilfe, sich als Klein-Unternehmer selbständig zu machen.
Die TagesSatz -Redaktion formuliert etwas vorsichtiger: "Für einzelne kann diese Aufgabe ein Schritt auf dem Weg zu einer regulären Arbeit sein."[125] Weiter wird durch die Mitarbeit an der Zeitung Gelegenheit gegeben, eigene Erfahrungen mitzuteilen und ein Nebeneinkommen zu verdienen.
In eine ähnliche Richtung geht Das Dach - auch hier wird der Verkauf zu einer Strukturierung des Alltags genutzt. Der hauptsächliche Anreiz für die VerkäuferInnen ist im Moment der finanzielle Aspekt. Zusätzlich wird erwartet, daß die durch den Verkauf entstehenden sozialen Kontakte mit wohnenden BürgerInnen die wohnungslosen MitarbeiterInnen ein Stück aus ihrer Isolation holen kann[126].
Zur Selbsthilfe gehören somit zwei hauptsächliche Säulen:
Eine materielle Verbesserung
"Dem Betteln Konkurrenz machen"[127] - dieses Motto steht in dieser oder ähnlicher Form noch immer in manchen Selbstdarstellungen, wird inzwischen aber ungern so ausgedrückt. Man will keine Fraktionen innerhalb einer Randgruppe spalten, keine Zwei-Klassengesellschaft von Wohnungslosen schaffen.
In jedem Fall kann der Schritt vom Bettler zum Verkäufer eine qualitative Veränderung bedeuten. Ganz offensichtlich bietet die Zeitung einen konkreten materiellen Vorteil: ein halbwegs kalkulierbarer Verdienst zusätzlich zu Sozialhilfe, von der die meisten Wohnungslosen leben.
Psychosoziale Auswirkungen
Für den/die Einzelne/n soll der Zeitungsverkauf (und teilweise auch andere Formen der Beteiligung) unmittelbar positive Auswirkungen erzeugen: soziale Anerkennung, zunehmende Aufhebung der Isolation, Motivation, um neue Perspektiven zu entwickeln, Stärkung des Selbstbewußtseins.
4.2.3 Kritische Zusammenfassung
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Angebote von Straßenzeitungen (also vornehmlich der Zeitungsverkauf) der gesellschaftlichen Wiedereingliederung dienen sollen. Um dies zu erreichen, wird einerseits Beschäftigung angeboten, die eine materielle Verbesserung bedeutet (mehr dazu unter Punkt 4.3 und 4.4), andererseits werden psychosoziale Auswirkungen auf wohnungslose VerkäuferInnen erwartet, vor allem Steigerung des Selbstwertgefühls (genauer unter 4.5).
Sowohl die Hilfe zur Selbsthilfe im Sinne konkreter materieller Mittel oder eines Einstiegs hin zu Arbeit als auch die erwünschten psychosozialen Auswirkungen orientieren sich somit stark an der einzelnen Person.
Damit geht diese Form der organisierten Hilfe zur Selbsthilfe von einer individuellen Sichtweise und Problembewältigung aus.
Es wird der Eindruck vermittelt, es gebe Wohnungslose, die sich selbst helfen (lassen) und aktiv sind und andere, die dem Bild des "Sozialschmarotzers" (Focus Nr. 43/95) entsprechen (siehe 4.3.3 Leistungsprinzip).
Dabei ist die Gruppe der Wohnungslosen nur durch ein Merkmal, das der Wohnungslosigkeit und der damit einhergehenden Lebensumstände und Stigmatisierung homogen. Nicht jeder kann und will eine Straßenzeitung verkaufen oder redaktionell mitwirken. Dies wird z. B. daran deutlich, daß relativ wenige wohnungslose Frauen beteiligt sind[128].
Daher ist eine Individualisierung des Selbsthilfegedankens nach dem Motto "Jeder ist seines Glückes Schmied" nicht ausreichend. Der Selbsthilfegedanke umfaßt nicht nur die Befähigung des Einzelnen, seine Probleme künftig selbst lösen zu können, sondern auch die Schaffung von Gruppenbewußtsein, das eine nicht nur individuelle, sondern auch parteiliche Interessensvertretung fördert[129].
Allerdings meint Olk dazu, daß die "Stärkung der individuellen Handlungskompetenz und des Selbstvertrauens eine notwendige Voraussetzung für kollektive Artikulations- und Interessensvertretungsstrategien darstellt."[130]
Ein solcher Ansatz der parteilichen Interessensvertretung würde erfordern:
Straßenzeitungen sollten durch ihre Berichterstattung ein Gegengewicht zur übrigen Presse bilden. Inhalte und etwaige weitere Aktionen (z. B. Unterschriftensammlung) sollten aufklärend wirken. (mehr dazu unter 4.6)
Die innere Struktur von Straßenzeitungen könnte allenfalls in einem kleineren, überschaubaren Rahmen demokratisch sein, ansonsten würde die Effizienz leiden. Allerdings sollten z. B. Journalisten interessierten Wohnungslosen ihre Erfahrung zur Verfügung stellen und weitergeben im Sinne einer aktivierenden Zusammenarbeit.
Bislang ist die Hilfe zur Selbsthilfe bei Straßenzeitungen auf den einzelnen gerichtet. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es vermessen, den "Einstieg in den Ausstieg" zu propagieren, da die strukturellen Vorbedingungen (über sechs Millionen Arbeitslose, mangelnder günstiger Wohnraum) überhaupt nicht vorhanden sind.
Zwar versucht beispielsweise Hinz & Kunzt und auch der Wohnungslooser Wohnräume und Arbeitsplätze zu akquirieren bzw. zu schaffen, doch können diese Initiativen nur wenige Personen mit dem Gewünschten versorgen. Diese Projekte können Vorbild oder Anstoß sein, über ihre regionale Bedeutung werden sie aber nur hinauswachsen, wenn Bund und Länder in die Pflicht genommen werden und sowohl rechtliche (z. B. durch Beschlagnahmung von leerstehendem Wohnraum) als auch finanzielle Unterstützung geben.
4.3 "Ich verkaufe die neueste Ausgabe der..." - Das Arbeitsangebot der Straßenzeitungen
4.3.1 Welche Art von Beschäftigung bieten Straßenzeitungen an?
Wohnungslose sind unterschiedlich intensiv an Straßenzeitungen beteiligt. Im Umfeld von Straßenzeitungen wird Beschäftigung in zweierlei Hinsicht angeboten:
die redaktionelle Mitarbeit, welche das Verfassen von Artikeln, Zusammenstellung von Beiträgen und weitere Organisationsformen umfaßt, sowie
die Organisation des Vertriebs und der Verkauf auf der Straße. Letzteres ist für die weitaus meisten der beteiligten Wohnungslosen die hauptsächliche Form der Beschäftigung. Der Verkauf durch Wohnungslose gehört zum Marktkonzept. Daher wird der Schwerpunkt dieser Betrachtungen auf den Bedingungen und Möglichkeiten des Verkaufs liegen.
4.3.1.1 Wohnungslose in der Redaktion
Die redaktionelle Mitgestaltung ist bei Hinz & Kunzt sowie bei dem Dach größtenteils in der Hand von Zeitungen in ihren Zusammenhang einzuordnen (Kapitel 3).
In Kapitel 4 werden die unterschiedlichen Konzeptionen der exemplarisch dargestellten Zeitungsinitiativen im Hinblick auf ihre Wirkung auf und für Wohnungslose verglichen. Werden die Zeitungen ihren selbstgestellten Ansprüchen und Zielen gerecht? Wie wirken sich konzeptionelle Unterschiede aus?
Anschließend (Kapitel 5) soll versucht werden, die in Deutschland noch relativ junge Erscheinung der Straßenzeitungen in das konventionelle Hilfesystem einzu engagierten BürgerInnen, aber nicht von Betroffenen.
Hinz & Kunzt bietet vergleichsweise in nur geringem Umfang die Möglichkeit für Wohnungslose, sich in der Redaktion zu beteiligen, d. h. sie können Beiträge für die "Forum"-Seiten zur Verfügung stellen.
Bei dem Dach wurden in der Vergangenheit auch Beiträge, z. B. die eigene Lebensgeschichte, von Wohnungslosen geschrieben, in der "neuen" Dach ist kein Artikel dieser Art dabei, dies soll aber geändert werden.
Die MitarbeiterInnen des TagesSatz verstehen sich als gleichberechtigtes Team. In jedem Heft sind Artikel von Betroffenen und Nicht-Betroffenen, die sich inhaltlich unterscheiden bzw. ergänzen (z. B. eigenes Schicksal gegenüber Wohnungssituation in Kassel).
Der Wohnungslooser wird von ehemals Betroffenen geleitet. Hier sind eine Vielzahl an Beiträgen von Wohnungslosen dabei, aber auch von SozialarbeiterInnen, Architekten, Politikwissenschaftlern usw.
4.3.1.2 Wohnungslose verkaufen auf der Straße
Die Verkaufstätigkeit fällt ganz sicher in den Bereich "niedrigschwelliges Angebot", d. h. es sind neben dem Nachweis der Wohnungslosigkeit (bei Hinz & Kunzt und Dach, anders TagesSatz, Wohnungslooser: Bürger in sozialen Schwierigkeiten) weder besondere Voraussetzungen noch besondere Kenntnisse erforderlich.
Die einzige Einschränkung der Niedrigschwelligkeit sind die Verkaufsregeln bei Hinz & Kunzt und dem TagesSatz, zu denen sich jede/r VerkäuferIn verpflichten muß.
Die Verkaufsregeln dienen einerseits der Aufrechterhaltung eines positiven Images nach außen hin (z.B. nicht betrunken sein, keine Pöbelei), das "bürgerlichen" Werten entspricht. Andererseits wird eine Disziplinierung des Wohnungslosen im Alltag eingefordert.
4.3.2 Gesellschaftliche Wiedereingliederung
4.3.2.1 Einstieg in ein geregeltes Leben - Arbeit mit Übergangscharakter
Hinz & Kunzt sieht die Verkaufstätigkeit als " Einstieg in ein geregeltes Leben", nach dem TagesSatz soll die Mitarbeit allgemein die "gesellschaftliche Reintegration" fördern, laut Wohnungslooser kann der Straßenverkauf den Betroffenen helfen, sich "wieder an ein geregeltes Leben zu gewöhnen", das Dach hat die Erfahrung gemacht, daß der Verkauf dazu beitragen kann, den Tag zu strukturieren.
Der bei allen Projekten mehr oder minder (am wenigsten Das Dach) betonte Nutzen der Verkäufertätigkeit als "Einstieg" in Arbeit deutet auf einen Übergangscharakter des Beschäftigungsangebots hin.
Ein Weiterkommen innerhalb eines Projekts ist nur für eine begrenzte Anzahl von Wohnungslosen möglich. Eine Festanstellung bei einer Zeitung ist nur für wenige möglich. Bei den hier vorgestellten Straßenzeitungen kommt dies allenfalls bei Hinz & Kunzt infrage, da bei den anderen Projekten weitgehend ehrenamtlich gearbeitet wird.
Das Arbeitsangebot der Straßenzeitungen zum Zeitungsverkauf soll eine (legale) Handlungsalternative zum Betteln sein, d. h. konkurrierende Handlungsmöglichkeiten innerhalb einer Person darstellen[131].
Für diejenigen, die von dem Angebot Gebrauch machen, bietet sich zwar kein versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis, aber finanzielle Vorteile. Damit wird ein neuer, höherer Standard unter den Wohnungslosen geschaffen.
Dennoch kann, selbst bei einer langfristigen Absicherung bzw. Etablierung der Zeitungen, das Einkommen aus dem Zeitungsverkauf in der Regel nur ein Zubrot sein, keinesfalls eine gesicherte Lebensgrundlage.
Ein weiterer "zweiter Arbeitsmarkt" ist entstanden.
4.3.2.2 Qualifizierung der MitarbeiterInnen
Qualitativ ist die Verkaufstätigkeit eine wenig anspruchsvolle, ungesicherte Arbeit, die keine besondere handwerkliche oder geistige Vorbildung erfordert. Diese Art von Arbeit knüpft wohl in den seltensten Fällen an bisherige berufliche Erfahrungen an[132].
Im Rahmen der Zeitungsproduktion naheliegende weitere Qualifizierungen, wie z. B. im Umgang mit Computern, der Verwaltung, der Druckerei, um die Chancen auf dem freien Arbeitsmarkt zu verbessern, werden wenig genutzt. Eine Ausnahme bildet der Wohnungslooser, der Arbeit, jedoch keine Ausbildung, in der angeschlossenen Druckerei bietet.
Der Alltag gliedert sich für Wohnungslose in der Regel durch den obligatorischen Gang zum Sozialamt, der Beschaffung von Mahlzeiten und der Suche nach einem Schlafplatz[133]. Wohnungslose sind häufig jahrelang arbeitslos bzw. nehmen Gelegenheitsarbeiten an[134].
Den Tag mit einem bestimmten Ziel im Auge einzuteilen, nämlich wieviel Zeit für den Verkauf eingeplant werden muß, an welchem Platz verkauft werden soll (soweit dies nicht durch Vertriebsmitarbeiter vorgegeben wird), also im Hinblick auf die Erarbeitung des Lebensunterhalts bzw. eines Nebeneinkommens, kann durchaus sinnstiftend sein: Die selbstverantwortliche Tätigkeit hilft, den Tag zu strukturieren.
Auch wenn der zeitliche Aufwand selbst bestimmt werden kann, hat der Wohnungslose hier eine Aufgabe, die einiges an Disziplin und Durchhaltevermögen abverlangt, so z. B. Kälte und Frustation zu ertragen, Verkaufsregeln einzuhalten.
Diese Disziplin oder Anpassung ist eine Fähigkeit, die in Ansätzen auch in einem Angestellten- oder Arbeiterverhältnis erwartet wird. Insofern kann der Verkauf tatsächlich eine Auslese auf einem Minimalstandard zur Aufnahme einer regulären Arbeit fördern.
Trotz der möglicherweise zu erlangenden persönlichen Voraussetzungen erfolgt keine weitergehende berufliche Qualifizierung.
4.3.2.3 Anschluß an den Arbeitsmarkt
Es ist sicher nicht selten, daß jemand aus dem Sozialhilfebezug aussteigen will. Um dies dauerhaft zu erreichen, ist aber ein geregeltes, verläßliches Einkommen notwendig, keine ungesicherte, nicht sozialversicherungspflichtige (und auch saisonabhängige!) Beschäftigung. Auf diese Weise können keine Ansprüche z. B. auf Arbeitslosengeld erworben werden. Was also kommt nach dem Zeitungsverkauf?
Die neue Zusammenarbeit mit Beschäftigungsstellen und dem Arbeitsamt (ABM-Stellen) bei Hinz & Kunzt ist hier ein vergleichsweise weiterführender Ansatz mit größeren Perspektiven, da z. B. bei einer ABM-Stelle zumindest eine gesicherte Beschäftigung für in der Regel 1 Jahr angeboten wird.
Die angeschlossenen Arbeitsprojekte des Wohnungsloosers sollen zu festen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen oder Kleinunternehmertum führen. Davon abgesehen, daß der Verein eine Absicherung im Falle eines Konkurses vermutlich schwerlich leisten könnte, ist dies ein Ansatz der zwar regional und auf wenige beschränkt ist, jedoch recht erfolgreich zu werden verspricht. Aus einer solchen Position wären die Chancen, eine Wohnung bzw. eine langfristige Arbeit zu erlangen ungleich größer.
Auch das Sozialamt ist nach §19 BSHG verpflichtet, Arbeitsgelegenheiten zu schaffen. Dabei kann es sich um gemeinnützige oder zusätzliche[135] Arbeit handeln. Hierfür kann entweder ein Tariflohn oder eine "angemessene Entschädigung für Mehraufwendungen gewährt werden" (§19,2 BSHG). Bei letzterem handelt es sich meist um Stundenlöhne um die 2 DM. In keinem Fall wird ein Arbeitsverhältnis im rechtlichen Sinne begründet (§ 19,3 BSHG).
Ohne Fortbildung besteht kaum Aussicht, Chancen im regulären Markt zu vergrößern. Andererseits muß man auch bedenken, daß angelernte Arbeiter in dieser Zeit der steigenden Arbeitslosigkeit ohnehin kaum realistische Chancen haben. Firmen reduzieren Personal, wo es nur geht, Neueinstellungen müssen herausragen, wenn die Auswahl besteht, steht ein Wohnungsloser sicher am Ende der Liste, ob qualifiziert oder nicht. Also doch alles nur Augenwischerei und falsche Hoffnungen?
Die Gründung von Arbeitsprojekten und Beschäftigungsmaßnahmen jeder Art, ob von Arbeits- oder Sozialamt initiiert, erscheint unter Bedingungen von Massenarbeitslosigkeit wie blanker Hohn: Arbeitslose werden auch dann beschäftigt, "wenn ihre Arbeitskraft nicht mehr gebraucht wird."[136]
4.3.3 "Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen?" - Das Leistungsprinzip
Neben den offensichtlichen finanziellen Einbußen durch Arbeitslosigkeit (nicht umsonst sind fast alle Wohnungslosen Sozialhilfeempfänger bzw. Empfänger von anderen Ersatzleistungen)[137] besteht damit einhergehend auch eine psychische und soziale Belastung durch Arbeitslosigkeit: Schulden, zunehmende Isolation, Gefühl der eigenen Wertlosigkeit usw. Arbeitslose sind depressionsanfälliger, stärker suizidgefährdet[138] - diese Probleme müssen sich bei Wohnungslosen noch potenzieren.
Betont wird in allen dargestellten Projekten, daß Wohnungslose nicht mehr betteln müssen. Stattdessen haben sie ein Produkt anzubieten, so daß eine Käufer-Verkäufer-Beziehung entsteht[139]. Indem Wohnungslose als GeschäftspartnerInnen auftreten, erfahren sie soziale Anerkennung, die bettelnden oder nur "herumsitzenden" Wohnungslosen in der Regel nicht zuteil wird.
Aus welchen Motiven wird die Zeitung aber gekauft? Dies wäre nur durch eine ausführliche Befragung von Käufern zu klären, die im Rahmen dieser Arbeit nicht durchführbar ist.
Mögliche Gründe aber wären: (vgl. dazu Exkurs)[140]
Die Zeitung hat einen gewissen Gebrauchs- oder Informationswert, sei es durch Veranstaltungshinweise oder sozialpolitische Berichterstattung. In diesem Fall würde die Zeitung aus Interesse gekauft.
Eine andere Möglichkeit ist, daß Käufer die Aktivität des Verkäufers honorieren wollen ("Der tut was"), der somit dem landläufigen Klischee des "faulen Nichtsnutz" widerspricht. Hier wäre der Kauf eine Honorierung der "Arbeitsmoral".
Oder für Käufer ist es einfacher, über ein Medium eine Spende zu geben. Hier wäre das Helfermotiv ausschlaggebend.
Im ersten Fall wäre eines der Hauptziele von Straßenzeitungen, die Öffentlichkeit aufzuklären, Interesse zu wecken, erfüllt.
Wird eine Zeitung unter dem zweiten Aspekt gekauft, würde damit unfreiwillig einer Aufteilung in "gute", d. h. "arbeitswillige" und "schlechte", d. h. "arbeitsunwillige" Wohnungslose Vorschub geleistet. Die "soziale Anerkennung" aus einem solchen Grund wäre äußert bedenklich, da es sich um eine zweckgebundene Wertschätzung handelte.
Im dritten Fall würde der wohnungslose Verkäufer einer verfeinerten Form des Bettelns nachgehen. Der Verkauf durch Wohnungslose gehört zur Marketingstrategie, löste diese nur eine "veraltete Form des Bettelns" ab, in der die milde Gabe über ein Medium vergeben wird, würde dies den Zielen der Straßenzeitungen entgegenlaufen, wenn dies der einzige Grund wäre und die Zeitung nicht aus Interesse sondern Mitleid gekauft wird.
Nicht jeder Wohnungslose kann oder will Zeitungsverkäufer werden. Liegt das vielleicht daran, daß sich diejenigen, die mitarbeiten "auf der Straße noch nie eingerichtet haben", wie der Wohnungslooser bemerkt[141]. Ähnliches meint auch Hinz & Kunzt: Wir wollen "...den Teil ansprechen, der noch nicht so weit weg ist von der Möglichkeit der Re-Integration in die Gesellschaft."[142]
Ist also das Angebot doch nicht so niedrigschwellig, findet hier eine Auslese derjenigen statt, die (noch) die Fähigkeit und die Kraft haben, etwas zu versuchen?
Damit könnte einer Auslese der Leistungsfähigsten, der Entstehung einer "Zwei-Klassen-Gesellschaft von Wohnungslosen" Vorschub geleistet werden: Die, die sich "bewährt" haben, können eventuell weitergeschleust werden.
Die Gefahr der Spaltung einer Randgruppe wurde mittlerweile bei den Straßenzeitungen weitgehend erkannt und sie verstehen sich als Vertreter aller Wohnungslosen. Dies heißt aber noch nicht, daß Passanten einer solidarisierenden Sichtweise notwendigerweise folgen, die Gefahr ist folglich weiterhin gegeben.
4.3.4 Zusammenfassung
Das Arbeitsangebot der Straßenzeitungen ist für Wohnungslose meistens gleichbedeutend mit Straßenverkauf. Trotz der teilweise aufgestellten Verkaufsregeln handelt es sich um ein niedrigschwelliges Arbeitsangebot. Es werden Versorgungslücken an Arbeit aufgezeigt und auf diesem niedrigen Niveau auch gedeckt.
Ein weiterer "Zweiter Arbeitsmarkt" ist entstanden, der die Gefahr der Entstehung eines Substandards unter Wohnungslosen beinhaltet.
Der Zeitungsverkauf ist eine Arbeit mit Übergangscharakter. Dies liegt einerseits in der Natur der Arbeit (kein sozialversicherungspflichtiges Verhältnis, ungeregeltes und unregelmäßiges Einkommen). Andererseits verfügen die Zeitungsinitiativen zum jetzigen Zeitpunkt nicht über die notwendigen, vor allem finanziellen Voraussetzungen, um für eine Weiterbildung ihrer MitarbeiterInnen zu sorgen. Auch eine Qualifizierung von Wohnungslosen, um zentrale Funktionen bei einer Zeitung übernehmen zu können, wäre wünschenswert.
Daher kann der Zeitungsverkauf nicht mehr als eine Zwischenlösung sein: Zwar bietet er einen konkreten materiellen Nutzen, aber keine langfristigen Perspektiven.
Eine Wiedereingliederung in den regulären Arbeitsmarkt ist fraglich, und ist allenfalls für Einzelne erreichbar. Dies liegt auch an der derzeitigen Arbeitsmarktsituation. Daher kann man nicht von mehr als einem Einstieg in ein geregeltes Leben sprechen; eine Behauptung Wohnungslose würden - quasi automatisch - durch den Zeitungsverkauf auf den Arbeitsmarkt geschleust, ist mangels struktureller Vorbedingungen unhaltbar.
Auflagenstärkere Zeitungen wie Hinz & Kunzt und Wohnungslooser versuchen, selbst feste Arbeitsplätze zu schaffen. Diese Maßnahmen können zweifellos Vorbild sein. Mit ihren finanziellen Möglichkeiten kann dies aber nur im Einzelfall und von regionaler Bedeutung sein.
Wo die Arbeitsangebote überbetont werden, folgen Straßenzeitungen tendenziell einer gängigen Ideologie von Arbeit, die soziale Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe von dem Status der Lohnarbeit abhängig macht.
Die Zukunft liegt wieder in den Händen des einzelnen, strukturelle Zusammenhänge werden nicht bewußt gemacht: einer "wachenden Zahl von Menschen [wird, d. Verf.], strukturell die Möglichkeit vorenthalten, den an sie gestellten Erwartungen gerecht zu werden. Würde sich die Einsicht in diesen Zusammenhang als allgemeines gesellschaftliches Bewußtsein etablieren, so hätte dies unabsehbare destabilisierende Konsequenzen."[143]
"Hier wird ein strukturelles Problem, das kennzeichnend ist für privatwirtschaftlich organisierte Produktions- und Gesellschaftsverhältnisse umdefiniert in individuelle soziale Hilfebedürftigkeit."[144]
Folglich sollte die Bedeutsamkeit der Straßenzeitungen hinsichtlich der Arbeitsmöglichkeiten nicht überbewertet werden, obwohl sie Anstöße zum Umgang mit einem wachsenden Problem, das zunehmend mehr Menschen betrifft, geben können. Dennoch liegen ihre herausragenden Chancen in einem anderen Bereich, d. h. sie könnten als Verständigungsmittel zwischen wohnender und wohnungsloser Bevölkerung dienen, und so zur Ent-Stigmatisierung von Wohnungslosen beitragen.
4.4 Zusatzverdienst
4.4.1 Die finanzielle Situation von Wohnungslosen - Allgemeines
Wohnungslose leben üblicherweise von Sozialhilfebezug, Arbeitslosengeld, - hilfe oder Rente, wenige gehen einer Arbeit nach. Wenn doch, betrifft dies hauptsächlich die Bereiche Lager- und Transporttätigkeit, Bauhilfsarbeit, dies obendrein in aller Regel nicht kontinuierlich[145].
Zudem haben Wohnungslose nicht selten Schulden. Bei der Befragung von John aus den Jahren 1977-83 gaben von 83 Interviewpartnern 23% an, keine Schulden über DM 200, 77% hatten Schulden über DM 200. Die befragten Wohunungslosen hatten durchschnittlich Schulden von DM 7.700[146].
Hier soll lediglich der Umgang mit Sozialhilfe näher beleuchtet werden, da dies den Großteil der Wohnungslosen betrifft[147].
4.4.2 Verdienst durch Zeitungsverkauf
Der Verdienst durch den Zeitungsverkauf bzw. Autorenhonorar bewegt sich im Spektrum zwischen "Taschengeld" und "Finanzierung des gesamten Lebensunterhaltes". Bei der Befragung von 10 Berliner Verkäufern gaben diese ein durchschnittliches Einkommen von DM 50 pro Tag an[148].
In jedem Fall handelt es um kein beständiges, verläßliches Einkommen.
Nach Angaben des Wohnungslooser gibt das Einkommen die notwendige Motivation, den Zeitungsverkauf durchzuhalten.
Bei Hinz & Kunzt ist damit die Erwartung verbunden, daß VerkäuferInnen besser lernen, sich ihr Geld einzuteilen. Es ist nicht bekannt, ob Wohnunglose wirtschaften können oder dies tatsächlich erst lernen müssen. Diese pädagogische Intention könnte überflüssig sein und wäre zu überprüfen. Tatsache ist, daß VerkäuferInnen kleinunternehmerisch denken und planen müssen.
Möglicherweise ist der Zeitungsverkauf besonders attraktiv für überschuldete Wohnungslose, deren Einkommen aus einer regulären Arbeit gepfändet würde.
Eine weitere interessante Fragestellung wäre, ob der Zusatzverdienst eine etwaige Beschaffungskriminalität drogensüchtiger Wohnungsloser reduziert.
4.4.3 Anrechnung auf Sozialhilfe
4.4.3.1 Die Natur der Sozialhilfe
Die meisten Wohnungslosen sind Bezieher von Sozialhilfe, d. h. für die außerhalb von Einrichtungen nach §72 BSHG Lebenden ist dies Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU).
Einen Rechtsanspruch auf Sozialhilfe hat jeder, "der seinen notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus seinem Einkommen und Vermögen, beschaffen kann (§11,1 S. 1 BSHG).
"Aufgabe der Sozialhilfe ist es, dem Empfänger der Hilfe die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe soll ihn soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; hierbei muß er nach Kräften mitwirken." (§1,2 BSHG)
In Satz 2 des §1 wird die Befähigung zu Selbsthilfe angesprochen. Damit ist in der Regel die (Wieder-)Herstellung der Arbeitsfähigkeit gemeint[149]. Dazu sollen Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden (§19 BSHG).
Dabei ist die Sozialhilfe nicht nur gegenüber dem Einsatz von Einkommen und Vermögen sowie den eigenen Kräften, sondern auch den Leistungen anderer Träger (z. B. Krankenkasse, Arbeitsamt) nachrangig (§2 BSHG).
Interessant für den Umgang der örtlichen Sozialhilfeträger mit den Einkünften aus dem Verkauf von Zeitungen ist Abschnitt 4 des BSHG, welcher sich mit dem Einsatz von Einkommen und Vermögen befaßt. "Zum Einkommen im Sinne dieses Gesetzes gehören alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert..."(§76,1 S. 1 BSHG).
"Das Einkommen ist voll auf den festgestellten Bedarf anzurechnen, als Hilfe wird nur der Unterschiedsbetrag zwischen Einkommen und Regelsatz gewährt."[150]
4.4.3.2 Derzeitige Rechtspraxis
Die sozialhilferechtliche Praxis begreift den Verdienst aus Zeitungsverkauf als anrechenbares Einkommen. Zum Teil bestehen rechtliche Ausnahmegenehmigungen, so z. B. in Hamburg und Chemnitz.
Die folgende Auswahl der Städte nimmt Bezug auf die vier vorgestellten Zeitungsinitiativen.
Hamburg
Durch eine Sonderregelung bleiben die Einkünfte für VerkäuferInnen ein halbes Jahr anrechnungsfrei. Danach kann der einzelne mit seinem zuständigen Sachbearbeiter eine passende Regelung aushandeln, z. B. daß das Einkommen dazu genutzt wird, Schulden abzutragen.
Kassel
Das Sozialamt der Stadt Kassel wollte anfänglich abwarten, um "Erfahrungswerte" zu sammeln. Seither wurde von seiten der Stadt kein Kontakt gesucht. Insofern könnte man hier von einem "stillschweigenden Dulden" sprechen.
In den Vertriebsrichtlinien wurde zudem eine grundsätzliche Möglichkeit angeführt, zu der VerkäuferInnen sich verpflichten müssen:
Auf Grundlage des § 3 Nr. 26 EStG werden die Einkünfte aus dem Zeitungsverkauf als Aufwandsentschädigung für eine "nebenberufliche Tätigkeit zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchliche Zwecke" gesehen. Dies bedeutet, daß Einkünfte bis zu DM 2.400 jährlich (dies entspricht DM 200 pro Monat) nicht steuerpflichtig sind. Darüberhinausgehende Einkünfte müssen dem Finanz-, Arbeits-, bzw. Sozialamt gemeldet werden, wo sie gegebenenfalls angerechnet werden.
Chemnitz
Auf Beschluß des Sozialamtes werden Einnahmen aus dem Verkauf nicht auf Sozialhilfe angerechnet, um dem Projekt eine Chance zu geben.
Darmstadt
In Darmstadt gibt es keine besondere Regelung. Ein Mitarbeiter des Sozialamtes teilte mit, daß Einkünfte bei Bekanntwerden auf die HLU angerechnet würden. Allerdings vermutete er, daß geringfügige Beträge großzügig behandelt würden und nicht zur Anrechnung kämen.
4.4.3.3 Für und wider einer Anrechnung
Sowohl Autorenhonorar als auch Einkünfte durch Zeitungsverkauf werden von Sozialämtern regelmäßig als anrechenbares Einkommen im Sinne des BSHG (§ 76) betrachtet.
Generell ist der Nachweis über die erzielten Einkünfte schwierig, es besteht eine "Grauzone". Die einzige Möglichkeit, einen genauen Wert über die Einkünfte eines Wohnungslosen durch Zeitungsverkauf zu erhalten, wäre, bei der jeweiligen Zeitung nachzufragen. Damit würden aber die Zeitungsinitiativen zu einer weiteren Kontrollinstanz, hier eine des Sozialamtes.
Allerdings gilt allgemein, daß der Sozialhilfeträger im Einzelfall nach pflichtmäßigem Ermessen zu prüfen hat (§3 und 4 BSHG). Eine pauschalisierende Anrechnung von zusätzlichem Einkommen durch Zeitungsverkauf ist daher abzulehnen.
Schon im allgemeinen Teil des BSHG wird gefordert, der Empfänger von Sozialhilfe soll nach seinen Kräften mitwirken, zukünftig unabhängig von der Hilfe zu leben.
Dies zielt regelmäßig auf eine berufliche Tätigkeit ab. Es besteht die Möglichkeit, die "Arbeitsbereitschaft zu prüfen" oder den Hilfeempfänger an "Arbeit zu gewöhnen" (§20 BSHG). Dazu sollen Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden, welche "in der Regel von vorübergehender Dauer und für eine bessere Eingliederung des Hilfesuchenden in das Arbeitsleben geeignet sein" sollen (§19,1 BSHG).
Für die Verrichtung von "gemeinnütziger und zusätzlicher" Arbeit kann "das übliche Arbeitsentgelt oder Hilfe zum Lebensunterhalt zuzüglich einer angemessenen Entschädigung für Mehraufwendungen gewährt werden" (§19,2 BSHG). Eine Reduzierung der Einkünfte würde niemandes "Arbeitsbereitschaft fördern".
Die zweite Alternative der Vergütung wäre im Fall der Straßenzeitungen die relevante, gesteht man Straßenzeitungen zu, daß sie Selbsthilfekräfte aktivieren.
Denkbar ist, die Mitarbeit bei Straßenzeitung als "Arbeitsgelegenheit" im Sinne des §19 BSHG einzustufen. Somit könnte das Einkommen als "Entschädigung für Mehraufwendungen" gerechnet werden. Allerdings bestünde dann die Gefahr, daß Straßenzeitungen benutzt werden, um Sozialhilfeempfänger zur Arbeit zu verpflichten, was den Interessen von Straßenzeitungen widersprechen würde.
Eine weitere Möglichkeit der Regelung wäre, im Einzelfall das Einkommen zu nutzen, um die Voraussetzungen zu schaffen, künftig unabhängig von Sozialhilfe zu leben. Vorstellbar wäre beispielsweise, Schulden abzutragen, um bei einer Bewerbung um einen festen Arbeitsplatz nicht von Lohnpfändung bedroht zu sein. Das zusätzliche Einkommen könnte auch genutzt werden, um z. B. freiwillig Beiträge zur Rentenversicherung zu zahlen. Letzeres ist nach §14 BSHG nur eine "Kann-Leistung"[151].
Die Möglichkeit, nach dem Einkommenssteuergesetz einen Verdienst bis DM 2.400 pro Jahr anrechnungsfrei zu halten, würde jeder Straßenzeitung offenstehen, die als "gemeinnützig" (wie Hinz & Kunzt, Verein Arbeit und Wohnen/Wohnungslooser) oder "mildtätig" (Sozial-kultureller Förderverein/TagesSatz) anerkannt ist.
Es wäre Aufgabe der jeweiligen Träger von Straßenzeitungen, mit dem zuständigen Sozialamt eine Regelung auszuhandeln, die den Straßenverkauf einer Arbeitsgelegenheit im Sinne des § 19 BSHG gleichstellt (falls dies gewünscht wird) oder Argumentationshilfen für eine Einzelfallregelung zu bieten.
4.4.4 Zusammenfassung
Die materiellen Vorteile, die sich aus dem Zusatzverdienst ergeben, können genutzt werden, den VerkäuferInnen eine höhere Lebensqualität zu verschaffen. Hier sei noch einmal auf die Gefahr der Entstehung eines Substandards hingewiesen.
Einkünfte aus dem Zeitungsverkauf werden von Sozialämtern regelmäßig als Einkommen im Sinne des BSHG betrachtet.
Allerdings stehen mehrere Lösungen zur Verfügung, den Zusatzverdienst den VerkäuferInnen wenigstens teilweise zu überlassen: Eine Sonderregelung mit dem zuständigen Sozialhilfeträger (wie in Hamburg), den Verweis auf Aufwandsentschädigung bei Tätigkeiten für einen gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck (Kassel) oder, wenn auch aufwendiger, eine individuelle Regelung.
Wünschenswert wäre ein Informationsaustausch der Straßenzeitungen untereinander, um zu einer bundesweiten einheitlichen Regelung zu gelangen, welche die Interessen von wohnungslosen VerkäuferInnen berücksichtigt. Sicher ist, daß eine volle Anrechnung nicht zur Motivation von VerkäuferInnen beiträgt. Würden aber dem Sozialamt gegenüber Informationen verschwiegen, machten sich zum einen VerkäuferInnen strafbar, zum anderen trüge dies nicht zu einem vorurteilsfreieren Verhältnis zwischen wohnungslosen BürgerInnen und dem Hilfesystem bei.
4.5 Psychosoziale Auswirkungen - Sind Straßenzeitungen Selbstwertprojekte?
4.5.1 Selbstwertgefühl - was ist das?
Die in den Darstellungen von Straßenzeitungen beschriebene "Steigerung des Selbstbewußtseins" meint nicht den psychologischen Begriff des "Ich-Bewußtseins" im Gegensatz zu anderen Personen. Vielmehr wird "Selbstbewußtsein" eher umgangssprachlich verwendet, meint also den Selbstwert.
Zwar gibt es in der psychologischen Literatur keine einheitliche Begriffsbestimmung von "Selbstwertgefühl", eine Arbeitsdefinition nach Frey und Benning (1983) und Fillipp und Frey (1987) soll hier jedoch als Grundlage gegeben werden.
"Das Selbstkonzept ist die Summe der Urteile einer Person über sich selbst (z. B. "ich bin intelligent"). Die affektiven Beurteilungen dieser einzelnen Ansichten über die eigene Person, d. h. deren positive bzw. negative Bewertungen, werden Selbsteinschätzungen genannt.... Das Selbstwertgefühl wiederum ergibt sich als Summe der gewichteten Selbsteinschätzungen."[152]
Der Aufbau sowie Veränderungen des Selbstkonzeptes erfolgen auf der Grundlage von Beobachtungen eigenen Verhaltens und eigenen physiologischer und emotionaler Zustände. Die zweite Quelle sind "...Rückmeldungen über eigenes Verhalten oder eigene Eigenschaften aus der sozialen Umwelt bzw. direkte und indirekte Prädikatenzuweisungen."[153]
4.5.2 Soziale Kontakte von Wohnungslosen
Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, daß die soziale Situation von Wohnungslosen vorwiegend von Kontaktarmut und Isolation bestimmt ist.
80% der von Wickert (1976) befragten Wohnungslosen bezeichnen sich als "einsam", sich auf diese Untersuchung beziehend, spricht John von "stark erhöhten Depressionswerten"[154].
Johns eigene Befragung von 105 Wohnungslosen ergab, daß 75,7% der Befragten Kontakt zu beiden Elternteilen verloren hatten, den Kontakt zu einem Elternteil 17,5%[155] . Zu weiteren "wichtigen Verwandten" (bewußt offene Definition) hatte etwa die Hälfte Kontakt. 61,1% gaben an, überhaupt keine Freunde/Freundinnen zu haben, die übrigen 38,1% hatten durchschnittlich 2,8 Freunde/Freundinnen[156].
Die Sozialkontakte zu ebenfalls von Wohnungslosigkeit betroffenen, scheinen hauptsächlich durch materielle Solidarität bestimmt. John spricht von einer Beziehungsstruktur, "die auf einer gemeinsamen Notökonomie, vorwiegend ohne intensivere menschliche Beziehungen, zugleich verbunden mit Elementen starker Ausbeutung und Unterdrückung beruht."[157]
Weitere Beziehungen bestehen "zur Sozialverwaltung, zur Arbeitsverwaltung, zu den Einrichtungen und überhaupt zum Hilfesystem, darüberhinaus zu den Ordnungsbehörden, zur Polizei, zu den Gerichten zu den verschiedenen Arbeitgebern, ... zu bestimmten Gaststätten und Lokalen..." Die Gestörtheit dieser Beziehungen springt förmlich ins Auge - von beiden Seiten Vorurteile, taktischer Umgang miteinander, wohl auch Furcht.[158]
4.5.3 Das Selbstbild von Wohnungslosen
Nach Wickerts Ergebnissen wurden Abwertungen der Außenwelt ("taugen nichts", "kriminell", "arbeitsscheu" usw.[159]) kaum ins Selbstbild übernommen. "Der relativen Zufriedenheit mit der eigenen Person steht aber eine sehr starke Unzufriedenheit mit dem derzeitigen Leben gegenüber, das Leiden an der Ablehnung der eigenen Person durch die Umwelt steht dabei im Vordergrund."[160]
Demgegenüber beobachtete Girtler auch "einige negative Aspekte im Selbstbild der Wohnungslosen...so die Auffassung, sie seien an ihrem Elend selbst schuld."[161]
Soziale Normen von Wohnungslosen entsprechen nach Wickert den gesellschaftlichen Werten: So beurteilten beispielsweise 100% der Befragten "arbeitsscheu" als "schlecht" und "Hilfsbereitschaft" als "gut".[162]
4.5.4 "Heute noch Bettler am Straßenrand - morgen schon selbtbewußter Verkäufer..."[163] Steigerung des Selbstwerts durch Zeitungsverkauf?
Ein Steigerung des Selbstwerts ist abhängig von eigenen, als positiv eingeschätzten Erfahrungen, und Fremdeinschätzungen.
Aufhebung der Isolation
Kontakte, d. h. Interaktion in jeder Form, sind für jeden Menschen Voraussetzung, um das eigene Verhalten und Reaktionen der Außenwelt beobachten und bewerten zu können.
Zu wohnenden Menschen haben Wohnungslose in der Regel wenig Kontakt, es sei denn in "institutionalisierten" Bereichen, d. h. zu SozialarbeiterInnen etc. Durch den Verkauf einer Straßenzeitung ergeben sich gelegentlich Kaufgespräche, die der Ausgrenzung von Wohnungslosen entgegenwirken sollen.
Auch ergeben sich Kontakte zu wohnenden und wohnungslosen KollegInnen. Ob dies eine Identifikation mit dem Projekt oder die Entstehung eines "Gruppenbewußtseins" (vgl. 4.1.3, S. 25) fördert, müßte durch eine VerkäuferInnenbefragung geklärt werden.
Weitergehende Kontakte, gar Freundschaften bis Vermittlung von Arbeit und Wohnung bei StammverkäuferInnen sind jedoch wohl allenfalls Einzelfälle. Wieviel ein eventuelles Kaufgespräch als Schritt aus der Isolation ausmacht, ist fraglich, allerdings weitet sich dadurch zweifelsohne der Kreis von Kontakten außerhalb der "Szene".
Soziale Anerkennung
Die positiven Reaktionen aus Begegnungen mit KäuferInnen ("der tut was") zeigen soziale Anerkennung von ungewohnter Seite.
Dabei tut es für den Effekt wenig zur Sache, wenn die Anerkennung auf gesellschaftlichen zugrundeliegenden Wertvorstellungen beruht, die anscheinend von Wohnungslosen geteilt werden (siehe 4.4.3). Verkäuferregeln sorgen dafür, daß ein bestimmtes Bild aufrechterhalten wird, beispielsweise, wenn während des Verkaufs kein Alkohol getrunken werden soll. Auch eigene Werte werden honoriert, z. B. "ich bin nicht faul".
Erfolgserlebnis durch Arbeit
Zeitungsverkauf ermöglicht es, einen Teil des Lebenseinkommens selbst zu tragen. Wohnungslose "erfahren, daß ihre Arbeitskraft doch noch einen Wert hat" (Hinz & Kunzt). Das Durchhalten des Zeitungsverkaufs ist laut Wohnungslooser ein Erfolg in sich und stärkt das Selbstvertrauen.
"Ein Leben ohne Arbeit ist kein Leben"[164] -
Dieser provozierende Titel des Wohnungslooser zeugt davon, daß Menschen sich häufig über (Erwerbs-) Arbeit selbst definieren. Damit wird der zweckfreie Selbstwert infragegestellt: "In unserer Leistungsgesellschaft werden wir gemessen an dem, was wir leisten, nicht an dem was wir sind."[165]
Persönliche Zufriedenheit
Insgesamt mag die verkäuferische oder redaktionelle Mitarbeit zu einem Gefühl des persönlichen Erfolgs beitragen. Wohnungslosen wird - in verschiedenem Umfang - die Möglichkeit gegeben, sich bemerkbar zu machen. In Artikeln können sie ihre Stimme erheben. Zudem kann die eigene Arbeitskraft zum Lebensunterhalt eingesetzt werden.
Die Reaktionen der Öffentlichkeit scheinen eher positiv zu sein und somit zu einem Abbau von Vorurteilen und einer Ent-Stigmatisierung von Wohnungslosen beitragen.
4.5.5 Zusammenfassung
Die angeführten möglichen Auswirkungen beruhen auf den Beobachtungen und Erlebnissen von MitarbeiterInnen von Straßenzeitungen. Um Genaueres zu erfahren, müßte man mit den VerkäuferInnen selbst sprechen.
Insgesamt scheint es durchaus wahrscheinlich, daß anerkennende Reaktionen von KäuferInnen sowie der eigene Beitrag zum Lebensunterhalt das Selbstbild Wohnungsloser positiv verstärken.
4.6 Öffentlichkeitsarbeit/Die Wirkung in und für die Öffentlichkeit
4.6.1 Präsenz der Straßenzeitungen im Stadtbild
In fast jeder größeren Stadt gibt es mittlerweile eine Straßenzeitung, sie sind also durchaus flächendeckend.
Vermögen Straßenzeitungen es, Interesse bei vorbeihastenden Berufstätigen, EinkäuferInnen zu wecken? Können Straßenzeitungen durch ihre bloße Präsenz im Stadtbild Passanten neugierig machen auf Menschen, an denen man gewöhnlich vorbeisieht?
Erfahrungen von Verkäufern sprechen dafür, der Wiedererkennungswert der Blätter ist hoch. Dies könnte dazu beitragen, Wohnungslose im Stadtbild zu etablieren und nicht mehr einen störenden Anblick in ihnen zu sehen. Inwiefern eine solche Wirkung Einfluß auf das soziale Klima nehmen könnte, ist an dieser Stelle allerdings nicht zu klären.
4.6.2 Kreuzworträtsel und Wohnungsnot - Inhaltliche Aspekte
Alle dargestellten Straßenzeitungen bringen Wohnungslose und ihre Lebensrealität in wesentlich stärkerem Maße in die Öffentlichkeit, als dies in der allgemeinen Presse der Fall ist.
Auf den Forum-Seiten von Hinz & Kunzt berichten einzelne Wohnungslose über ihr Leben, schreiben Grüße und Gesuche. Der Wohnungslooser enthält hauptsächlich Berichte über eigene Aktionen, Kommentare zum Tagesgeschehen. Im TagesSatz gibt es sowohl Erfahrungsberichte als auch Information über (vor allem regionales) politisches Geschehen. Im Dach finden sich Berichte über Aktionen des Tagestreff und sozialpolitische Informationen, das Blatt ist Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit des Tagestreff.
Die Art der Berichterstattung im Bereich Wohnungslosigkeit läßt sich kategorisieren in:
- Personalisierende Berichte, dies sind vor allem Einzelschicksale, Biographien, Erfahrungsberichte.
- Informationen über die Lebenswelt Wohnungsloser, z. B. Vorstellung von Institutionen der Wohnungslosenhilfe, Adressen.
- Hintergrundinformationen, Zahlen, politische Vorgänge in Stadt, Land und Bund.
Im Vergleich zur allgemeinen Presse wird bei Straßenzeitungen eine ungeliebte Realität thematisiert. Kann dies in der Bevölkerung zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit Wohnungslosigkeit führen, bestehende Vorurteile abbauen?
Eine etwaige Wirkung auf die Tagespresse wurde von Nandelstädt und Stoewahse in Berlin untersucht. Anhand von drei Berliner Tageszeitungen wurde geprüft, ob durch die Entstehung der Straßenzeitungen verstärkt Themen der Wohnungslosigkeit aufgegriffen wurden. Diese These konnte nicht bestätigt werden, im Gegenteil, es scheint, daß seit 1993 das Thema Wohnungslosigkeit generell stärker im Bewußtsein der Presse war und so den Boden für den Erfolg von Straßenzeitungen mit bereitet hat[166].
Nichtsdestotrotz haben Straßenzeitungen das Potential zu einer alternativen parteilichen Presse für Wohnungslose (vgl. dazu 5.2.2). Es genügt nicht, durch emotionalisierende Berichte Mitleid zu wecken, selbst wenn dies eine besonders wirkungsvolle Möglichkeit darstellt, LeserInnen anzusprechen[167]. Nicht Mitleid, sondern Interesse soll geweckt werden[168].
Stellt eine Straßenzeitung nicht Wohnungslosigkeit in den Mittelpunkt, bedeutet dies eine Verschwendung der Möglichkeiten des Mediums Zeitung. Diese Anforderung wird von Hinz & Kunzt tendenziell nicht erfüllt. Deren Argumentation, möglichst vielen Wohnungslosen den Verkauf zu ermöglichen, ist insofern ein Trugschluß, als Sraßenverkauf keine weitergehenden Perspektiven eröffnen kann. Ginge es nur um ein zusätzliches Einkommen für Wohnungslose, könnte stattdessen z. B. auch der Verkauf von Sandwiches für Berufstätige oder handgestrickte Pullover organisiert werden. Dies würde eher auf ein "Spendenbeschaffungsprogramm" zur Finanzierung von z. B. Wohnprojekten hinauslaufen.
Der Wohnungslooser scheint im Mittelfeld zu balancieren. Ähnlich wie Das Dach enthalten die mir vorliegenden Ausgaben schwerpunktmäßig "Eigenwerbung", d. h. Berichte über eigene Angebote und Projekte, Wohnungslosigkeit ist das Leitthema. Als alternative Presse kann mit vollem Recht der TagesSatz gelten, der fundierte Informationen ohne Effekthascherei gibt.
4.6.3 Das Image - Konkurrenz oder Zusammenarbeit?
"Stuttgart: Zeitungsfehde um Straßenverkäufer - Marktpionier "Prisant" wirft Neuling "Trott-War" Abwerbung von Mitarbeitern vor - Fusionsplan gescheitert" (WL Ausgabe Mai/Juni 1995)
"... Die Obdachlosenzeitungen gefährden durch einen gnadenlosen Konkurrenzkampf ihre Existenz" (Tagesspiegel, Berlin, 23.05.1995)
Schlagzeilen wie diese zeugen von Absatzproblemen, Streit ums Image und Konkurrenzdenken. Daß eine solche Haltung weder den Straßenzeitungen nützt noch den Wohnungslosen, wurde inzwischen erkannt.
Im Herbst 1995 fand auf Einladung der BAG Wohnungslosenhilfe und der evangelischen Akademie Loccum ein erstes bundesweites Treffen der Straßenzeitungen statt. Über 50 TeilnehmerInnen von 20 Straßenzeitungen folgten der Einladung.
Nach einer gegenseitigen Vorstellung wurden die vielfältigen Probleme der alltäglichen Arbeit diskutiert. Ergebnisse waren[169]
- die verstärkte Kooperation durch Artikelaustausch, auch um aufwendige Recherchen mehrfach zu verwenden
- Aufbau eines Anzeigenverbundes, um mehr Werbekunden anzulocken
- ein Gebietsschutzabkommen, das bestehende Zeitungsmärkte und im Aufbau befindliche Projekte schützt
Es ist zu begrüßen, daß diesem Treffen weitere folgen sollen. Durch Absprachen und Kooperation erhöhen sich die Chancen, sozialpolitischen Forderungen mehr Gewicht zu verleihen.
4.6.4 Zusammenfassung
Mit der Veröffentlichung in fast jeder größeren deutschen Stadt und einer Gesamtauflage von 400.000 Stück im Monat decken Straßenzeitungen das ganze Bundesgebiet ab.
Die Zeitungsinitiativen sind auf unterschiedlichste Weise entstanden und gewachsen und haben alle ihre Existenzberechtigung. Sie sind nicht einheitlich, verfolgen aber gemeinsame Ziele. Ein erster Schritt zu mehr Kooperation wurde durch die Tagung in Loccum bereits getan. Diese Richtung muß weiter verfolgt werden, ohne den pluralistischen Formen abzuschwören.
Darin liegt ihre Chance, unter Ausnutzung ihrer Potentiale zu einer Gegenöffentlichkeit zu werden, die nicht nur den Status Quo erhält/beschreibt, sondern Forderungen an die Politik, insbesondere Wohnungspolitik, stellt.
Sie haben die Chance, Bewußtsein zu schaffen oder verändern, es darf beispielsweise gesellschaftlich nicht mehr akzeptabel sein, Wohnungen leerstehen zu lassen. Diese Eigenschaft der Straßenzeitungen geht über die Hilfe für den einzelnen hinaus.
4.7 Fazit
Den einzelnen wohnungslosen VerkäuferInnen bieten Straßenzeitungen Hilfe zur Selbsthilfe, die der Wiedereingliederung in die Gesellschaft dienen soll. Selbsthilfe im Verständnis der Straßenzeitungen basiert (wie 4.2.2 und andere dargelegt) im wesentlichen auf zwei Säulen:
Erstens bieten Straßenzeitungen ein niedrigschwelliges Arbeitsangebot, dies meint hauptsächlich den Zeitungsverkauf. Damit eingeschlossen ist die materielle Verbesserung, die durch den zusätzlichen Verdienst entsteht. In vielen Städten wird der Zusatzverdienst nicht oder nur teilweise auf die HLU angerechntet (vgl. xxx). An dieser Stelle sei noch einmal auf die Gefahr der Entstehung einer Zwei-Klassen-Gesellschaft innerhalb der Wohnungslosen hingewiesen, einerseits durch finanzielle Vorteile, andererseits durch die öffentliche Anerkennung, die auf das Entgegenkommen von "bürgerlichen" Werten (siehe 4.3.3 Leistungsprinzip) folgen kann.
Die Tätigkeit als ZeitungsverkäuferIn wird regelmäßig als "Einstieg" zur Aufnahme eines festen Arbeitsverhältnisses propagiert.
Wo in den Medien schon von "Arbeitslosigkeit als Massenschicksal" die Rede ist, wird das Ziel, Wohnungslose auf den Weg in reguläre Arbeitsverhältnisse zu schleusen, irreal. Bei der jetzigen höchsten Arbeitslosenzahl seit Bestehen der Bundesrepublik, sind Wohnungslose kaum mehr als letzte Wahl. Daher können Straßenzeitungen den Bedarf an Arbeitsplätzen trotz teilweise angeschlossener Arbeitsprojekte kaum befriedigen. Wohl aber zeigen sie die Notwendigkeit der Schaffung von Arbeitsplätzen speziell für diese Zielgruppe bzw. die Auswirkungen einer hilflosen Arbeitsmarktpolitik auf.
Zweitens wird über mehrere Faktoren eine Stärkung des Selbstwertgefühls des Einzelnen erwartet. Die - noch viel zu seltene - redaktionelle Mitarbeit von Wohnungslosen ermöglicht es, deren Anschauungen in die Öffentlichkeit zu bringen, Beachtung zu finden, die dieser gesellschaftlichen Randgruppe wenig gegeben wird.
Das Arbeitsangebot hilft Wohnungslosen, selbst zu ihrem Lebensunterhalt beizutragen, was zu einem Bewußtsein des Werts der eigenen Arbeitskraft beitragen kann: Es ist nicht mehr notwendig, sich auf Almosen zu verlassen - auch der rechtmäßige Bezug von HLU läßt einige Wohnungslose sich als Bittsteller fühlen.
Gesellschaftlich anerkannt ist bislang nur eine Arbeit die mit Erwerbseinkommen verbunden ist, und nicht, inwiefern sie befriedigend ist. Allerdings könnte eine Bestätigung des Selbstwerts durch eine als sinnvoll erlebte Betätigung, zu einer Verbesserung der Lebenslage Wohnungsloser beitragen.
Solange einer individualisierten Sichtweise statt dem Erkenntnisgewinn von struktureller Verursachung (Arbeitsmarktlage, verfehlte Wohnungspolitik) der Vorzug gegeben wird, können Straßenzeitungen in dieser Hinsicht nicht mehr als eine mittelfristige Zwischenlösung sein.
Über eine individualisierende Sichtweise hinaus kann jedoch die Öffentlichkeitsarbeit wirken, wenn diese nicht ausschließlich durch personalisierende, mitleidheischende Berichte verwirklicht wird. Die auf der Tagung in Loccum eingeschlagene Richtung, die Kräfte der Straßenzeitungen zu bündeln, beinhaltet die Chance, zu einer Gegenöffentlichkeit zu werden. Diese alternative Öffentlichkeit könnte einerseits dem Abbau von Vorurteilen zwischen wohnungsloser und wohnender Bevölkerung dienen und andererseits für Unterstützung langfristiger sozialpolitischer Forderungen werben. Der Spielraum der Straßenzeitungen wird nach diesem Erkenntnisstand noch nicht voll ausgeschöpft.
5. STELLENWERT DER ZEITUNGSINITIATIVEN IN DER WOHNUNGSLOSENHILFE
5.1 Einleitung
An dieser Stelle soll versucht werden, die Bedeutung der Straßenzeitung in und für die Wohnungslosenhilfe darzulegen/zu erörtern. Einer Kurzdarstellung der Methoden und Angebote der Wohnungslosenhilfe folgen Betrachtungen zum Verhältnis der beiden Dienste, basieren auf folgenden Leitfragen:
Welche formales Grundverständnis kann dieses Verhältnis bestimmen? Welche Funktionsbereiche werden (auch) von Straßenzeitungen gedeckt, welche nicht mehr? Wo werden Lücken in der Wohnungslosenhilfe aufgezeigt? In welchen Bereichen benötigen Straßenzeitungen Unterstützung und in welchen kann umgekehrt die professionelle Hilfe von ihnen profitieren?
5.2 Die Grundzüge der Wohnungslosenhilfe
Rechtliche Grundlage ist hauptsächlich §72 BSHG und dessen Verwaltungsverordnung. Darin werden Art und Umfang der möglichen Maßnahmen beschrieben: Diese reichen von Beratung und persönlicher Betreuung (§7 VO zu §72 BSHG), über Hilfen zur Beschaffung und Erhaltung einer Wohnung (§8 VO zu §72 BSHG), Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes (§9 VO zu §72 BSHG), Ausbildung (§10 VO zu §72 BSHG) bis zu Hilfe zur Begegung und zur Gestaltung der Freizeit (§11 VO zu §72 BSHG).
Methodische Ergänzung dazu ist Schuldenregulierung sowie die Vermittlung therapeutischer Hilfen im individuellen Bedarfsfall[170].
Diese Aufgaben werden folgenderweise umgesetzt: "Die Spanne der praktischen Angebote reicht von Streetwork, Teestuben oder Tagesaufenthaltsstätten mit Beratungsangeboten, von Angeboten zum selbstorganisierten Leben und Wohnen über Fachberatungsstellen zur individuellen Wohnungsversorgung und persönlicher Betreuung bis zu teilstationären und stationären arbeits- und sozialtherapeutischen Angeboten."[171]
Die notwendigen Bausteine für aufeinander aufbauende Angebote sind also gegeben, sie erstrecken sich von niedrigschwelliger Streetwork und "Teestuben", d. h. ersten Anlaufstellen bis zu betreuten Wohneinrichtungen.
Somit ist ein breites Spektrum an Hilfeleistungen möglich, die - idealerweise im Rahmen eines Gesamtplanes - auf den einzelnen zugeschnitten werden können. Die strukturellen Bedingungen sind allerdings nicht nur von Bundesland zu Bundesland, sondern auch von Stadt zu Stadt verschieden. Leere Kassen und die bekannte, noch immer übliche Vertreibungspolitik, auf die ich hier nicht näher eingehen werde, bewirken regionale Unterschiede in der Versorgung mit Angeboten.
5.3 Das Verhältnis von Straßenzeitungen und Wohnungslosenhilfe
Straßenzeitungen und die Wohnungslosenhilfe verfolgen teilweise gemeinsame Ziele, so die Maxime, Selbsthilfekräfte unter Wohnungslosen zu aktivieren. Im folgenden wird dargestellt, wo sich Angebote überschneiden bzw. ergänzen. Im Sinne des BSHG wird das formale Verhältnis vom Subsidiaritäsprinzip bestimmt.
5.3.1 Subsidiarität
Historisch gesehen verlangt das Subsidiaritätsprinzip gemäß liberaler Denktradition, daß "Sicherung und Gestaltung der eigenen Existenz vornehmlich dem einzelnen Individuum selbst und seiner Initiative überlassen bleibt. Die Verantwortlichkeit der Gemeinschaft, des Staates, ist dagegen auf Ausnahmesituationen beschränkt und tritt nur ein, wenn die Mittel des Individuums und seiner Familie nicht hinreichen."[172]
Hinter der Neubelebung der Subsidiarität verbergen sich zwei ganz unterschiedliche politische Zielvorstellungen[173]. Aus konservativer Sicht erscheint Selbsthilfe, die meist mit unentgeltlicher ehrenamtlicher Tätigkeit verbunden ist, als eine bequeme und billige Lösung. Wenn das Recht auf sozialstaatliche Leistungen, wie z. B. HLU, nicht in Anspruch genommen wird, entlastet dies die Staatskasse.
Ein weiteres Motiv für die Entstehung von Selbsthilfeinitiativen der verschiedensten Art entstand aus der Kritik sowohl an staatlichen als auch "quasi-staatlichen" (den großen freien Wohlfahrtsträgern) Hilfesystemen, deren bürokratische Struktur zu unflexibel erschien[174]. Dabei bedeutet Selbsthilfe nicht nur quantitative Entlastung der öffentlichen Kosten, sondern wird auch als die qualitativ "humanere" Alternative gesehen, da sie Kompetenzen der jeweils näheren Lebenskreise erhält[175].
Rechtlich verankert ist das Subsidiaritätsprinzip im Sozialgesetzbuch. Der Vorrang freier Träger betrifft hauptsächlich die großen Wohlfahrtsorganisationen wie Caritas, AWO.
Eine Einschränkung öffentlicher Hilfen mit der Begründung, der Betroffene könne sich besser selbst helfen, bewirkt eine neue Zunahme von Not. Selbsthilfe in diesem Sinne bedeutet eine Reprivatisierung sozialer Risiken[176].
Eine konstruktive Grundhaltung im Umgang mit Selbsthilfeiniitativen schlägt Brunn vor: Eine Entwicklung des Sozialstaates, die mehr Formen eigenverantwortlicher Ausgestaltung zuläßt, ohne die soziale Sicherheit in den Grundzügen einzuschränken. "Soziale Strukturen müßten so selbsthilfefreundlicher gemacht werden, ohne Menschen erneut materieller Not auszusetzen." Dies würde eine Stärkung der Eigenverantwortlichkeit voraussetzen, ebenso wie die Finanzierung und Beratung, und professionelle Unterstützung von Selbsthilfeprojekten[177].
Gleichzeitig haben Straßenzeitungen eine gewisse Verantwortung für ihre MitarbeiterInnen/VerkäuferInnen: Es entwickeln sich persönliche Kontakte und Vertrauen, Erwartungen werden geweckt (siehe Kapitel 6).
So sehr private und ehrenamtliche Initiative zu begrüßen ist, sie reicht nicht aus. Der Staat darf nicht aus der Verantwortung entlassen werden. Allerdings kann nicht auf staatliche Intervention gewartet werden; die Notlage ist JETZT da, spürbar. Selbsthilfeinitiativen wie Straßenzeitungen machen darauf aufmerksam.
5.3.2 Selbsthilfe
Zentrale Zielvorstellung sowohl der Wohnungslosenhilfe als auch der Straßenzeitungen ist das Ideal, daß Wohnungslose selbstverantwortlich handeln (können), also die Hilfe zur Selbsthilfe zu fördern. Im Unterschied zur Wohnungslosenhilfe zeichnen sich Straßenzeitungen durch größere Flexibilität aus, beispielsweise ist weniger bürokratischer Aufwand nötig, um Ideen zu verwirklichen. Diese Erfahrung war für den Sozialarbeiter beim Wohnungslooser ein Grund sich zu engagieren., z. B. um vergleichsweise unkompliziert Wohnraum anzumieten.
Mit niedrigschwelligen Angeboten und Öffentlichkeitsarbeit verwirklichen Straßenzeitungen Forderungen aus der Wohnungslosenhilfe. Dennoch kann eine Straßenzeitung für den einzelnen keine langfristigen Perspektiven bieten. Jedoch haben Straßenzeitungen ein aktivierendes Moment (wie in 4.3.4 , 4.4 und 4.4.5 ausgeführt).
Weitere Projekte sind insofern von Bedeutung, als daß deren Finanzierung die Notwendigkeit hoher Verkaufszahlen verschärft. Damit werden die Straßenzeitungen, die auf Verkauf angewiesen sind (also fast alle), noch stärker marktwirtschaftlichen Zwängen unterworfen, um den Fortbestand und den Zusatzverdienst für VerkäuferInnen zu sichern. Diese Notwendigkeiten könnte Straßenzeitungen dazu veranlassen, sich einem weiten Publikumsgeschmack anzubiedern, um ausreichende Verkaufszahlen zu erreichen. Oder - wie wichtig sind Kreuzworträtsel für die Wohnungslosenhilfe? (vgl.dazu auch 4.6.4 und 5.3.2)
Während das Sozialhilferecht Selbsthilfe auf materielle Sicherung bezieht, leisten nach Pankoke leisten öffentliche Sozialdienste Hilfe zur Selbsthilfe. Pankoke meint dies im Sinne der Stabilisierung und Reaktivierung geschwächter primärer Lebenskreise, auch durch Anregung, Förderung, und Begleitung "künstlicher" Kontexte einer Selbstorganisation von Selbsthilfe.[178] Dies könnte auch auf die Unterstützung von Straßenzeitungen bezogen werden.
Da die Erscheinung der Straßenzeitungen in Deutschland noch recht jung ist, ist noch nicht abzusehen, inwiefern deren kontinuirliche Existenz gesichert ist. Eindeutig gesichert ist diese unter den hier vorgestellten Zeitungsinitiativen nur bei dem Dach, im Sinne einer personellen Kontinuität durch die SozialarbeiterInnen der Tagesstätte. Allerdings ist auch noch nicht klar, ob Das Dach Sprachrohr von Wohnungslosen oder der Tagesstätte oder beides wird. Bei ehrenamtlich getragenen Projekten wie dem TagesSatz und dem Wohnungslooser ist die Gefahr gegeben, daß bei einem eventuellen Rückzug von MitarbeiterInnen kein Ersatz gefunden wird.
Für alle Projekte gilt aber, daß die Finanzierung gesichert sein muß, um die Kosten zu decken. Eine Übernahme von Kosten durch Mittel der Wohnungslosenhilfe, z. B. während der Sommerflaute, wäre sinnvoll, um den Fortbestand der Zeitungen zu sichern.
Der festgestellte Übergangscharakter von Straßenzeitungen (4.1.2.1) heißt auch, die durch staatliche oder freie Träger organisierte Wohnungslosenhilfe in die Pflicht zu nehmen.
5.3.3 Niedrigschwelligkeit
Das Arbeitsangebot der Straßenzeitungen ist - beispielsweise im Vergleich zu den Anforderungen bei Arbeitszuweisung durch die Sozialämter - niedrigschwellig. Wohnungslose können selbst entscheiden wie oft und wie lange sie tätig sein möchten. Andererseits gilt es teilweise (Hinz & Kunzt, TagesSatz), die Verkaufsregeln zu beachten, die als "Ausschlußkriterien" wirken könnten.
Das niedrigschwellige Angebot von Straßenzeitungen führt zur Kontaktaufnahme, auch mit Wohnungslosen, die das offizielle Hilfesystem meiden, so die Erfahrung von Hinz & Kunzt (vgl. 3.1.6). Es scheint, daß die Hemmschwelle geringer ist - man kommt ohnehin wegen der Zeitung. Kontakte zu KollegInnen und KäuferInnen könnten den "Begegnungen", wie in §11 VO zu § 72 BSHG gefordert, entsprechen.
Die Vorteile eines niedrigschwelligen, mehr lebensweltorientierten Angebots hat auch die Sozialarbeit erkannt und versucht dies z. B. durch Teestuben oder Streetwork umzusetzen.
Wenn Straßenzeitungen den Zugang zu Kunden eröffnen, könnte die professionelle Wohnungslosenhilfe dies nutzen: Zum Beispiel wie in Hamburg, wo der bei Hinz & Kunzt beschäftigte Sozialarbeiter die Verbindungen aufrechterhalten oder Hilfesuchende weiterleiten kann.
5.3.4 Öffentlichkeitsarbeit
Wie Öffentlichkeitsarbeit, die im Interesse der Wohnungslosen agieren, d. h. parteilich sein will, NICHT sein darf, faßt Henke zusammen:
"Die Inhalte dieser Öffentlichkeitsarbeit unterscheiden sich allerdings von den Bedürfnissen der Medien, die entweder Wohnungslose für ein bißchen Katastrophenstimmung bei uns gebrauchen..., oder sie dazu benutzen, uns die Welt durch ihr Elend versöhnlicher zu machen, dies vornehmlich in der Weihnachtszeit, wenn wir beispielsweise teilhaben dürfen an der Freude arme MitbürgerInnen beim Empfang ihrer Geschenke. Das ist obszön.
Ein nicht so kontinuierliches Bedürfnis der Medien, aber genauso ärgerlich sind die Stories für das Kleinbildungsbürgertum, also die Geschichten von der Freiwilligkeit der wohnungslosen Existenz, vom Mythos des Aussteigers."[179]
Der Vorwurf des "Spendenjournalismus" bei sich selbst tragenden Straßenzeitungen z. B. im Hinblick auf die bewußt positiven Berichte bei Hinz & Kunzt oder Spendenaufrufe zur Unterstützung von Projekten beim Wohnungslooser kann in zweierlei Hinsicht bewertet werden:
Das Helfermotiv von KäuferInnen oder die Leistungsbereitschaft von Wohnunglosen als Teil der Marketingstrategie zu verwenden, könnte so verstanden werden, daß hier nur eine publizistische Lücke gefüllt wurde. Spenden, Werbe- und Verkaufseinnahmen, denkbar wäre zukünftig auch Social Sponsoring, erschlössen lediglich ein weiteres Betätigungsfeld für Sozialarbeiter.
Andererseits ist es gerade die Unabhängigkeit von etablierten Institutionen der Wohnungslosenhilfe, welche es ermöglicht, auch an gewachsenen Strukturen der Sozialpolitik Kritik zu üben. Ein ehrenamtlich mitwirkender Sozialarbeiter des TagesSatz erfuhr größere Handlungsfreiräume als in seiner Funktion als Angestellter im öffentlichen Dienst. Auch auf Werbekunden ist falsche Rücksichtnahme nicht angebracht.
Im Gegensatz dazu hat die Tagesaufenthaltsstätte in Chemnitz erkannt, wie hervorragend sich das Medium Zeitung als Teil der Öffentlichkeit eignet. Gewährleistet werden muß, daß Wohnungslose sich in dieser Zeitung wiederfinden. Sozialarbeiter können aber wichtige übergreifende Informationen beitragen. Aber auch unabhängig von sozialen Institutionen entstandene Straßenzeitungen können die Wohnungslosenhilfe bereichern.
Sicher ist es unmöglich, ein Organ der Öffentlichkeitsarbeit zu schaffen, mit dem sich als legitimer Interessensvertretung alle Wohnungslosen identifizieren können. Wohl aber sollte gewährleistet sein, daß das Angebot, sich zu äußern, jeder und jedem offensteht.
5.3.5 Vernetzung
Als Einstieg in gesellschaftliche Reintegration ist der Zeitungsverkauf geeignet. Hinz & Kunzt sowie der Wohnunglooser versuchen darüberhinaus, weitergehende Möglichkeiten zu eröffnen, sei es durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, Wohnmöglichkeiten oder Beratung. Diese beiden Straßenzeitungen zeichnen sich durch eine relativ hohe Auflage aus, so daß der finanzielle Spielraum auch größer ist.
Straßenzeitungen wie diese, mit ihren ergänzenden Angeboten, stellen eine Subkultur im Hilfesystem dar, die jeweils für die VerkäuferInnen zuständig ist. Bildet sich hier ein "künstliches Netzwerk"?
Wie bereits ausgeführt, können Straßenzeitungen aus finanziellen und personellen Gründen nur begrenzt Hilfe leisten. Umso wichtiger ist eine Vernetzung mit Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Dort gibt es größere Ressourcen, sowohl personell als auch finanziell.
Hier sind z. B. die Arbeitsämter gefragt, die unterstützende Fortbildungen oder sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze speziell für die Gruppe der Wohnungslosen fördern könnten oder Schuldner-, Sucht- und Lebensberatung, um den Beratungsbedarf zu decken.
Neben dem Nutzen von ergänzenden niedrigschwelligen Angeboten, kann die professionelle Wohnungslosenhilfe in noch einem anderen Bereich von den Ideen und der Arbeit der Straßenzeitungen profitieren. Straßenzeitungen dringen vermutlich in weitere Bevölkerungskreise vor, als z. B. der Jahresbericht einer sozialen Einrichtung. Die Publikationen können daher ein Medium sein um eigene Dienste und Angebote vorzustellen und zu bewerben, wie es bei dem Dach der Fall ist.
Somit stellen die neuen Initiativen keine Konkurrenz oder einen Ersatz, sondern eine Bereicherung zu sonstigen Angeboten dar.
5.5 Zusammenfassung
Grundsätzlich sind die Zeitungsinitiativen aus Sicht der Wohnungslosenhilfe begrüßenswert. Sie zeigen Versorgungslücken, nicht nur der niedrigschwelligen Arbeitsangebote, sondern auch der Möglichkeiten zur Begegnung auf. Insgesamt können sie - als überschaubarer Verein oder GmbH - in der Regel flexibler und unbürokratischer reagieren.
Zudem bieten sie das Potential zur alternativen, parteilichen Berichterstattung, einer "Fachzeitung für Wohnungslosigkeit", können somit eine politische Macht darstellen, die auch von Einrichtungen der Wohunungslosenhilfe genutzt werden kann, wenn ein Informationsaustausch gewährleistet ist.
Dabei könnte die Wohnungslosenhilfe regional Angebote koordinieren, ohne die Unabhängigkeit der jeweiligen Zeitung anzutasten. Straßenzeitungen stehen gleichberechtigt neben anderen Initiativen und tragen zur Vielfalt der Angebote bei.
Auch ist die Wohnungslosenhilfe dann in der Pflicht, wenn die Zeitungen ihre Leitstungsgrenze erreicht haben. Beispielsweise erhält die Wohnungslooser-Mannschaft keine Unterstützung für ihr Bauprogramm obwohl Pilotprojekte ähnlicher Art, z. B. Bewohner-Baugenossenschaften (Neues Wohnen Saar) gefördert wurden.[180] Viele kleinere Projekte, die von regionaler Bedeutung sein können, müssen staatlicherseits unterstützt werden. Dies könnte entweder aus Mitteln der Wohnungslosenhilfe oder des Sozial- bzw. Arbeitsamtes erfolgen.
Straßenzeitungen können kritisch oder provokativ sein, sie können Anstöße und Ideen geben, in jedem Fall bringen sie Bewegung in die Wohnungsloordnen. Insbesondere soll dies anhand der folgenden Aspekte erfolgen: Wo können Straßenzeitungen Lücken in der professionellen Wohnungslosenhilfe füllen, wo liegen ihre Chancen, was können sie leisten, wo liegen ihre Grenzen?
Der zweite Schwerpunkt, der im Rahmen dieser Diplomarbeit untersucht wird, ist die Rolle der Sozialarbeit[181] (Kapitel 6). Hier sind vor allem Fragestellungen wie die folgenden von Bedeutung: Welche Einsatzmöglichkeiten und Aufgaben für SozialarbeiterInnen gibt es im Zusammenhang mit eisenhilfe.
Nicht vergessen werden darf, daß Wohnungslosigkeit das einzige gemeinsame Merkmal einer nicht homogenen Gruppe ist und deshalb sowohl verschiedene Sichtweisen haben kann, als auch der Auswahl zwischen verschiedenen Hilfsangeboten bedarf.
6. ROLLE DER SOZIALEN ARBEIT
6.1 Einleitung
Wie im letzten Kapitel ausgeführt, kann die Wohnungslosenhilfe von der Existenz der Straßenzeitungen profitieren. Im folgenden wird umgekehrt dargestellt, welche Rolle SozialarbeiterInnen innerhalb eines Projektes übernehmen können, sowie welchen Service die soziale Arbeit bieten muß, um Straßenzeitungen im Interesse von Wohnungslosen zu unterstützen.
6.2 Mögliche Funktionen von SozialarbeiterInnen innerhalb eines Projekts
Die Formulierung "mögliche Funktionen" weist bereits daraufhin, daß eine Beteiligung von SozialarbeiterInnen nicht unbedingt als selbstverständlich vorausgesetzt/gesehen wird.
Bei den vier vorgestellten Projekten wird die Rolle der mitarbeitenden SozialarbeiterInnen folgendermaßen beschrieben:
Hinz & Kunzt engagierte einen Sozialarbeiter, nachdem sich ein Beratungsbedarf seitens der wohnungslosen VerkäuferInnen offenbarte, der von den RedaktionsmitarbeiterInnen nicht gedeckt werden konnte (siehe 3.1.6). Die Zeitung Das Dach wird vom Chemnitzer Tagestreff für Wohnungslose herausgegeben. Die dortigen SozialarbeiterInnen gehen davon aus, daß es leichter sei, Wohnungslose für ein Projekt zu gewinnen, wenn eine Bezugsperson vorhanden sei (siehe 3.4.6).
Hingegen scheint beim Wohnungslooser vordergründig die spezifischen Leistungen der sozialen Arbeit nicht nötig. Wohl aber vertrat der Sozialarbeiter den Verein nach außen. Auch wird er als "Begleitperson" anerkannt (siehe 3.3.6). Beim TagesSatz wird deutlich formuliert, daß innerhalb der Zeitung keine sozialarbeiterische Arbeit geleistet werden soll (siehe 3.2.6).
Schon an den vier Beispielinitiativen wird deutlich, daß verschiedene Formen der Beteiligung von SozialarbeiterInnen als passend empfunden wurden. Dies liegt möglicherweise an den unterschiedlichen Entstehungsbedingungen: Sowohl Hinz & Kunzt als auch das Dach entstanden auf Initiative von Einrichtungen der Wohnunglosenhilfe (Diakonisches Werk, AWO). Nach zweieinhalbjährigem Bestehen wurde Hinz & Kunzt aus finanziellen Gründen eine gemeinnützige GmbH. Beim TagesSatz entschied man sich von vorneherein, einen Verein zu gründen und sich nicht an eine Enrichtung anzugliedern. Bei dem Wohnungslooser ging die Initiative von Wohnungslosen aus, der Sozialarbeiter schloß sich an.
Ein weiterer Grund für die unterschiedlichen Konzeptionen könnte auch die Größe darstellen: Während TagesSatz, Wohnungslooser, und Das Dach von einem kleinen, überschaubaren Team veröffentlicht werden, arbeiten bei Hinz & Kunzt insgesamt mehrere hundert Menschen. Es wäre vermutlich schwierig, auf ehrenamtlicher Basis, d. h. mit begrenzter Zeit, einige hundert Hilfesuchende zu beraten.
Eine gewisse Grundtendenz der mir vorliegenden Informationen läßt jedoch einen allgemeinen Schluß zu. Ein bei einer Straßenzeitung mitarbeitender Sozialarbeiter darf keine Doppelfunktion von "Arbeitgeber" und "Betreuer" ausüben, nicht zu einer Kontrollinstanz werden. Er sollte nicht Anleiter, sondern Begleiter sein, d. h. als Ansprechpartner zur Verfügung stehen bzw. Hilfen vermitteln. Die Festanstellung eines Sozialarbeiters stellt z. B. Hinz & Kunzt auf eine Stufe mit dem Beratungs- und Hilfesystem der Wohnungslosenhilfe. Für einen Teil der Wohnungslosen ist hier ein Subsystem der Hilfe entstanden. Einerseits könnten Wohnungslose dadurch stärker an das Projekt gebunden werden, was dem Übergangscharakter widerspricht, andererseits könnte dadurch der Weg zur Nutzung höherschwelliger Maßnahmen geebnet werden.
Aufgrund der oben angeführten Angaben bin ich zu der Einschätzung gekommen, daß es letztlich nicht unbedingt notwendig ist, einen Sozialarbeiter zu beschäftigen. Ein partnerschaftlicher Umgang unter Kollegen, ob diese SozialarbeiterInnen sind oder aus anderen Berufen kommen, trägt zu "natürlicheren" Beziehungen bei (vgl. 4.5.1). Allerdings müssen Verbindungen zu Beratungsstellen bestehen, um dem Hilfebedarf zu entsprechen und den Zugang zu Informationen sicherzustellen.
6.3 Vernetzung
Soziale Einrichtungen können Straßenzeitungen in dreifacher Hinsicht unterstützen (vgl. auch 5.3.5):
Materielle Unterstüzung
Soziale Einrichtungen könnten bei der Entstehung von Projekten eine Anschubfinanzierung zu geben und später auch über etwaige Durststrecken ("Sommerloch") hinweghelfen.
Weiter könnten Räumlichkeiten, sowie Telefon oder Fax zur Verfügung gestellt werden.
Auch Ideen und Initiativen, die über die eigentliche Zeitung hinausgehen, müßten aufgegriffen und (mit-)organisiert und finanziert werden.
Persönliche Unterstützung
Dazu zählt die Übernahme von individueller Beratung wohnungsloser MitarbeiterInnen der Straßenzeitung (Lebens-, Sucht-, Schuldnerberatung).
Strukturelle Unterstützung
Dies kann durch die Koordination von Angeboten (Wohnen, Arbeit) und Veranstaltungen geschehen.
Auch könnten gemeinsame "Aktionen" geplant werden. Konkret könnten dies Aktionen wie die "Nacht der Wohnungslosen" oder Stände auf (Stadteil-)Festen sein, um auf Wohnungslosigkeit aufmerksam zu machen und die eigenen Angebote vorzustellen.
Auch Beiträge zur Veröffentlichung wie z. B. Vorstellung der eigenen Arbeit oder aktuelles politisches Geschehen, könnten eingebracht werden.
Alle Formen der Zusammenarbeit erfordern einen regelmäßigen Austausch
6.4 Konformität oder Kritik - vom Selbstverständnis der sozialen Arbeit
Das Ziel der sozialen Arbeit ist, daß Menschen idealerweise unabhängig von institutionalisierter Hilfe leben können[182].
Dabei ist es sinnvoll, zunächst von den Möglichkeiten auszugehen, die zur Verfügung stehen - personell, finanziell und rechtlich, d. h. sozialintegrativ zu wirken, die Hilfe also auf Anpassung und Eingliederung auszurichten[183].
Straßenzeitungen wirken bis jetzt eher systemkonform: sie müssen sich marktwirtschaftlich behaupten. Auf eine mögliche Zweiklassengesellschaft von Wohnungslosen wurde bereits mehrfach hingewiesen, dies könnte einem Sozialabbau den Weg bereiten, mit der Begründung "wer will, der kann", Selbsthilfe genügt.
Soziale Arbeit übte dann aber nicht mehr als eine Alibi-Funktion aus, die den gesellschaftlichen Status Quo stabilisiert. Es müssen langfristige Perspektiven entwickelt werden, d. h., soziale Arbeit muß sich einmischen, auch über ihre Grenzen der Zuständigkeit hinaus. Dabei könnten Straßenzeitungen für diese übergreifende Eimischung genutzt werden, indem sie konzentrierte Forderungen stellen, systemkritisch werden.
6.5 Zusammenfassung
Wo die Beteiligung von SozialarbeiterInnen innerhalb eines Zeitungsprojektes erwünscht wird, sollten diese die Funktion eines/einer AnsprechpartnerIn übernehmen.
Erscheint die unmittelbare Mitwirkung von SozialarbeiterInnen nicht notwendig, sollten Kontakte zwischen Straßenzeitung und Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe bestehen, um hilfesuchende wohnungslose MitarbeiterInnen betreuen zu können.
Weiter sollten Einrichtungen der sozialen Arbeit nach ihren Möglichkeiten materielle und strukturelle (z. B. Koordination von Angeboten) Unterstützung bieten. Dafür reicht es nicht, sich mit dem Vorhandenen zu bescheiden, vielmehr müssen Forderungen an die Politik gestellt werden, beispielsweise, um Ressourcen effektiver einzusetzen und sich auch kritisch mit dem eigenen Hilfesystem auseinandersetzen.
7. RESÜMÉE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN
7.1. Von, für oder über Wohnungslose?
Um an den Titel dieser Diplomarbeit anzuknüpfen, wird hier die Frage beantwortet, welchen Anforderungen eine Straßenzeitung genügen muß, um als Wohnungslosenzeitung zu gelten.
7.2. Beteiligung von Wohnungslosen
Wohnungslose müssen auf allen Ebenen vertreten sein, d. h. nicht nur den Verkauf übernehmen, sondern auch in Redaktion und Geschäftsführung vertreten sein. Wo dies nicht der Fall ist, sollte darauf hingewirkt werden, Wohnungslose zu befähigen. Ansonsten sollte der Umgang zwischen Wohnungslosen und Wohnenden partnerschaftlich sein. Hierarchische Beziehungen von "Betreuer" und "Klient" finden sich anderswo genug.
Auch sollten Erfahrungsberichte von Wohnungslosen nicht nur eine Randerscheinung der Berichterstattung sein. Wo die verbalen Ausdrucksmittel fehlen, kann diese Aufgabe auch im Team gelöst werden.
7.3. Nutzen für Wohnungslose
Die Beteiligung Wohnungsloser bringt diesen persönlichen und finaziellen Nutzen. Dabei wäre es der Motivation abträglich, wenn Einküfte voll auf die HLU angerechnet würden. Dennoch ist es wichtig, keine unerfüllbaren Erwartungen zu wecken, wie z. B. einen fast automatischen Übergang in eine eigene Wohnung und ein festes Arbeitsverhältnis.
7.4. Berichte über Wohnungslose
Hier sind Berichte über Wohnungslose und Wohnungslosigkeit gemeint, die Wohnungslose nicht mitleidheischend instrumentalisieren, sondern die authentische und realistische Informationen über Lebensbedingungen bieten. So kann zu Aufklärung in der Bevökerung beigetragen und Solidarität geweckt werden.
Diese Leitprinzipien treffen bei den hier vorgestellten Straßenzeitungen nur bedingt zu. In Hinz & Kunzt erfährt man wenig über Wohnungslose und ihre Lebenswelt. Auch wird die redaktionelle Beteiligung Wohnungsloser zugunsten eines Stadtmagazins mit hoher Auflage zurückgestellt. Da die vergleichsweise rare Beteiligung Wohnungsloser inzwischen als Manko anerkannt wurde, bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.
Da der Wohnungslooser von (jetzt ehemaligen) Wohnungslosen gegründet wurde, dominieren hier keine "Professionellen". Allerdings beläßt der Wohnungslooser eine etwaige Regelung mit dem Sozialamt stillschweigend den einzelnen ZeitungsverkäuferInnen.
Auch der TagesSatz scheint fast alle von mir aufgestellten Kriterien zu erfüllen, jedoch fehlen Wohnungslose im Vereinsvorstand.
Das Dach zum jetzigen Zeitpunkt zu bewerten fällt schwer, anzumerken ist, daß in der einzigen "neuen" Ausgabe keine Berichte von Wohnungslosen vertreten waren.
Diese gewachsenen Strukturen sind zu respektieren. Die regionalen Gegebenheiten und Anforderungen sind unterschiedlich und müssen berücksichtigt werden. Es ist daher nicht möglich, ein allgemeingültiges Konzept zu entwickeln.
Anregungen und Kritik dienen aber der Weiterentwicklung der Identität dieser Projekte.
Einrichungen der Wohnungslosenhilfe sind gefordert aufzugreifen, was bereits vorhanden ist und materielle und personelle Unterstützung zur Weiterentwicklung zu geben. Sinnvoll wäre eine koordinierende Stelle oder regelmäßige Treffen zum Austausch zwischen Straßenzeitung und MitarbeiterInnen der Wohnungslosenhilfe.
Unabhängig davon, ob eine Zeitung an eine soziale Einrichtung angeschlossen ist, sie bietet die Möglichkeit, auf mehreren Ebenen zu arbeiten. Kurzfristig verschafft sie Wohnungslosen ein Einkommen, langfristig können sie Sprachrohr Wohnungsloser und wirksames Mittel der Öffentlichkeitsarbeit durch Aufklärung sein.
7.5. Unterschiede zulassen
Damit sind Straßenzeitungen nicht nur eine Bereicherung des Blätterwaldes, sie haben darüberhinaus die Chance, eine politische Lobby für Wohnungslose zu schaffen. Straßenzeitungen - eine Fachzeitung für Wohnungslosigkeit.
Wie läßt sich gewährleisten, daß der Spagat zwischen wirtschaftlichen und sozialen Anliegen nicht zu Lasten der Wohnungslosen geht? Wirtschaftliche Unabhängigkeit, auch durch Werbeeinnahmen und Spenden, wird diese Freiheit genutzt?
Sie wirken mit ihrer Ausrichtung auf das Individuum bis jetzt eher systemkonform und gesellschaftlich stabilisierend, sie wirken nicht auf Änderung der Bedingungen (TEILWEISE)
8. Anhang
I. LITERATUR
- Asanger, Roland/Wenninger, Gerd (Hrsg.): "Handwörterbuch der Psychologie", Weinheim 1992
- Bauer, Martina: "Hinzt & Kunzt vermietet Appartements - Straßenzeitungen im Ruhrgebiet und Kassel" in "Gefährdetenhilfe" 4/94
- Baur, Fritz/Lippert, Johannes: "Zukunft und Sicherung der Hilfe für Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten" in "Gefährdetenhilfe" 1/94
- Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit: "Wirkungsweise und Wirksamkeit von zentralen Beratungsstellen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten", Stuttgart 1984
- Braun, Wolfgang: "Hinz & Kunzt - Obdachlosenhilfe zwischen Sinnstiftung und Vermarktung" in "Gefährdetenhilfe" 1/95
- Brunn, Anke: "Kurzdiskussion: Selbsthilfe im Spannungsfeld zwischen Sozialabbau und Selbstbestimmung" in "Neue Praxis" 4/94
- Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V.: Pressespiegel, September 1995
- Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V.: "Weibliche Wohnungsnot", Bielefeld 1995
- Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V.: "Zahl der Wohnungslosen", Bielefeld 1995
- Bundessozialhilfegesetz, München 1995: Bundessozialhilfegesetz: Lehr- und Praxiskommentar, 4. Auflage, Baden-Baden 1994
- Chassé, Karl August/Preußer, Norbert/Wittich, Wolfgang: "Wohnhaft: Armut und Obdachlosigkeit; Analysen - Modelle - Perspektiven", München 1988
- Dammann-Zeidler, Marlies: "Ohne festen Wohnsitz - Zur Lebenssituation wohnungsloser Menschen - Eine Auseinandersetzung mit dieser Personengruppe und ihrem Hilfesystem am Beispiel Darmstadt", Diplomarbeit an der FHD, FB Sozialpädagogik 1994
- Deutscher Verein für Öffentliche und Private Fürsorge: "Fachlexikon der sozialen Arbeit", Frankfurt/M 1993
- Greiff, Rainer/Schuler-Wallner, Gisela (Hrsg.): "Mehr als ein Dach über dem Kopf", Weinheim und München 1990
- Heins, Rüdiger: "Obdachlosenreport", Düsseldorf 1993
- Henke, Martin: "Wem wie was sagen? - Anmerkungen zur Öffentlichkeitsarbeit der Wohnungslosenhilfe" in "Gefährdetenhilfe" 3/91
- Herrmann, Hubert/Leist, Hans-Peter/Lindemann, Vera: "Sozialarbeit mit Obdachlosen", München 1981
- Hinz & Kunzt: Faltblatt: "Das Hamburger Straßenmagazin - Hilfe zur Selbsthilfe für Hamburgs Obdachlose", Hamburg ?
- Hinz & Kunzt: Faltblatt: "Hinz & Kunzt Wohnungspool - Ab in die eigene Wohnung", Hamburg, ?
- Hinz & Kunzt: Konzept Wohnungspool, Hamburg 199?
- Hinz & Kunzt: Selbstdarstellung, Hamburg 1994
- Hinz & Kunzt: Verkäuferregeln
- Hinz & Kunzt: "Wer liest Hinz&Kunzt? - Eine Leserschafts-Analyse" Hamburg 1995
- Hubert, Astrid: "Sponsoring (II): Spenden bevorzugt" in "Social Management" 1/94
- John, Wolfgang: "... ohne festen Wohnsitz...", Bielefeld 1988
- Klein, Uta: "Gefangenenpresse - Ihre Entstehung und Entwicklung in Deutschland", Bonn 1992
- Knuf, Thomas: "Obdachlosenzeitungen - Mobilisierungsfaktor der Betroffenen oder publizistische Marktnische?", Diplomarbeit am FB Politische Wissenschaften der Freien Universität Berlin, Berlin 1995
- Kutsch, Thomas/Wiswede, Günter (Hrsg.): "Arbeitslosigkeit II - Psychosoziale Belastungen", Königstein/Taunus 1978
- Kreft, Dieter: "Bauen und Wohnen als Aufgabenfeld sozialer Arbeit" in "Neue Praxis" 1/85
- Marciniak, Karl-Heinz: "Neue private Hilfe" in: "Wohnungslos" 3/95
- Marciniak, Karl-Heinz: "Parteilich für Obdachlose - Aufsätze und Beiträge zur Obdachlosenhilfe 1968-1992", Bielefeld 1993
- Milz, Helga: "Neues von der neuen Armut" in "Social Management" 6/94
- Müller, Andrea/Orban, Martina: "Hinz & Kunzt - Obdachlosenhilfe zwischen Sinnstiftung und Vermarktung", Hamburg 1995
- Müller, C. Wolfgang (Hrsg.): "SelbstHilfe - Ein einführendes Lesebuch", Weinheim - Basel 1993
- Nandelstädt, Katrin/Stoewahse: "Obdachlose schwarz auf bunt - über die Berliner Obdachlosenzeitungen Haz, Mob und Platte und ihre Einordnung in die Tradition der alternativen Medien.
- Neue Wirtschafts-Briefe-Redaktion: "Wichtige Steuergesetze", Herne-Berlin 1989
- Olk, Thomas: "Wohlfahrtsverbände und Selbsthilfe - Konfrontation oder Vereinnahmung?" in: Reihe Brennpunkte sozialer Arbeit "Soziale Arbeit und Wohlfahrtsverbände - Hilfe mit beschränkter Haftung", Frankfurt/Main 1987
- Rosenke, Werena: "Straßenzeitungen - Dauerbrenner oder Strohfeuer" in "Gefährdetenhilfe" 2/94
- Rosenke, Werena: "`Bunte Blätter: die bundesdeutschen Straßenzeitungen haben sich etabliert" in: "wohnungslos" 4/95
- Schellhorn, Walter/Jirasek, Hans/Seipp, Dr. Paul: "Das Bundessozialhilfegesetz - Ein Kommentar für Ausbildung, Praxis und Wissenschaft" Neuwied 1988
- Schneider, Stefan: "Thesen zu den Wohnungslosenzeitungen" Berlin, 12.10.1994 (unveröffentlicht)
- Schworck, Andreas: "Obdachlosigkeit in Deutschland - Vom Elend des Sozialstaats" in "Die neue Gesellschaft", Frankfurter Hefte 6/92
- Selbsthilfeförderverein Arbeit und Wohnen e. V.: Selbstdarstellung, Michelstadt 1995
- Statistisches Bundesamt: "Statistik der Sozialhilfe - Teil II Nachweis der Empfänger von Sozialhilfe 1993", Wiesbaden 1995
- Stroh, Britta: unveröffentliches Interview vom 01.02.1996 mit Werner Picker/Vorstandsvorsitzender des Selbsthilfeförderverein Arbeit und Wohnen, Darmstadt 1996
- Stroh, Britta: unveröffentliches Interview vom 08.02.1996 mit Joachim Hintereiter/Mitglied und Sozialarbeiter des Selbsthilfeförderverein Arbeit und Wohnen, Michelstadt 1996
- Stroh, Britta: unveröffentliches Interview vom 08.02.1996 mit Hans Klunkelfuß/Chefredakteur der Wohnungslosen-Zeitung "Wohnungslooser", Michelstadt 1996
- Tagessatz: Selbstdarstellung
- Tagessatz: Verkaufsregeln
- Tagessatz: Vertriebsrichtlinien
- Tagessatz bzw. Verein zur Förderung der Integration sozial und kulturell benachteiligter Menschen: Vereinssatzung
- Tiebel, Christoph: "Sponsoring (I): Professionalität dringend erwünscht" in "Social Management" 1/94
- Wacker, Ali: "Vom Schock zum Fatalismus? - Soziale und Psychische Auswirkungen der Arbeitslosigkeit", Frankfurt/Main 1981
Tageszeitungen:
- Der Tagesspiegel/Berlin vom 23.05.95: "Ich verkaufe die neueste Ausgabe der... - die Obdachlosenzeitungen gefährden duch einen gnadenlosen Konkurrenzkampf ihre Existenz"
- Darmstädter Echo/Darmstadt vom 08.02.1996: "Minus zehn Grad und kein Dach überm Kopf"
- Darmstädter Echo/Darmstadt vom 07.03.1996: "Ein Leben an der Armutsgrenze"
- Darmstädter Echo/Darmstadt von Ostern 1996: "Paula und der Obdachlose - Leser reagierten mit Hilfsangeboten auf zwei Zeitungsartikel"
II. VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN
- ABM - Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
- AO - Abgabenordnung
- AWO - Arbeiterwohlfahrt
- BAG Wohnungslosenhilfe - Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe
- BSGH - Bundessozialhifegesetzt
- DE - Darmstädter Echo
- HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt
- VO - Verwaltungsverordnung
- WL - Wohnungslooser
III. INHALTSANALYSE DER ZEITUNGSINITIATIVEN (Fehlt hier)
ANMERKUNG ZU DEN FOLGENDEN TABELLEN:
Die Inhalte der fünf bzw. sechs Exemplare der jeweiligen Zeitung wurden nach einem Raster geordnet. Ungenauigkeiten der Zahlen entstanden durch teilweise leere Seiten, Auf- bzw. Abrundung und die Auslassung von Titel- und/oder Rückseite, sofern sich dort ein Foto oder eine Zeichnung befand. Diese Raster halfen, Tendenzen der Berichterstattung zu erkennen.
IV. FRAGEBOGEN
Entstehung der Zeitung
Von wem ging die Initiative zu der Zeitung aus?
Konzept
Wer ist an der Zeitung beteiligt? Hauptberuflich, ehrenamtlich? Aus welchen Berufen?
Ist eine SozialarbeiterIn beteiligt? Welche Aufgabe/Rolle hat er/sie?
Falls nicht, wäre eine SozialarbeiterIn erwünscht? Für welchen Aufgabenbereich?
Welchen Zielen soll die Zeitung dienen?
- für die Verkäufer (z. B. Zusatzverdienst, Selbstbewußtsein)
- für die Macher (z. B. Arbeitsplätze schaffen)
- für die Gesamtheit der Wohnungslosen (z. B. Öffentlichkeitsarbeit)
Werden diese Ziele erreicht?
Welches Selbstverständnis hat die Zeitung? Kulturblatt, Stadtmagazin, Sprachrohr ...
Gibt es noch andere Protjekte, aus denen die Zeitung entstanden ist bzw. sind aus der Zeitung weiterführende Projekte entstanden?
Wie wird die Zeitung finanziert? Zu welchen Anteilen?
- trägt sich selbst
- durch Träger finanziert
- Spenden
- Anzeigen
Werden Einnahmen aus dem Verkauf auf die Sozialhilfe angerechnet oder wurde eine Ausnahmereglung durch das Bundesland gewährt?
Inhalte
- Wen soll die Zeitung ansprechen? Warum?
- Mit welchen Themen beschäftigt sich die Zeitung?
- Welche Schwerpunkte werden gesetzt?
Vertrieb
Wie hoch ist die Auflage?
Wie ist der Vertrieb organisiert?
- Verkäufer (wieviele, Frauenanteil)
- Kontaktstellen
- Abos
- anderes
Gibt es Verkaufsregeln?
Zusammenarbeit/Kontakte mit Sozialarbeitern
Gibt es eine Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen/Institutionen? Falls ja, mit welchen und wie sieht sie aus?
Wo sind im Zusammenhang mit der Zeitung Sozialarbeiter nötig oder überflüssig?
Anmerkungen
[1] ANMERKUNG: Sozialarbeit und Sozialpädagogik werden im heutigen Sprachgebrauch zunehmend gleichgesetzt, leiten sich aber aus grundsätzlich anderen Ansätzen ab. Die Sozialarbeit kommt aus der Tradition von "Almosenwesen, Armenpflege, Wohlfahrtspflege und Fürsorge" und ist eher auf "soziale Sicherung" gerichtet. Sozialpädagogik ist an die Erziehungswissenschaften angelehnt; ihr Ziel ist vorrangig Bildung (vgl. Deutscher Verein für Öffentliche und Soziale Fürsorge, S. 956ff). Da die Wohnungslosenhilfe traditionell der Sozialarbeit zugeordnet ist, wird der Bezeichnung "SozialarbeiterIn" der Vorzug vor "SozialpädagogIn" gegeben.
[2] vgl. Rosenke: "Bunte Blätter...", S. 154
[3] BAG Wohnungslosenhilfe Adressenliste
[4] Rosenke: "Bunte Blätter...", S. 155
[5] BAG Wohnungslosenhilfe Tagungsbericht
[6] Rosenke: "Bunte Blätter...", S. 154
[7] ANMERKUNG: Die Untersuchung der Inhalte (in 3.1.5 sowie 3.2.5 und 3.3.5) wurde an 5 bzw. 6 Ausgaben der jeweiligen Zeitung durchgeführt. Dazu wurden Berichte (einschließlich zugehöriger Fotos, Zeichnungen etc.) einem Raster zugeteilt. Die vollständigen Tabellen finden sich im Anhang unter Nr. III. Für "Das Dach" war eine solche Analyse nicht möglich, da bisher nur eine Ausgabe veröffentlicht wurde.
[8] Müller/Orban, S. 11
[9] ANMERKUNG: Nach §52 AO verfolgt eine Körperschaft dann gemeinnützige Ziele, "wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern."
[10] Broschüre "Was ist Hinz & Kunzt?"
[11] Hinz & Kunzt Selbstdarstellung
[12] Broschüre "Was ist Hinz & Kunzt?"
[13] Fragebogen Hinz & Kunzt
[14] ebenda
[15] Broschüre "Was ist Hinz & Kunzt?"
[16] Hinz & Kunzt Selbstdarstellung
[17] Broschüre "Was ist Hinz & Kunzt?"
[18] Fragebogen Hinz & Kunzt
[19] Hinz & Kunzt Selbstdarstellung
[20] Broschüre "Was ist Hinz & Kunzt?"
[21] Müller/Orban, S. 20 Zitat Banek, Hinz & Kunzt Redaktion 1994
[22] Müller/Orban, S. 22 Zitat Jensen, Hinz & Kunzt Redaktion 1994
[23] Hinz & Kunzt Selbstdarstellung
[24] Müller/Orban, S. 19f
[25] Hinz & Kunzt Selbstdarstellung
[26] Müller/Orban, S. 19 Interview mit B. Müller-Claasen und M. Jensen, Hinz & Kunzt - Redaktion 1984
[27] Broschüre "Was ist Hinz & Kunzt?"
[28] Fragebogen Hinz & Kunzt
[29] Hinz & Kunzt Selbstdarstellung
[30] Fragebogen Hinz & Kunzt
[31] ebenda
[32] Hinz & Kunzt Verkäuferregeln
[33] ebenda
[34] Hinz & Kunzt Selbstdarstellung
[35] Fragebogen Hinz & Kunzt
[36] ebenda
[37] Müller/Orban, S. 24 Zitat Jensen
[38] vgl. Müller/Orban, S. 24
[39] Fragebogen Hinz & Kunzt
[40] ebenda
[41] ebenda
[42] ebenda
[43] TagesSatz Selbstdarstellung
[44] ebenda
[45] ebenda
[46] TagesSatz Vereinssatzung
[47] ebenda
[48] ANMERKUNG: Nach § 53 AO verfolgt eine Körperschaft mildtätige Zwecke, "wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, Personen selbstlos zu unterstützen, 1. die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder 2. deren Bezüge nicht höher sind als das Vierfache des Regelsatzes der Sozialhilfe im Sinne des § 22 des Bundessozialhilfegesetzes..."
[49] TagesSatz Selbstdarstellung
[50] vgl. TagesSatz Selbstdarstellung
[51] ebenda
[52] ebenda
[53] TagesSatz Selbstdarstellung
[54] vgl. ebenda
[55] TagesSatz Vertriebsrichtlinien
[56] ebenda
[57] eigene Gesprächsnotiz
[58] eigene Gesprächsnotiz, Zitat A. Mertel-Winter
[59] ANMERKUNG Unter "BürgerInnen in sozialen Schwierigkeiten" werden hier Menschen verstanden, die aus den unterschiedlichsten Gründen am Rande, z. B. unterhalb der Armutsgrenze leben, wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. In diesem Sinne wird der Ausdruck auch im weiteren Text verwendet.
[60] TagesSatz Verkaufsrichtlinien
[61] eigene Gesprächsnotiz, Interview A. Mentel-Winter
[62] ebenda
[63] Interview W. Picker, S. 1
[64] ANMERKUNG: Gemeinnützigkeit heißt nach §52 AO, die Tätigkeit ist darauf gerichtet, "die Allgemeinheit auf materiellem, geistigen oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern."
[65] Interview H. Klunkelfuß, S. 5
[66] ebenda, S. 1 und 2
[67] ebenda, S. 2
[68] ebenda, S. 2
[69] ebenda, S. 1
[70] ebenda, S 1
[71] ebenda, S. 6
[72] vgl. Interview W. Picker, S. 3
[73] Interview H. Klunkelfuß, S. 3
[74] Interview W. Picker, S. 3
[75] ebenda, S. 2
[76] Interview H. Klunkelfuß, S. 4
[77] ebenda, S. 4
[78] Interview W. Picker, S. 2
[79] Interview H. Klunkelfuß, S. 5
[80] Interview W. Picker, S. 2
[81] ebenda, S. 2 und 3
[82] Interview H. Klunkelfuß, S. 6
[83] ebenda, S. 8
[84] ebenda, S. 4
[85] Interview W. Picker, S. 5
[86] ebenda, S. 5
[87] ebenda, S. 4 und 5
[88] ebenda, S. 6
[89] ebenda, S. 5
[90] Interview W. Picker, S. 2
[91] Interview W. Picker, S. 2
[92] ANMERKUNG: Die "Lobby für Wohnsitzlose und Arme e. V." ist eine "Solidargemeinschaft von besserverdienenden und ärmeren Bürgern. Eine bundesweite Organisation, die parteipolitisch unahängig arbeitet gegen soziale Ausgrenzung und für Solidarität statt Mitleid....Lobby wurde 1990 in Frankfurt am Main gegründet...Ziel ist die Aufklärung und Bewußtseinsbildung der Bevölkerung über Ursachen und Folgen von Armut. Lobby leistet jekoch auch unmittelbare Hilfe mit ihren LobbyRestaurants, dem LobbyCatering, der Frankfurter LobbyTafel, mit Beratungen und Informationsveranstaltungen." Der Lobby-Verein brachte in Frankfurt selbst eine Straßenzeitung heraus, die sich aber nicht durchsetzen konnte. Quelle: WL 3/96
[93] Interview W. Picker, S. 1
[94] vgl. Interview J. Hinterreiter, S. 5
[95] Interview W. Picker, S. 1
[96] vgl. ebenda, S. 2
[97] Interview J. Hinterreiter, S. 2
[98] vgl. Interview W. Picker, S. 7
[99] ebenda, S. 7
[100] vgl. ebenda, S. 6
[101] Fragebogen Das Dach
[102] Das Dach 1/96
[103] Fragebogen Das Dach
[104] Das Dach 1/96
[105] ebenda
[106] ebenda
[107] Fragebogen Das Dach
[108] ebenda
[109] ebenda
[110] Fragebogen Das Dach
[111] ebenda
[112] Fragebogen Das Dach
[113] vgl. Rosenke: "Bunte Blätter...", S. 157
[114] vgl. für den gesamten Absatz Pankoke in: Fachlexikon der sozialen Arbeit, S.818ff
[115] vgl. für den gesamten Absatz ebenda
[116] Müller, C. W., S. 11
[117] vgl. Schneider
[118] Olk, S. 90
[119] ANMERKUNG: Olk (S. 90ff) charakterisiert Fremdhilfezusammenschlüsse als Projekte, in denen "Bürger auf freiwilliger und gemeinwohlorientierter Basis tätig [werden, d. Verf.], um bedürftigen Bevölkerungsgruppen Hilfeleistungen zu bieten." Dabei ist bei den Straßenzeitungen der Wohnungslooser eine Selbsthilfeinitiative, der sich auch Nicht-Betroffene angeschlossen haben; Hinz & Kunzt wird nicht von Ehrenamtlichen, sondern festangestellten Zeitungsprofis und einem Sozialarbeiter geleitet, bzw. begleitet.
[120] vgl. Rosenke: "Bunte Blätter...", S. 157
[121] Broschüre "Was ist Hinz & Kunzt?"
[122] ebenda
[123] WL 1/96
[124] vgl. Interview W. Picker, S. 5 und 6
[125] TagesSatz Vertriebsrichtlinien
[126] Fragebogen Das Dach
[127] Hinz & Kunzt Selbstdarstellung
[128] ANMERKUNG Unter den VerkäuferInnen sind beim TagesSatz 15% Frauen, bei Hinz & Kunzt 2,5%, bei dem Dach zwei von sechs, beim Wohnungslooser eine von etwa 50. Der Frauenanteil unter den Wohnungslosen liegt dagegen aber bei etwa 29% (ohne wohnungslose Aussiedlerinnen) bzw. bei den 30.-35.000 Menschen die ohne jede Unterkunft auf der Straße leben, bei ca. 10% (Schätzung BAG Wohnungslosenhilfe).
[129] vgl. für den gesamten Absatz Rosenke: "Bunte Blätter...", S. 157
[130] Olk, S. 92
[131] Müller/Orban, S. 38
[132] ANMERKUNG: Nach der Untersuchung von John (S. 431ff), in der 105 männliche Wohnungslose befragt wurden, haben 44,7% eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ob gelernt oder ungelernt, Wohnunglose sind danach im Vergleich zur männlichen erwerbstätigen Bevölkerung in den Branchen Landwirtschaft, Bau und Lagerarbeit deutlich überrepräsentiert.
[133] vgl. Girtler in: John, S. 54f
[134] vgl. BMJFG, S. 261f
[135] ANMERKUNG: "Zusätzliche" Arbeit ist solche, "die sonst nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden würde" - §19,2 BSHG
[136] Henke/Rohrmann in: Chassé/Preußer/Wittich, S. 215
[137] vgl. BMJFG, S. 261f
[138] Ruth Kruse, Psychotherapeutin in Aachen, hr3 Interview am 11/04/96
[139] ANMERKUNG: Dies folgt prinzipiell der Maxime von F. von Bodelschwingh, der Ende des 19. Jahrhunderts Arbeiterkolonien unter der Maxime "Arbeit statt Almosen" gründete. Hilfe wurde nur noch als Gegenleistung zu erbrachter Arbeit gegeben. Zwar wurde Arbeitslosigkeit als Ursache von Armut erkannt, jedoch war nicht die Überwindung der Arbeitslosigkeit das Ziel, sondern die Ruhigstellung und Sicherung des Existenzminimums zu schlechteren Konditionen als jeder Arbeiter, vgl. Henke/Rohrmann in: ChassÈ/Preußer/Wittich, S.218f.
[140] EXKURS - MOTIVATIONEN ZUM KAUF EINER STRASSENZEITUNG
So wie es generell kaum wissenschaftliche Arbeiten über Straßenzeitungen gibt, wurde erst recht keine extensive KäuferInnenbefragung durchgeführt. Einzelne Anhaltspunkte gibt es aber durch eine Leseranalyse, sowie die Ergebnisse von VerkäuferInnenbefragungen in 2 Diplomarbeiten, bei denen die VerkäuferInnen Kaufgründe einschätzten.
Keine dieser Quellen kann Repräsentativität für sich in Anspruch nehmen; allerdings können die Aussagen qualitativer Art bewertet werden.
Für Hinz & Kunzt führte eine Werbeagentur im Juni 1995 kostenlos eine Leserschaftsanalyse durch. Von 15.000 Fragebögen kamen 1.132 zurück, dies entspricht einem Rücklauf von 7,5%. Auf die Frage "Warum lesen Sie Hinz & Kunzt?" antworteten 16% mit "um das Projekt zu unterstützen", 1% nutzte Hinz & Kunzt als Zeitung, für 82% waren beide Gründe ausschlaggebend.
In der Studienarbeit von Nandelstädt und Stoewahse zum Thema "Einordnung von Obdachlosenzeitungen in die Tradition der alternativen Medien" wurden 10 Verkäufer von 3 Berliner Straßenzeitungen befragt. 6 von 10 Verkäufern meinten, die Zeitung werde gekauft, um dem Verkäufer zu helfen, einer gab an, Kaufgrund sei die Qualität des Produkts. In ihrer Diplomarbeit über Hinz & Kunzt interviewte Martina Orban 9 Verkäufer. Deren Einschätzung zufolge werde das Magazin gekauft, um Wohnungslose zu unterstützen. Die Käufer interessierten sich für das Thema Wohnungslosigkeit und wollten helfen. Gleichzeitig wollten sie aber kein Almosen geben, sondern etwas für ihr Geld bekommen. Ein Verkäufer bezeichnete seine Kunden als "sensationslustig", das Interesse gelte den "ungewöhnlichen Lebensgeschichten. (Müller/Orban, S.34)
[141] Interview W. Picker, S. 5 und 6
[142] Müller/Orban, S. 42
[143] Henke/Rohrmann in: Chassé/Preußer/Wittich, S. 216
[144] ebenda, S. 228
[145] John, S. 431ff
[146] John, S. 440ff
[147] BMJFG, S. 261
[148] Nandelstädt/Stoewahse, S. 72
[149] vgl. Schellhorn/Jirasek/Seipp, Rz. 8 zu §1
[150] ebenda, Rz. 31 zu §11
[151] ANMERKUNG: Nach Schellhorn/Jirasek/Seipp, Rz.4 zu §15 BSHG ist eine "Kann-Leistung" eine Leistung, auf deren Übernahme der Hilfesuchende keinen Anspruch hat, der Sozialhilfeträger entscheidet nach pflichtmäßigem Ermessen.
[152] Asanger/Wenninger, S. 680ff
[153] ebenda
[154] John, S. 88ff
[155] ANMERKUNG: Sozialkontakte "unmittelbar vor der ersten Wohnungslosigkeit" nach John, S. 441ff. Kontakt zur Mutter hatten 19,2%; von den übrigen hatten 51% keinen Kontakt aus Gründen, die nicht beeinflußt werden konnten (Tod, unbekannt usw.); 29,8% brachen den Kontakt wegen Konflikten (Streit, Gewalttätigkeiten, räumliche Enge, Alkoholkonflikte beiderseits) oder sonstigen Gründen (z. B. Anschrift unbekannt) ab. Zum Vater hatten 11,7% Kontakt; 67% hatten keinen (Tod, unbekannt usw.); wegen Konflikten und sonstigen Gründen beendeten 21% den Kontakt.
[156] John, S. 441ff
[157] John, S. 94
[158] vgl. Marciniak: "Parteilich für Obdachlose...", S. 49
[159] vgl. BMJFG, S. 87f
[160] Wickert in: BMJFG, S. 89
[161] Girtler in: John: S. 90f
[162] John, S. 91
[163] WL 1/96
[164] WL 3/96 Titel
[165] Ruth Kruse, Psychotherapeutin in Aachen, hr3 Interview am 11/04/96
[166] Nandelstädt/Stoewahse, S. 67f
[167] ANMERKUNG: Ein aktuelles Beispiel dazu sind die Reaktionen von LeserInnen des Darmstädter Echo. Zwei Artikel im Februar und März 1996 über eine/n wohnungslosen Frau bzw. Mann, in denen ihre Lebenswege und Probleme geschildert wurden, hatten "viele spontane Hilfsangebote" zur Folge. Dazu gehörten Wohnungs- und Arbeitsangebote, Geld- und Sachspenden sowie die Einladung zu einem "Entspannungswochenende" (DE vom 08.02.96, 07.03.96 und Ostern 96). Dies illustriert deutlich, daß die Erzeugung von Betroffenheit oder Mitleid sehr viel wirksamer sein kann, als Anstrengungen der Wohnungslosen selbst oder der Straßenzeitung? Welche Vor- und Nachteile ergeben sich daraus für die Wohnungslosenhilfe?
[168] Fußnoteninhalt wird nachgetragen
[169] Fußnoteninhalt wird nachgetragen
[170] Fußnoteninhalt wird nachgetragen
[171] Fußnoteninhalt wird nachgetragen
[172] Fußnoteninhalt wird nachgetragen
[173] Fußnoteninhalt wird nachgetragen
[174] Fußnoteninhalt wird nachgetragen
[175] Fußnoteninhalt wird nachgetragen
[176] Fußnoteninhalt wird nachgetragen
[177] Fußnoteninhalt wird nachgetragen
[178] Fußnoteninhalt wird nachgetragen
[179] Fußnoteninhalt wird nachgetragen
[180] Fußnoteninhalt wird nachgetragen
[181] Fußnoteninhalt wird nachgetragen
[182] Fußnoteninhalt wird nachgetragen
[183] Fußnoteninhalt wird nachgetragen
Vollständiges Inhaltsverzeichnis
2. DER MARKT BOOMT (noch immer)
3. VORSTELLUNG DER AUSGEWÄHLTEN INITIATIVEN
- 3.1 Hinz & Kunzt
- 3.1.1 Entstehung
- 3.1.2 Selbstverständnis und Ziele des Trägers - "Hilfe zur Selbsthilfe"
- 3.1.3 Selbstverständnis und Ziele der Zeitung - "Stadtmagazin und Sprachrohr"
- 3.1.4 Organisation und Struktur
- 3.1.4.1 MitarbeiterInnen
- 3.1.4.2 Produktion und Vertrieb
- 3.1.4.3 Finanzierung
- 3.1.5 Erscheinungsbild und Inhalte
- 3.1.6 Beteiligung von SozialarbeiterInnen
- 3.1.7 Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen
- 3.2 Der "TagesSatz"
- 3.2.1 Entstehung
- 3.2.2 Selbstverständnis und Ziele des Vereins - "Armut benötigt Aufmerksamkeit
- 3.2.3 Selbstverständnis und Ziele der Zeitung - "Hilfe zur Selbsthilfe"
- 3.2.4 Organisation und Struktur
- 3.2.4.1 MitarbeiterInnen
- 3.2.4.2 Produktion und Vertrieb
- 3.2.4.3 Finanzierung
- 3.2.5 Erscheinungsbild und Inhalte
- 3.2.6 Beteiligung von SozialarbeiterInnen
- 3.2.7 Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen
- 3.3 Der "Wohnungslooser"
- 3.3.1 Entstehung
- 3.3.2 Selbstverständnis und Ziele des Vereins - "Wir wollen, daß Menschen aktiv werden."
- 3.3.3 Selbstverständnis und Ziele der Zeitung - "Jeder kann zu Wort kommen."
- 3.3.4 Organisation und Struktur
- 3.2.4.1 MitarbeiterInnen
- 3.3.4.2 Produktion und Vertrieb
- 3.3.4.3 Finanzierung
- 3.3.5 Erscheinungsbild und Inhalte
- 3.3.6 Beteiligung von SozialarbeiterInnen
- 3.3.7 Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen
- 3.4 "Das Dach "
- 3.4.1 Entstehung
- 3.4.2 Selbstverständnis und Ziele des Trägers - "Teil der Öffentlichkeitsarbeit"
- 3.4.3 Selbstverständnis und Ziele der Zeitung - "Sprachrohr sozialer Probleme"
- 3.4.4 Organisation und Struktur
- 3.4.4.1 MitarbeiterInnen
- 3.4.4.2 Produktion und Vertrieb
- 3.4.4.3 Finanzierung
- 3.4.5 Erscheinungsbild und Inhalte
- 3.4.6 Beteiligung von SozialarbeiterInnen
- 3.4.7 Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen
- 3.5 Zusammenfassung
4. ANSPRUCH UND REALITÄT - UMSETZUNG DER ZIELVORSTELLUNGEN IN DER DISKUSSION
- 4.1 Einleitung
- 4.2 Hilfe zur Selbsthilfe
- 4.2.1 Selbsthilfe - eine Definition
- 4.2.2 Hilfe zur Selbsthilfe bei Straßenzeitungen
- 4.2.3 Kritische Zusammenfassung
- 4.3 "Ich verkaufe die neueste Ausgabe der..." - Das Arbeitsangebot der Straßenzeitungen
- 4.3.1 Welche Art von Beschäftigung bieten Straßenzeitungen an?
- 4.3.2 Gesellschaftliche Wiedereingliederung
- 4.3.2.1 Einstieg in ein geregeltes Leben - Arbeit mit Übergangscharakter
- 4.3.2.2 Qualifizierung der MitarbeiterInnen
- 4.3.2.3 Anschluß an den Arbeitsmarkt
- 4.3.3 "Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen?" - Das Leistungsprinzip
- 4.3.4 Zusammenfassung
- 4.4 Zusatzverdienst
- 4.4.1 Die finanzielle Situation von Wohnungslosen - Allgemeines
- 4.4.2 Verdienst durch Zeitungsverkauf
- 4.4.3 Anrechnung auf Sozialhilfe
- 4.4.3.1 Die Natur der Sozialhilfe
- 4.4.3.2 Derzeitige Rechtspraxis
- Hamburg
- Kassel
- Chemnitz
- Darmstadt
- 4.4.3.3 Für und wider einer Anrechnung
- 4.4.4 Zusammenfassung
- 4.5 Psychosoziale Auswirkungen - Sind Straßenzeitungen Selbstwertprojekte ?
- 4.5.1 Selbstwertgefühl - was ist das?
- 4.5.1 Soziale Kontakte von Wohnungslosen
- 4.5.3 Das Selbstbild von Wohnungslosen
- 4.5.4 "Heute noch Bettler am Straßenrand - morgen schon selbstbewußter Verkäufer... " - Steigerung des Selbstwerts durch Zeitungsverkauf?
- 4.5.5 Zusammenfassung
- 4.6 Öffentlichkeitsarbeit /Die Wirkung in und für die Öffentlichkeit
- 4.6.1 Präsenz der Straßenzeitungen im Stadtbild
- 4.6.2 Kreuzworträtsel und Wohnungsnot - Inhaltliche Aspekte
- 4.6.3 Das Image - Konkurrenz oder Zusammenarbeit?
- 4.6.4 Zusammenfassung
- 4.7 Fazit
5. STELLENWERT DER ZEITUNGSINITIATIVEN IN DER WOHNUNGSLOSENHILFE
- 5.1 Einleitung
- 5.2 Die Grundzüge der Wohnungslosenhilfe
- 5.3 Das Verhältnis von Straßenzeitungen und Wohnungslosenhilfe
- 5.3.1 Subsidiarität
- 5.3.2 Selbsthilfe
- 5.3.3 Niedrigschwelligkeit
- 5.3.4 Öffentlichkeitsarbeit
- 5.3.5 Vernetzung
- 5.5 Zusammenfassung
- 6.1 Einleitung
- 6.2 Mögliche Funktionen von SozialarbeiterInnen innerhalb eines Projekts
- 6.3 Vernetzung
- 6.4 Konformität oder Kritik - vom Selbstverständnis der sozialen Arbeit
- 6.5 Zusammenfassung
7. RESÜMÉE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN
- 7.1 Von, für oder über Wohnungslose?
- 7.2 Beteiligung von Wohnungslosen
- 7.3 Nutzen für Wohnungslose
- 7.4 Berichte über Wohnungslose
- 7.5 Unterschiede zulassen
- I. LITERATUR
- II. VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN
- III. INHALTSANALYSE DER ZEITUNGSINITIATIVEN
- IV. FRAGEBOGEN
Im Frühjahr dieses Jahres haben wir unsere LeserInnen gebeten, uns einige Fragen zu Inhalt und Form etc. des „strassenfeger“ zu beantworten. Große Tageszeitungen geben für solch statistischen Erhebungen sehr viel Geld aus, wir vertrauen Ihnen! Nachdem wir alle eingegangenen Antworten ausgewertet haben, hier nun die Ergebnisse unserer Leserumfrage, die sicher nicht ganz repräsentativ ist, aber, so glauben wir, doch einen gewissen Eindruck des Leserverhaltens widerspiegeln:
LESERINNEN-DEMOGRAFIE
Rund 40 Prozent unser LeserInnen sind über 60 Jahre alt, das hat uns ein wenig überrascht. Wahrscheinlich liegt das aber daran, dass viele ältere Leute den „strassenfeger“ aus Sympathie und Verständnis für Obdachlose regelmäßig kaufen und sich eben auch an der Umfrage beteiligt haben. Jeweils 28 Prozent der 41- bis 60Jährigen und der 21- bis 40-Jährigen lesen regelmäßig unsere Zeitung. Das kann sich sehen lassen. Dass aber nur vier Prozent der unter 20-Jährigen den „strassenfeger“ liest, macht uns nachdenklich. Hier müssen wir über die Gründe nachdenken. In Zukunft werden wir deshalb mehr auch über Themen berichten, für die sich junge Leute besonders interessieren.
Interessant auch das Ergebnis bei der Frage nach dem Geschlecht unser LeserInnen: 63 Prozent sind Frauen, nur 37 Prozent Männer! Liegt es vielleicht daran, dass Frauen sich mehr sozial engagieren, als Männer? Dass sie hilfsbereiter, spendenfreudiger sind als das andere Geschlecht?
Bei der Frage nach dem Familienstand gab es folgendes Ergebnis: 47 Prozent sind verheiratet, 34 Prozent sind Singles und 17 Prozent wohnen in einer Lebensgemeinschaft.
Äußerst interessant sind auch die Angaben zur Tätigkeit unser LeserInnen: Ruheständler und Angestellte machen den größten Anteil aus. Warum ist das so? Wir wissen es momentan noch nicht, werden aber versuchen, es zu ergründen!
Außerdem haben wir nach dem Leseverhalten gefragt. 66 Prozent gaben an, die komplette Zeitung zu lesen. 24 Prozent lesen ausgewählte Artikel und ganze zehn Prozent lesen den „strassenfeger“ nur flüchtig. Das ist ein sehr gutes Ergebnis! Doch kein Grund, in unseren Anstrengungen um Qualität nachzulassen.
KAUF-VERHALTEN
Zum Kaufverhalten noch Folgendes: 60 Prozent der Käufer erwerben die Zeitung, wenn sie irgendwo einen Verkäufer sehen, nur knapp 17 Prozent kaufen das Blatt immer beim selben Verkäufer. Zur Unterstützung des herausgebenden Obdachlosenvereins „mob e.V.“ (obdachlose machen mobil) kaufen 78 Prozent der Leser den „strassenfeger“. Rund 47 Prozent interessieren sich für den Inhalt. Fast 50 Prozent kaufen den „strassenfeger“ regelmäßig, 23 Prozent, wenn sie den Verkäufer sympathisch finden. Das sind unserer Meinung nach gute und interessante Zahlen, die für unsere Arbeit und die Akzeptanz unseres Vereins sprechen. Noch aussagefähiger für uns sind folgende Umfragewerte: Rund zwei Drittel der Leserinnen gefällt der „strassenfeger“ gut, nur einem Prozent überhaupt nicht.
VERKÄUFER-VERHALTEN
Ferner haben wir unseren LeserInnen Fragen zum Verhalten unserer VerkäuferInnen gestellt. Trotz gelegentlicher Kritik an manchem Verkäufer kann sich das Ergebnis sehen lassen: Rund 80 Prozent finden das Verhalten freundlich, nur rund drei Prozent empfinden
unsere Verkäufer als aufdringlich. Das es unter den VerkäuferInnen solch und solche gibt, ist uns durchaus bewusst. Nur sollte man bei aller berechtigten Kritik an ihnen (teils lustlos, manchmal nervig, grausig, wenn man nicht kauft, leierlich, pöbelnd?) nicht vergessen, wer die Verkäufer sind. Wer obdachlos ist, täglich um das nackte Überleben kämpft, der hat halt keinen Kurs in Knigge oder Verkaufsstrategie absolviert.
INHALTE
Zu unserem Statement, wir würden uns als politische Zeitung verstehen, gab es sehr unterschiedliche Meinungen: 44 Prozent der Befragten meinten, der „strassenfeger“ solle so bleiben, wie er ist, 43 Prozent möchten, dass wir Aktivitäten im sozialen Bereich entwickeln sollen, um Obdachlosen zu helfen, 30 Prozent sagte, der „strassenfeger“ solle sich stärker politisch engagieren, 24 Prozent wollten, dass wir uns mehr einmischen. Elf Prozent gaben an, dass die Hauptsache wäre, wenn den Verkäufern geholfen wird und nur in Prozent meint, dass wir uns besser aus der Politik heraushalten sollen. Dazu sagen wir: Da ist doch ein konkreter Auftrag für uns ersichtlich und dem werden wir in Zukunft auch entsprechend nachkommen.
Als Auftrag verstehen wir auch folgendes Ergebnis: Wir hatten gefragt, was den Leserinnen im „strassenfeger“ fehlt. 32 Prozent gaben an, mehr Berichte über soziale Projekte und Einrichtungen lesen zu wollen. 18 Prozent wollen mehr Artikel über die Bezirke und Kietze. Sehr gefragt sind auch Hintergrundberichte (16 Prozent) und Lebensberichte (13 Prozent). Nur sehr wenige Leser wollen Witze, Sport und Horoskope. (Na ja, das kriegen sie ja in anderen Blättern auch mehr als genug geboten, finden wir!) Diese Zahlen werden durch die Angaben auf die Frage „Mich interessiert vor allem?“ ergänzt: Mehr als 63 Prozent wollen mehr Berichte über soziale Projekte!
Schön finden wir übrigens das Ergebnis bei der Frage, ob durch die Arbeit des „strassenfeger“ ein besseres Verständnis für die Lage der Obdachlosen erreicht wird: 55 Prozent haben diese Frage mit „Ja“ beantwortet! Begründet wurden diese Aussagen mit Sätzen wie „Weil die Sachlage dieser Menschen geschildert wird...“, „Sie deutlich macht, wie schnell jeder von uns in diese Situation geraten kann...“, „Weil es kaum andere Medien gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen...“ oder „Weil Vorurteile abgebaut werden...“.
FORM
Das Erscheinungsbild des „strassenfeger“ stößt anscheinend auf große Akzeptanz: 81 Prozent wünschen, dass es so bleibt, wie es ist. Danke! Das empfinden wir als großes Kompliment!
WERBUNG
Womit wir nicht unbedingt gerechnet hatten, sind die Angaben zur Frage „Werbung – ja oder nein?“ 68 Prozent der Leserinnen sind der Meinung, das Werbung okay ist, wenn dem Projekt dadurch mehr Mittel zufließen. Wir werden daran arbeiten.
„strassenfeger“-RADIO
In unserer Umfrage haben wir auch nach dem „strassenfeger“-Radio gefragt, das seit Oktober 2004 14tägig auf dem Offenen Kanal Berlin ausgestrahlt wird. 33 Prozent der LeserInnen wusste davon noch nicht, immerhin elf Prozent hatten sich die Sendungen schon mal angehört. Hier müssen wir anscheinend öfter mal über unsere Radiomacher berichten.
FAZIT
Soviel erst einmal zu den Ergebnissen unserer Umfrage, die uns sicher bei unserer weiteren Arbeit helfen werden. Abschließend möchten wir uns ganz herzlich bei all unseren LeserInnen für die Beantwortung der vielen Fragen bedanken.
Die Redaktion
© mob e.V.
URL: http://www.strassenfeger.org/strassenfeger/ausgabe_2005-20/0013.html
Thomas Knuf
OBDACHLOSENZEITUNGEN
Mobilisierungsfaktor der Betroffenen oder publizistische Marktnische?
Diplomhausarbeit am Fachbereich Politische Wissenschaften der Freien Universität Berlin - Januar 1995
Inhalt
1. Vorwort
2. Einleitung
3. Mobilisierungsfaktor oder Marktnische?
4. Methodisches Vorgehen
5. Portraits
6. Entwicklungsskizzen
7. Mobilisierungsfaktor und Marktlücke (Zusammenfassung)
Vollständiges Inhaltsverzeichnis
Fußnoten
Autor
1. VORWORT
Die Idee scheint genial einfach: Obdachlose verkaufen eine Zeitung und/oder gestalten diese mit, wodurch sie eine Beschäftigung und Erwerbsmöglichkeit bekommen. Über "Hinz & Kunz(t)" aus Hamburg war viel berichtet worden, und es war nur eine Frage der Zeit bis ein ähnliches Projekt in Berlin, der "Hauptstadt der Wohnungslosen", angeschoben wurde.
Das Interesse an diesem neuen Phänomen Obdachlosenzeitung als auch die Tatsache, daß ich mich in den vorhergegangenen zwei Jahren mit dem Thema beschäftigt hatte, u.a. in Form kleinerer empirischer Untersuchungen, veranlaßten mich, den Aufbau einer solchen Zeitung in Berlin zu begleiten. Die ursprüngliche Idee, die Obdachlosenzeitungen in Berlin, Hamburg und München in ihrer Entstehung, ihrem Konzept und dessen Umsetzung zu vergleichen, ließ sich nicht realisieren. Keine zwei Monate nach Erscheinen der ersten wurden bereits vier Zeitungen auf den Straßen Berlins zum Verkauf angeboten wurden. Diese Entwicklung erschien mir interessant genug, um sie zu untersuchen und einen Vergleich mit den anderen Städten zu unterlassen.
2. EINLEITUNG
Im Oktober und November 1993 erschienen in München und Hamburg die ersten Straßenzeitungen in der Bundesrepublik Deutschland zum Thema Obdachlosigkeit, durch deren Verkaufserlös von einer Mark pro Exemplar die VerkäuferInnen den ersten Schritt aus der Abhängigkeit vom Sozialamt oder Betteln realisieren konnten.
"BISS" (Bürger in sozialen Schwierigkeiten) im Süden und "Hinz & Kunz(t)" im Norden der Republik hatten einen durchschlagenden Erfolg. In Hamburg war die erste Auflage von 30.000 Exemplaren nach zehn Tagen ausverkauft, so daß nachgedruckt werden mußte. Mittlerweile werden monatlich 120.000 Exemplare von 450 VerkäuferInnen unter die Leute gebracht. In München war zwar der quantitative Verkaufserfolg nicht so überwältigend, überstieg aber dennoch die Erwartungen der Redaktion bei weitem. "BISS" erschien anfangs vierteljährlich, nun zweimonatlich mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren.[1]
Die Idee einer Obdachlosenzeitung stammt aus den USA und fand in Europa u.a. in London und Paris erfolgreiche Nachahmer. Im September 1991 startete "THE BIG ISSUE" in London als Monatsmagazin mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren. Inzwischen erscheint die Zeitung wöchentlich mit einer Auflage von 100.000 Exemplaren, die von ca. 800 VerkäuferInnen vertrieben werden.[2] In Paris existieren seit November 1993 vier Zeitungen, die von Obdach- und Arbeitslosen verkauft werden. Die vom Anspruch und Inhalt unterschiedlichen Blätter erscheinen in einer Gesamtauflage von über 700.000 Exemplaren im Monat.[3]
"Nur "Le Reverbere" wird auf der Straße geschrieben"[4] , so George Mathis, der Herausgeber einer der vier Pariser Zeitungen und der "HAZ" in Berlin, der ersten Obdachlosenzeitung der Stadt, die im März 1994 erschien. Es folgten "mob", "ZEITDRUCK" und "Platte". In Berlin werden monatlich etwa 100.000 Zeitungen von Obdachlosen verkauft. Diese Zahlen machen deutlich, daß ein durchaus nennenswerter Markt für solche Zeitungen existiert. In welchem Maße sie dem Geldbeutel der Herausgeber oder aber den Betroffenen dienen, soll hier für Berlin untersucht werden.
3. MOBILISIERUNGSFAKTOR ODER MARKTNISCHE?
"Im vereinten Deutschland leben mehr als eine Millionen Menschen in Obdach- und Wohnungslosigkeit, davon 150.000 völlig ohne Wohnung, dauerhafte Unterkunft und ohne Wohnsitz auf der Straße oder befristet in Heimen. Und alles deutet daraufhin, daß diese Zahl weiterwachsen, dramatisch weiterwachsen wird."[5] Neben der allgemeinen Zunahme an Obdachlosen lassen sich zwei weitere, spezielle Steigerungstendenzen festmachen. Im westlichen Teil der Bundesrepublik gibt es etwa 50.000 wohnungslose Frauen, von denen 13.000 auf der Straße leben.[6] Ungefähr 40.000 Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren leben ebenfalls zeitweise oder ganz auf der Straße.[7]
Diese Zahlen sollen lediglich verdeutlichen, welche quantitative Dimension das Problem Obdachlosigkeit in Deutschland hat und welchen Stellenwert diese Zeitungsprojekte in Anbetracht solcher Zahlen nur haben können.
Der "Berber-Brief", "Der Bürgerschreck" oder der "Bankexpress" sind Publikationen von Betroffenen, überwiegend für Betroffene geschrieben, die in relativ kleiner Auflage vertrieben werden.[8] Die hier zu untersuchenden Zeitungen unterscheiden sich von den letztgenannten deutlich durch Aufmachung und Auflage, was die Frage nach der Motivation der Herausgeber sinnvoll erscheinen läßt.
Ging es darum, nachdem die englischen und französischen Vorbilder die enorm hohen Absatzmöglichkeiten demonstriert haben, die in Berlin bis dahin existierende Lücke zu füllen, zumal in Hamburg ein solches Projekt sich erfolgreich zu etablieren schien?
Sollen Obdachlose lediglich den Verkauf mit den durchaus möglichen finanziellen Vorteilen für sie übernehmen oder finden sie sich auch thematisch in der Zeitung wieder? Werden sie an der inhaltlichen und redaktionellen Arbeit beteiligt und in welcher Form und mit welchen Problemen ließe sich eine solche Kooperation bewerkstelligen?
Letzteres verweist auf den Aspekt der "Arbeitsfähigkeit" der Betroffenen, die meistens jahrelang aus strukturierten Arbeitsprozessen ausgeschlossen waren und auf die mitunter sehr problembeladene Zusammenarbeit von "Profis" und Betroffenen.
"Klare Betriebsregeln und Sanktionskataloge sind nötig, um objektiviert auf die Verletzung der für produktive Arbeit unverzichtbaren Absprachen reagieren zu können. Betriebliche, an der Kompetenz festgemachte Hierarchien und klare Rollen erleichtern den Teilnehmern die Orientierung - Ansprüche und Ansätze in Richtung "Selbstverwaltung" überfordern sie (die Betroffenen, d.V.) in der Regel maßlos."[9]
Klare Regeln wurden schon in Hamburg eingeführt: jeder Verkäufer muß sich registrieren lassen und erhält einen Ausweis. Es ist verboten, in betrunkenem Zustand zu verkaufen und Leute zu beschimpfen, die die Zeitung nicht kaufen wollen. Bei Verstößen gegen diese Regeln muß der Ausweis zumindest zeitweilig abgegeben werden.[10]
Die Einführung bestimmter Reglements erscheint einsichtig und notwendig. Die Intention dieser Obdachlosenzeitungen, "helping the homeless help themselves"[11], tendiert offensichtlich in Richtung Selbsthilfe, was zunächst auf die Verkaufstätigkeit und den damit verbundenen selbstständigen Verdienst bezogen ist. Darüber hinausgehende Ansätze von Sozialer Selbsthilfe in den Bereichen Vertrieb und Redaktion oder in Projekten, die sich aus diesem Zusammenhang und mit dessen finanzieller Unterstützung entwickeln, sollten gerade bei diesen, in der Form neuartigen, Vorhaben nicht vorschnell aufgrund einschlägiger Erfahrungen mit "Selbstverwaltung" als unrealisierbar charakterisiert werden. Die Etablierung Sozialer Selbsthilfegruppen, deren Handlungsnormen durch Autonomie, Selbstgestaltung, Solidarität und Betroffenheit gekennzeichnet werden[12], ist zum selbstverständlichen und staatlicherseits geförderten Teil der sozialpolitischen Infrastruktur avanciert. Warum sollten nicht ebenfalls obdachlose Menschen ihre Interessen in dieser Art und Weise durchzusetzen suchen? Können die Obdachlosenzeitungen die Funktion einer Keimzelle einer "Obdachlosen-Bewegung" erlangen und somit Kritiker der bestehenden Verhältnisse und Mobilisierungsfaktor einer Veränderung gleichermaßen sein? Die Beantwortung der letzten Frage ist sicherlich erst in einigen Jahren möglich, dennoch ist es schon jetzt von Bedeutung, inwieweit Betroffene Mitsprache und Verantwortung in den Zeitungsprojekten haben, inwieweit eine Mobilisierung auf individueller Ebene stattfindet.
4. METHODISCHES VORGEHEN
Zwei Faktoren bestimmten maßgeblich die methodische Vorgehensweise und den Aufbau der Arbeit. In Anbetracht der Neuartigkeit dieser Publikationen erscheint es nicht verwunderlich, daß bisher keine wissenschaftliche Literatur zu dem Thema erschienen ist. Deshalb konnte es sich nicht um die Bearbeitung eines speziellen Aspektes, als vielmehr um den Versuch eines allgemeinen Überblicks handeln, in dessen Verlauf bestimmte Charakteristika der jeweiligen Zeitung besondere Beachtung fanden.
Der zweite entscheidende Faktor erklärt sich aus meiner Mitarbeit während der ersten vier Monate bei "mob". Die in dieser Zeit miterlebten Konflikte und deren Eskalation zwischen dem Herausgeber, den RedakteurInnen und den Betroffenen ließen mich zu der Überzeugung kommen, daß eine Rekonstruktion der Entwicklung notwendiger Bestandteil dieser Arbeit sein muß, wenn versucht werden soll, die speziellen Probleme dieser neuen Form von Öffentlichkeitsarbeit wiederzugeben. Aus dieser direkten Konfrontation und dem daraus resultierenden tieferen Einblick in die formellen und informellen Strukturen des Projekts erklärt sich der wesentlich größere Stellenwert, den die Beschreibung von "mob" im Gegensatz zu den anderen Zeitungen einnimmt.
Meine Mitarbeit bei "mob" bestand in der regelmäßigen Teilnahme an den mindestens einmal monatlich stattfindenden Redaktionssitzungen und dem Schreiben von drei Artikeln. Den unausweichlichen Rollenkonflikt zwischen Beobachtung und Teilnahme[13] kompensierte ich durch die Interviews mit allen Konfliktparteien, wodurch das notwendige Maß an Objektivität gewährleistet wurde. Die Bereitschaft der Beteiligten zu diesen Interviews, in deren Verlauf Interna preisgegeben wurden, die in dieser Arbeit nur in dem Maße wiedergegeben werden, wie es zum Verständnis der Entwicklung erforderlich war, wäre ohne meine Mitarbeit wesentlich geringer ausgefallen. Einerseits hätte es ganz allgemein an Vertrauen gemangelt, einem Fremden gegenüber interne Probleme anzusprechen und andererseits war es mir durch meine Mitarbeit möglich, an gemachte Erfahrungen anzuknüpfen, Widersprüchlichkeiten eher wahrzunehmen und dadurch mehr Informationen zu erhalten.
Neben der Teilnahme und den Interviews, wovon ich in der Regel zwei sowohl mit den verschiedenen Parteien bei "mob" als auch den Verantwortlichen der anderen Zeitungen durchführte, gehörte noch eine qualitative Inhaltsanalyse zur methodischen Vorgehensweise, um das redaktionelle Profil der vier Zeitungen darzustellen.
Im ersten Teil dieser Arbeit wird der Aufbau der Zeitungen, die Intention und Konzeption der Herausgeber bzw. der RedakteurInnen sowie das redaktionelle Profil portraitiert. Hierdurch sollen die Unterschiede zwischen den Zeitungen bezüglich Anspruch und Inhalt deutlich werden.
Im zweiten Teil werden die Entstehung und der Werdegang der Projekte skizziert, worin die Initiatoren vor- und die Arbeit bei der Zeitung in redaktioneller und betriebswirtschaftlicher Hinsicht dargestellt werden. Diese Skizzen beschreiben die Anlaufschwierigkeiten, die Mitarbeit von Betroffenen in Redaktion und Vertrieb sowie die finanzielle Entwicklung, wodurch sich die Frage beantworten läßt, ob diese Projekte eher den Betroffenen zu Gute kommen oder aber eine Marktlücke in der Zeitungsbranche profitabel füllen können.
5. Portraits
Einführung
In diesem Kapitel sollen die vier Berliner Obdachlosenzeitungen vorgestellt werden, wobei "mob" aus oben erwähnten Gründen ausführlicher beschrieben wird.
Im ersten Teil wird die Struktur der jeweiligen Zeitung dargestellt, womit der Aufbau in unterschiedliche Rubriken und die inhaltliche Gliederung gemeint ist. Im zweiten Teil werden die Ziele, die mit der Publikation verbunden wurden, und deren konzeptionelle Umsetzung umrissen.Abschließend wird versucht, das redaktionelle Profil mit Hilfe einer quantitativen Inhaltsanalyse nachzuzeichnen. Aufgrund der überschaubaren Anzahl der zu untersuchenden Exemplare aller vier Zeitungen von insgesamt 34 Ausgaben ließen sich die folgenden Katagorien erstellen, mit denen die Ausrichtung der Berichterstattung der vier Zeitungen vergleichend analysierbar war. Es handelt sich hierbei aber nur um eine Grobskizze, da der rein quantitativen Analyse keine Hypothese zugrunde lag, die es zu verifizieren oder zu falsifizieren galt. Es sollten lediglich die Artikel den Kategorien zugeordnet und somit thematische Schwerpunkte der Berichterstattung der jeweiligen Zeitung ermittelt werden.[14]
Inhaltsanalytische Kategorien:
- 01. Anzeigen
- 02. Service: Adressen, Tips, Termine
- 03. Leserbriefe
- 04. Cartoons, Comics, Fotos
- 05. Politik und Gesellschaft: Wohnungspolitik, Spekulation, Sozialpolitik, gesellschaftliche Armut, politische Parteien
- 06. Institutionen der Obdachlosenhilfe (Wärmestuben, Pensionen, Beratungsstellen, Projekte, medizinische Versorgung, staatliche Behörden etc.)
- 07. Lebenssituation von Obdachlosen, Wagenburglern, Hausbesetzern und Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind (soziale, rechtliche und sozialpsychologische Aspekte)
- 08. Sucht, Knast, Psychiatrie und Heime
- 09. Frauen
- 10. Kinder und Jugendliche
- 11. Internationales
- 12. Kultur und Literatur
- 13. Gedichte, Berichte und Biographisches von Betroffenen
- 14. Feuilleton: Geschichten, Märchen, Fiction, Short Story
- 15. Internes: Selbstdarstellungen der Zeitung, ihrer Entwicklung, ihrer MitarbeiterInnen und der von ihnen initiierten Projekte
Die Kategorien und die Ergebnisse dieser quantitativen Inhaltsanalyse wurden an dieser Stelle plaziert, um sie nicht bei der Beschreibung des redaktionellen Profils jeweils wiederholen zu müssen.
Durchschnittliche Berichterstattung anhand obiger Kategorien (Angaben in Seiten)
| Kategorie | mob 1 | mob 2 | haz1 | haz2 | Platte | Zeitdruck |
| 01 | 0,5 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 | 1,0 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 2,7 | 0,3 |
| 03 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,4 |
| 04 | 1,0 | 1,2 | 3,2 | 0,7 | 2,5 | 1,5 |
| 05 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 3,9 | 2,0 | 0,7 |
| 06 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 1,2 | 2,3 | 1,5 |
| 07 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 2,4 | 0,8 | 3,6 |
| 08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,6 |
| 09 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,8 |
| 10 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,4* |
| 11 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 0,1 | 3,5 |
| 12 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 4,6 | 0,7 | 1,3 |
| 13 | 1,4 | 2,3 | 3,8 | 2,7 | 2,5 | 2,3 |
| 14 | 0,0 | 0,5 | 3,8 | 0,4 | 2,4 | 0,5 |
| 15 | 1,0 | 1,9 | 0,6 | 1,5 | 4,7 | 0,6 |
* Da es sich bei "ZEITDRUCK" um eine Zeitung von Jugendlichen handelt, gibt dieser Wert die Berichterstattung nur über Kinder wieder.
Durchschnittliche Berichterstattung anhand obiger Kategorien (Angaben in Prozent)
| Kategorien | mob1 | mob2 | haz1 | haz2 | Platte | Zeitdruck |
| 01 | 03,5 | 11,7 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 |
| 02 | 06,9 | 04,8 | 07,1 | 07,1 | 11,7 | 01,4 |
| 03 | 02,1 | 02,1 | 02,8 | 02,4 | 03,0 | 01,9 |
| 04 | 06,9 | 08,3 | 15,2 | 03,3 | 10,9 | 07,1 |
| 05 | 11,0 | 11,7 | 06,7 | 18,6 | 08,7 | 03,3 |
| 06 | 14,5 | 00,0 | 10,0 | 05,7 | 10,0 | 07,1 |
| 07 | 06,9 | 04,1 | 04,3 | 11,4 | 03,5 | 17,1 |
| 08 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 01,3 | 12,4 |
| 09 | 05,5 | 02,8 | 02,4 | 00,5 | 03,5 | 03,8 |
| 10 | 03,5 | 02,1 | 00,0 | 01,0 | 00,9 | 06,7* |
| 11 | 05,5 | 04,8 | 02,9 | 06,2 | 00,4 | 16,7 |
| 12 | 16,5 | 15,2 | 09,5 | 21,9 | 03,0 | 06,2 |
| 13 | 09,7 | 15,9 | 18,0 | 12,8 | 10,9 | 11,0 |
| 14 | 00,0 | 03,5 | 18,0 | 01,9 | 10,4 | 02,4 |
| 15 | 06,9 | 13,1 | 02,9 | 07,1 | 20,4 | 02,8 |
* Da es sich bei "ZEITDRUCK" um eine Zeitung von Jugendlichen handelt, gibt dieser Wert die Berichterstattung nur über Kinder wieder.
mob
Von dem Monatsmagazin "mob" sind in der Zeit vom 18. März bis zum 1. Dezember 1994 acht Ausgaben erschienen. Zum 31.7.94 beendete der bisherige Herausgeber BIN e.V. seine Tätigkeit aufgrund finanzieller Notwendigkeiten, was auch die Kündigung der drei RedakteurInnen zur Folge hatte. Bis zu dem Zeitpunkt waren fünf Ausgaben publiziert worden.
Am 1.8. wurde der Träger- und Herausgeberverein "mob - Obdachlose machen mobil" gegründet, der die Zeitungsarbeit unter veränderten Bedingungen fortsetzte.
Wegen der konzeptionellen Unterschiede der ersten fünf und der folgenden drei Ausgaben ist es erforderlich, diese getrennt zu betrachten: "mob" I und "mob" II
Struktur
mob I
Der Aufbau und die Gliederung der Zeitungen sind bis auf kleine Veränderungen in jeder Ausgabe gleich. Den i-Punkt von "magazin" stellt eine kleine Fledermaus, das Logo der Zeitung, dar, "das Tier mit dem sensiblen Orientierungssinn und Tönen, die normalerweise nicht jedeR hört...".[15]
Jede Ausgabe hat sechzehn Seiten, welche bis auf punktuelle Abweichungen jeweils denselben Themen zugeordnet sind. Die Seiten zwei und drei sind einem Interview mit einem "Kulturschaffenden", der Inhaltsübersicht der Ausgabe und einem halbseitigen Editorial der Redaktion sowie dem Impressum vorbehalten. Das folgende Prominenten-Interview nimmt fast zwei Seiten, das Schwerpunktthema zwei bis drei Seiten in Anspruch. Im Mittelteil der Zeitung werden unter dem Begriff "Straßenpoesie" auf zwei Seiten Gedichte und Texte von obdachlosen Menschen und der oder die "Obdachlose des Monats" vorgestellt. Dann folgt eine Seite, die sich mit dem Thema Obdachlosigkeit aus der Sicht bzw. Erfahrung von Frauen beschäftigt. Auf der Kulturseite gibt es eine Rezension, ein Interview oder eine Reportage.
Die BAG (Bundesarbeitsgemeinschaft) Wohnungslosenhilfe - Betroffeneninitiative hat sich im November 1993 auf einem Treffen verschiedenmer Selbsthilfegruppen, Vereine und Initiativen aus dem Wohnungslosenbereich gegründet. Der BAG steht in jeder Ausgabe von "mob" eine Seite zur freien Verfügung. Eine weitere Seite widmet sich einem berlinspezifischen Thema unter der Überschrift "Stadtentwicklung und Wohnen". Ebenso auf einer Seite werden die Themen "Gesundheit und medizinische Versorgung" von obdachlosen Menschen in der Stadt behandelt. Die Rubrik "Projekte und Einrichtungen" stellt Institutionen der Obdachlosenhilfe vor.
In den ersten beiden Ausgaben wurde jeweils noch eine Seite von "ZEITDRUCK" gestaltet, die seit dem 1.5.94 als eigenständige, ausschließlich von jugendlichen Obdachlosen hergestellte, Straßenzeitung existiert. "ZEITDRUCK" hatte hier die Möglichkeit, sich selbst vorzustellen und auf das baldige Erscheinen der eigenen Zeitung aufmerksam zu machen. Diese, ab der dritten Ausgabe freie Seite wurde in den folgenden drei Ausgaben für aktuelle, die Zeitung selbst bzw. die 'Räume' für Obdachlose betreffende, Artikel genutzt.
Adressen, Service, Szenesplitter und LeserInnenbriefe sind ständige Rubriken, die aber keine ganze Seite in Anspruch nehmen und überwiegend am Seitenrand plaziert werden. Die letzte Seite sollte ursprünglich als Anzeigenfläche fungieren, was sich aber nicht realisieren ließ. Bis auf die Nummer 2 sind die Rückseiten der Ausgaben mit ganzseitigen Fotos gefüllt. Die Erschließung von finanziellen Mitteln durch Werbung konnte bei "mob"I erst in der fünften Ausgabe einen nennenswerten Stellenwert erreichen.
mob II
Das Layout und die Gestaltung der Titelseite wurden bei "mob" II nicht verändert. Ebenso wurde weiterhin ein Schwerpunktthema behandelt und die "Straßenpoesie" publiziert. Eine Kultur- und Frauenseite und das Prominenteninterview waren nicht in jeder der drei Ausgaben zu finden. Die BAG hat in den letzten beiden Ausgaben nichts mehr veröffentlicht. Gänzlich entfielen die Rubriken "Projekte und Einrichtungen","Stadtentwicklung und Wohnen" und "Gesundheit". Seit der vorletzten Ausgabe gehören die Sparten "Internes" und "Aktuell" zum festen Bestandteil der Zeitung. Der Anzeigenteil erhöhte sich von einer Seite in der sechsten Ausgabe auf zweieinhalb Seiten in "mob" Nr.8.
Intention und Konzeption
mob I
Der gemeinnützige Verein BIN e.V. existiert seit über zehn Jahren und gab seit 1989 das BINFO heraus, eine vier- bis fünfmal jährlich erscheinende Fachzeitschrift für Berlin zu den Themen Obdach- und Wohnungslosigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung. MitarbeiterInnen aus Beratungsstellen und Ämtern sowie Klienten und Betroffene schrieben Artikel für diese Zeitung, die in einer relativ kleinen Auflage von 400 Exemplaren von Kirchengemeinden, Wärmestuben, Bibliotheken, Fachhochschulen, Journalisten und engagierten Leuten abonniert wurden.[16]
Ausgelöst durch das erfolgreiche Beispiel der "Big Issue" in London, begann im Sommer '93 in der Redaktion die Diskussion über den Ausbau des BINFO zu einer Straßenzeitung, die von obdachlosen Menschen verkauft werden sollte. Konzeptionell wurden folgende grobe Richtlinien festgelegt: es sollte kein Anzeigen- und Veranstaltungsblatt werden, was sich zwar gut zum Verkauf eignen würde (siehe "Hinz & Kunz(t)" in Hamburg), sondern eher Sprachrohr der Obdachlosen. Eine inhaltlich kritische Auseinandersetzung mit der (sozial)politischen Situation ähnlich wie im bisherigen BINFO sollte auf eine breite Öffentlichkeit zugeschnitten werden. Die Berichterstattung dürfte nicht zu fachspezifisch, sondern müßte allgemein verständlich, interessant und ansprechend sein. Ein Ratgeber- und Serviceteil sollte Hilfestellungen und Anlaufstellen für alle in soziale Notlagen geratene Menschen bieten.
Die Zeitung sollte nicht in erster Linie als Arbeitsbeschaffungsprojekt fungieren, weil damit Arbeitslosigkeit nicht abzubauen sei. Sie sollte vorrangig dazu dienen, öffentlich politischen Druck auszuüben. Die Verdienstmöglichkeit durch den Verkauf für Betroffene stelle eher einen Nebeneffekt dar. Obdachlose Menschen sollten sich in die Zeitung einbringen können. BIN veranstaltete einen Workshop für alle, die sich beteiligen wollten. Mit Hilfe dieser "Ideenbörse" sollten Leute mobilisiert werden für IHRE Zeitung, mit der sie dann auch gegen die Bedingungen, unter denen sie leiden, kämpfen können.[17]
Die Mitgliederversammlung von BIN beschloß Anfang 1994 die Herausgabe einer solchen Straßenzeitung. Kurz darauf erhielt der Verein 100.000 DM aus dem Berliner Bußgeldfond zugewiesen, die als Startkapital für die Zeitung genutzt wurden.[18]
Drei Personen wurden eingestellt, die hauptamtlich den Aufbau der Zeitung leisten sollten. Lars F. sollte hauptsächlich für den betriebswirtschaftlichen Teil zuständig sein, Sonja K. für den redaktionellen und Vera R. sowohl für die Redaktion als auch den Vertrieb.[19] Diese mußten innerhalb kürzester Zeit konzeptionelle Richtlinien festlegen, die der Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz vorgestellt wurden.
"Das Risiko Wohnungslosigkeit kann heute fast jeden und jede treffen. Darum wird "mob" mit sozialpolitisch kritischem Zuschnitt alle Themenfelder rund ums Wohnen, Wohnungsnot und (Haupt-)Stadtplanung zum Gegenstand haben. Vor allem ist "mob" ein Betroffenenmagazin, Sprachrohr einer Lebensart - ohne jeglichen Anflug von Elendskult! "mob" will aber auch generell ein Forum bieten für alle Fragen, die sich um Wohnungsnot, Mietschuldenkrise (vor allem) in den östlichen Stadtbezirken, Hausbesetzungen und alternative Wohnformen etc. ranken. Aber auch themenspezifische Beiträge prominenter Kulturschaffender werden ebenso zum festen Programm des Magazins gehören wie Meinungsäußerungen von VertreterInnen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen. Und nicht zuletzt: "mob" soll ganz grundsätzlich Brücken bauen zwischen WohnungsinhaberInnen und Unbehausten, den BerberInnen, RollheimerInnen, WagenburglerInnen."
Die Betroffenen selber "werden dieses Magazin entscheidend mitgestalten: von der Recherche bis zum Vertrieb. Drei RedakteurInnen sind in der Aufbauphase mit der Unterstützung, Vernetzung und Koordination der redaktionellen und an den Vertrieb gebundenen Arbeit der Wohnungslosen betraut. (...)
Den Verkauf übernehmen ausschließlich Wohnungslose, die den überwiegenden Teil der Einnahmen als Verdienst für die Verkaufstätigkeit einbehalten. Darüberhinaus liegt ein zentraler Schwerpunkt von "mob" auf der Veröffentlichung und Präsentation publizistischer und künstlerischer Eigenproduktion von Obdachlosen, die tarifüblich vergütet werden soll."[20]
Das redaktionelle Konzept wurde in Anbetracht der sehr kurzen Vorlaufzeit quasi während der praktischen Vorbereitungen für die erste Ausgabe ausgestaltet.[21] Es war geplant, daß zum Themenbereich Obdachlosigkeit neben einem Schwerpunktthema jeweils folgende Sparten eingerichtet werden: Einrichtungen/Projekte, Frauen, Gesundheit & medizinische Versorgung und drei bis vier Seiten von und über Betroffene. Das zweite Standbein der Zeitung sollte der Kulturteil inclusive eines Interviews mit einer prominenten Person aus der Berliner Kulturszene und ein Interview mit "VertreterInnen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen" bilden. Hiermit war anvisiert, potentielle KäuferInnen zu interessieren, die nicht ausschließlich Berichte über Obdachlosigkeit und soziale Verelendung lesen wollten. Die Interviews mit prominenten bzw. bekannten Personen sollten einerseits einen PR-Effekt hervorbringen, der die Leute auf der Straße dazu bringt, diese Zeitung jetzt zu kaufen, weil sie das Interview lesen wollen. Der Redakteur ging davon aus, daß dann auch die Artikel über sozialpolitische Themen zumindest wahrgenommen werden. Andererseits sollten Prominente oder Funktionsträger als "VertreterInnen gesellschaftlicher Gruppen" in die Pflicht genommen und befragt werden, die sogenannte "bündnispolitische Komponente"[22] des redaktionellen Konzepts. Es sollten dadurch Diskussionen angeschoben und Schnittstellen ausgemacht werden zwischen verschiedenen Gruppen und Bereichen z.B. zu den Themen Sozialpolitik, Ausgrenzung und Gewalt gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen.
mob II
"Um unser Projekt zu erhalten, mußten wir einige Änderungen vornehmen. Ein neuer Verein ist in Gründung, "mob - Obdachlose machen mobil", der nun dabei ist, die Angelegenheiten für das Magazin zu regeln. Der Verein besteht nicht wie vorher nur aus "Normalbürgern" mit geregeltem Einkommen, sondern auch aus Obdachlosen, die nun endlich ein uneingeschränktes Mitspracherecht haben. Wir können jetzt also von einem echten Selbsthilfeprojekt sprechen."[23]
Es gab keine hauptamtlichen RedakteurInnen mehr, eine der bisherigen arbeitete zeitweilig ehrenamtlich mit. Wesentlicher Motor dieses Umstrukturierungs-, fast schon Neugründungsprozesses waren Stefan S., Vereinsmitglied von BIN e.V., und Burga K., freie Journalistin. Diese und Heiko M., obdachloser Mitarbeiter der ersten Stunde bei "mob", stellen den Vorstand des neuen Vereins.
Primäres Ziel nach dem Wechsel des Herausgebers war der Erhalt der Zeitung als Betätigungsfeld für ca. zehn Betroffene, als engagiertes Medium und als Erwerbsmöglichkeit für die VerkäuferInnen, wobei die Reduzierung solcher Zeitungsprojekte auf den Verkauf als "neue Beschäftigungsperspektive" für Obdachlose abgelehnt wird. Relevanter seien Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung, "wenn also jemand das sozusagen als Schritt begreift, rauszukommen aus der Wärmestube und jetzt Leuten offenen Auges ins Angesicht zu blicken, anders aufzutreten, etwas zu sagen, sich dazu eine Meinung zu bilden und vielleicht auf die Idee zu kommen: ich schreib' jetzt auch was." Dieser Entwicklungsprozeß könnte darin münden, daß der Obdachlose zu einer für ihn akzeptablen Lebensform und -weise findet, die nicht unbedingt eine feste Wohnung und eine geregelte Arbeit beinhaltet, sondern "wo er mit sich selbst ins Reine kommt". Denn: "Es geht gar nicht mehr darum, Leute irgendwohin zu integrieren, weil es diese Mitte schon gar nicht mehr gibt, in die man Leute hinintegrieren könnte."[24]
Ein inhaltlich detailliertes Konzept wurde nicht erstellt.[25] Es sollte ein Schwerpunktthema in jeder Ausgabe behandelt und die Texte von Betroffenen in der Rubrik "Straßenpoesie" veröffentlicht werden. Desweiteren sollte das "Prominenten-Interview" fester Bestandteil der Zeitung bleiben. Bedingt durch die zeitlich begrenzte ehrenamtliche Tätigkeit einerseits und die notwendige Einarbeitungszeit der obdachlosen Mitarbeiter in den Bereichen Recherche und Redaktion andererseits wurde verstärkt auf Fremdtexte aus Zeitungen und Büchern zurückgegriffen.
Zusammenfassend wurde das redaktionelle Konzept derart skizziert, daß bei der neuen "mob" in zunehmendem Maße Betroffene zu Wort kommen und schreiben, und daß prominente Personen durch die Interviews zum PR-Träger der Zeitung werden.[26]
Redaktionelles Profil
Die Einteilung in feste Rubriken führte dazu, daß eine relativ kontinuierliche Berichterstattung zu den verschiedenen Aspekten von Obdachlosigkeit in den ersten fünf Ausgaben von "mob" stattfand. Aufgrund der inhaltsanalytischen Untersuchung lassen sich quantitative Schwerpunkte ausmachen. Reportagen über und Interviews mit Menschen, die sich kulturell betätigen, nahmen den meisten Raum in der Zeitung in Anspruch (16,5%), gefolgt von Dar- und Vorstellungen staatlicher und nichtstaatlicher Institutionen der Obdachlosenhilfe (14,5%). Berichte über Politik und Gesellschaft standen an dritter Stelle (11%) und die Texte von Betroffenen an vierter (9,7%).
Der in der Presseerklärung formulierte Anspruch, daß "mob mit sozialpolitisch kritischem Zuschnitt alle Themenfelder rund ums Wohnen, Wohnungsnot und (Haupt-)Stadtplanung zum Gegenstand haben" wird, ist durchaus erfüllt worden. Die Etablierung von "mob" als Betroffenenmagazin, das "Sprachrohr einer Lebensart" sein wollte, erscheint mir dagegen nicht erreicht worden zu sein.
Die Veränderungen bei "mob" durch den neuen Herausgeber und die neue Redaktion schlugen sich auch im Profil der Zeitung nieder. Während sich das Anzeigenvolumen mehr als verdreifachte (11,7%), entfielen die Artikel über die Institutionen der Obdachlosenhilfe. Parallel dazu stieg der Anteil der Betroffenentexte um mehr als die Hälfte (15,9%) und die Berichterstattung über Internes verdoppelte sich fast (13,1%), wobei festzuhalten ist, daß diese Artikel ganz überwiegend von Betroffenen verfaßt wurden. Während Themen aus den Bereichen Politik und Gesellschaft (11,7%) sowie Kultur und Literatur (15,2%) als auch Internationales (4,8%) in verleichbarem Umfang behandelt wurden, reduzierte sich die Berichterstattung zu Frauenobdachlosigkeit um die Hälfte (2,8%) und über die Lebenssituation von Betroffenen um ca. ein Drittel (4,1%).
Das Profil der neuen "mob" zeichnete sich bisher weniger durch eine breitgefächerte Berichterstattung aus, im Vordergrund stand nun die Veröffentlichung von Texten der Betroffenen. Das korrespondierte mit der Intention der neuen Herausgeber, die Arbeit bei der Zeitung als Schritt der persönlichen Entwicklung der Betroffenen zu verstehen und zu fördern.
HAZ
Struktur
Vom 9.3. bis zum 12.12.94 erschienen neun Ausgaben von "HAZ", "HUNNIS ALLGEMEINE ZEITUNG". Sie sollte monatlich erscheinen. Zur Beschreibung und Analyse der Zeitungen ist es allerdings notwendig, die ersten beiden Ausgaben seperat zu betrachten ("HAZ") , da mit der dritten Nummer die Redaktion wechselte und das gesamte Konzept der Zeitung verändert wurde ("haz"). Jede Ausgabe hat 24 Seiten. Die Schrift ist im Vergleich zu anderen Zeitungen, auch den anderen Obdachlosenzeitungen, überdimensional groß, so daß auf jeder Seite etwa ein Drittel der Zeichen Platz finden im Vergleich zu "mob" oder "ZEITDRUCK". Es gibt keine einheitliche Gliederung. Wiederkehrende Rubriken sind: WIE WO WAS, wissenswerte Adressen nicht nur für obdachlose Menschen; NEUES VON HUNNI, Gedichte, Texte und Biographisches von Obdachlosen; FICTION, Kurzkrimis; SÄTTIGUNGSBEILAGE, Satire; KULTUR, Berichte über DIE RATTEN, eine der beiden Berliner Obdachlosentheatergruppen.
Daneben gibt es Berichte über die Obdachlosenzeitungen in Paris -der Herausgeber von "HAZ" publiziert dort eine davon- und Hamburg und Reportagen über Institutionen der Obdachlosenhilfe.
Nachdem die gesamte Berliner Redaktion die "HAZ" verlassen und sich mit "Platte" selbstständig gemacht hatte, erschien die neue "haz" im Juni 94 in etwas veränderter Form. Der Umfang betrug immer noch 24 Seiten. Die Schriftgröße wurde stark reduziert, sodaß mit dem neuen Layout fast doppelt soviele Zeichen auf einer Seite Platz finden im Vergleich zu den ersten beiden Ausgaben. Eine klare, wiederkehrende Gliederung der Zeitung wurde nicht eingeführt. Konstante Bestandteile der Zeitung stellen ein INTERVIEW mit einer prominenten Person (PolitikerIn, Erzbischof, Intellektueller etc.) nicht nur zum Thema Obdachlosigkeit dar, und die BERICHTE VON BETROFFENEN, Gedichte, Biographisches und politische Reflexionen. LITERATUR, klassische als auch aktuelle, und KULTUR, etablierte als auch die "Kultur von unten", nehmen einen großen Stellenwert ein. Die Thematisierung der europäischen Dimension von Wohungslosigkeit fand in den ersten vier Ausgaben der neuen "haz" durchgehend statt. Die Rechte von obdachlosen Menschen, ihre gesellschaftliche, politische und institutionelle Ausgrenzung sowie die gesundheitliche Situation von auf der Straße lebenden Menschen gehören zu den nicht konstant, aber regelmäßig bearbeiteten Themen der Zeitung.
Intention und Konzeption
Nach dem insgesamt gescheiterten "Runden Tisch" vom 19.2.94 kam es zu einer Kooperation zwischen George Mathis aus Paris und Frank K., der schon ein halbes Jahr zuvor mit der Arbeit an einer Zeitung mit dem geplanten Titel "Platte" begonnen hatte. Letzterer begründete dies damit, "daß die "HAZ" und die "Platte" ein übereinstimmendes Konzept hatten"[27]. "mob" sei zu politisch gewesen und "ZEITDRUCK" zu speziell auf Jugendliche zugeschnitten. Sie seien die einzigen dieser vier Projekte gewesen, die sich als "Vertreter der ganz normalen Obdachlosenszene auf der Straße" verstanden, "wo alles eingeschlossen ist: Politik genauso wie Suchtproblematik, aber vor allen Dingen: die Leute sollten selbst schreiben von der Straße, sie sollten nicht von uns immer etwas vorgesetzt bekommen."
Die Zeitung sollte von Obdachlosen und Arbeitslosen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, verkauft werden. Diese sollten dadurch die Möglichkeit erhalten, "aus eigener Kraft ihr Leben zu meistern". Ebenfalls bestand Übereinstimmung darin, daß die Überschüsse direkt den Obdachlosen zugute kommen sollten in Form von Projekten wie Wohnraumbeschaffung. Bezüglich der Verwendung dieser Überschüsse gab es unterschiedliche Auffassungen, die dazu führten, daß diese Zusammenarbeit zwischen Paris und Berlin schon nach zweieinhalb Monaten auseinanderbrach.
Nachdem die "HAZ" zwei Monate auf dem Berliner Markt nicht mehr präsent gewesen war, ging es Sonja K., ehemalige "mob"-Redakteurin und neue "haz"-Chefredakteurin, darum, so schnell wie möglich die nächste Ausgabe herauszugeben.
"Die Zeitung soll vor allen Dingen die Funktion haben, Brücken zu bauen und eine soziale und politische Sicht auf die Dinge von unten nach oben zu transportieren. Also Brücken zu bauen heißt, die Lebensart, wie sie auf der Straße gelebt wird, in aller Härte, aber auch in aller Originalität, möglichst authentisch wiederzugeben und annehmbar zu machen für den sogenannten Normalbürger. Zugleich aber die Bedürfnisse der Leute, die auf der Straße liegen und die Widersprüche, die dazu führen, daß sie nicht von der Straße runterkommen, die zu attackieren und das an Entscheidungsträger in der Politik und Verwaltung zu transportieren, und auch ein bißchen Druck auszuüben." Zudem soll die Zeitung den VerkäuferInnen ermöglichen, zu Geld und einer sinnvollen Arbeit zu kommen, "die sehr viel damit zu tun hat, daß sich Selbstwertgefühl wieder entwickelt und damit auch Chancen eröffnet, daß Leute die Kraft und den Mut finden, den mühseligen Weg über Sozialamt, Arbeitsamt, Wohnungssuche etc. überhaupt nochmal zu gehen."[28]
Im Editorial der ersten von ihr produzierten Ausgabe weist Sonja K. darauf hin, daß sich "haz" besonders jenen am unteren Rand der Wohnungslosen-Szene in Berlin zuwenden will. Es sollen engagierte Mitbürger als auch Lebensansichten von der Straße portraitiert werden. Die "haz" sehe Wohnungslosigkeit als europäisches Problem und will sinnvolle Lösungen aus anderen Ländern und die kulturellen Unterschiede darstellen. Die Überschüsse der Zeitung sollen in den Aufbau einer Wärmestube fließen, die der Redaktion als Hintergrund dienen soll. "Jede Obdachlosenzeitung bietet Chancen für alternativen Journalismus. Als Redakteur eines solchen Blattes wird man auch Sozialarbeiter, lebt ein Stück mit den Menschen mit, über die und für die man schreibt."[29]
Redaktionelles Profil
Das Profil der ersten beiden Ausgaben der "HAZ" zeichnete sich maßgeblich durch die Veröffentlichung von Gedichten und Kurzgeschichten von Betroffenen (jeweils 18%) sowie Catoons und Comics aus (15,2%). Darüberhinaus wurde über Institutionen der Obdachlosenhilfe (10%) und über Kultur (9,5%) berichtet.
Die Schwerpunkte der neuen "haz" verschoben sich zu einer umfangreicheren Berichterstattung über Kultur und Literatur (21,9%) sowie Politik und Gesellschaft (18,6%). Der Anteil an Cartoons und Comics wurde auf ca. ein Fünftel seines vorherigen Umfangs reduziert (3,3%). Die Gedichte und Berichte von Betroffenen nahmen um ca. ein Drittel ab (12,8%) und stellen jetzt eine feste Rubrik dar. Die Darstellung der Lebenssituation von Obdachlosen und Wagenburglern (11,4%) und die Berichte über Obdachlosigkeit in anderen Ländern (6,2%) nahmen um mehr als das Doppelte zu.
Dem Anspruch, "Brücken zu bauen", wird die Zeitung im wesentlichen gerecht. Durch die Berichte der Betroffenen wird für die Leserschaft nicht nur der harte und belastende Alltag der Obdachlosen nachvollziehbar. Darüber hinaus vermittelt die Ironie, der Witz und die selbstkritische Betrachtungsweise der Betroffenen den Lesern einen Eindruck von der Gedanken- und Gefühlswelt dieser Menschen, die durch ihre Obdachlosigkeit ausschlaggebend geprägt wird. Durch die umfangreiche Berichterstattung über Kultur und Politik werden immer wieder Verbindungslinien zwischen den Unbehausten und den Behausten gezogen, wodurch deutlich gemacht wird, daß Obdachlosigkeit ein gesellschaftliches Problem darstellt, dessen Brisanz eher zunehmen und somit Bevölkerungsgruppen tangieren wird, die bisher davon verschont geblieben sind.
PLATTE
Struktur
Die erste "HAZ"-Radaktion gab am 1.5.94 die erste Ausgabe der "Platte" heraus, bis zum 9.12.94 sind zwölf Ausgaben erschienen.
Die 24-seitige Zeitung erschien anfangs monatlich, mit der fünften Ausgabe wurde auf einen vierzehntägigen Erscheinungsturnus umgestellt. Seit der zehnten Ausgabe hat die Zeitung einen Umfang von 32 Seiten.
Die ersten Ausgaben der "Platte" ähnelten vom Erscheinungsbild und Aufbau den ersten beiden Ausgaben der "HAZ". Neben dem zunehmend ausführlicheren Adressenservice, der Berichterstattung über Institutionen der Obdachlosenhilfe sowie Gedichten und Berichten von Betroffenen nehmen Comics, fiktive Kurzgeschichten und Märchen und insbesondere Selbstdarstellungen der Zeitung großen Raum ein. Lezteres ist darin begründet, daß der Verein, dem die Überschüsse der Zeitung zufließen, Wohnprojekte in Selbsthilfe für obdachlose Menschen aufzubauen versucht, und diese Entwicklung, mit den damit verbundenen Problemen, in jeder Ausgabe thematisiert wird.
Nachdem mit der fünften Ausgabe das äußere Erscheinungsbild etwas verändert worden war, womit auf einen inhaltlichen Schwerpunkt der Ausgabe hingewiesen wurde, erschien die elfte in gänzlich neuem Layout. Strukturiert wurde die Zeitung nun durch die Rubriken Soziales, Platte intern, Berichte/Interview, Adressen, Kostenfreie Anzeigen und Leserbriefe.
Intention und Konzeption
Die Konzeption der "Platte" hat sich durch die Trennung von der "HAZ" nicht wesentlich geändert. Auffallend ist allerdings, daß in den Darstellungen und Begründungen des Wechsels und Neubeginns die Herausgabe der Zeitung eher als Mittel zum Zweck verstanden wird. "Gründung einer Verlags GmbH als Wirtschaftsträger mit der Aufgabe, im Sinne eines Dienstleistungsbetriebes die erforderlichen Publikationen herzustellen, somit dem Verein ein Produkt zur Verfügung zu stellen, das wiederum den Verein in die Lage versetzt, für die Betroffenen die Grundlage zu schaffen, aus eigener Kraft, Motivation und Eigeninitiative ihre Wertsituation zu verbessern." Dieser Verein soll Soforthilfe leisten und weiterführende Hilfe anbieten, Mittel, Möglichkeiten und Gelegenheiten bereitstellen, "die geeignet sind, Menschen in Notsituationen zur Selbsthilfe zu befähigen, dies auch in dem Sinne, Betroffene nach dieser Befähigung weiter zu betreuen."
Das Konzept sieht weiter vor, daß eine Gemeinde gegründet werden soll als Grundlage für die Arbeit des Vereins bzw. der GmbH. Alternativ dazu sei "auch die Neubelebung eines niederliegenden Objekts der Wirtschaft oder auch die Restaurierung eines Objekts des Denkmalschutzes möglich."
Die publizistische Arbeit hat das Ziel, "der Bevölkerung unseres Landes unsere Absichten offenzulegen."[30] Ein bis zwei "richtige Artikel" sollen in jeder Ausgabe erscheinen, "der Rest ist ja eigentlich nur aus dem Herz und dem Bauch Geschriebenes, so Erlebtes halt."[31]
Redaktionelles Profil
Aufgrund der Konzeption ist es wenig verwunderlich, daß die Berichterstattung über "Internes" mehr als 20% der Zeitung beansprucht, da "Platte" die Überschüsse unmittelbar in weiterführende Hilfe umzusetzen sucht und diese Versuche ausführlich darstellt. Ebenso auffällig ist der sehr große Serviceteil von 11,7%, wo entweder kostenlose Anzeigen von gemeinnützigen Projekten oder Adressen von Wärmestuben, therapeutischen Wohngemeinschaften, Notunterkünften, speziellen Einrichtungen für Frauen und Jugendliche usw. veröffentlicht werden.
Gedichte und Biographisches von Betroffenen (10,9%), Märchen und fiktive Geschichten (10,9%), Darstellungen von Institutionen der Obdachlosenhilfe (10%) sowie politischer und gesellschaftlicher Dimensionen (8,7%) bestimmen den Rest der Zeitung. Die Thematisierung der Lebenssituation der Betroffenen (3,5%) findet bei "Platte" mehr durch die Selbstdarstellungen von obdachlosen Menschen statt als durch Beschreibungen der Strukturen und allgemeinen Bedingungen.
"Platte" verstand sich von Anfang an als "Vertreter der ganz normalen Obdachlosen-Szene auf der Straße" und wollte diese zu Wort kommen lassen, was auch ausführlich praktiziert wurde. Das redaktionelle Profil veränderte sich im Laufe der Zeit. Dem authentischen O-Ton von Betroffenen wurden Berichte über Institutionen der Obdachlosenhilfe zugefügt, Interviews mit dort Tätigen und seit der 9. Ausgabe wurden regelmäßig Auszüge aus dem Buch "Armut in Deutschland", dem sog. Armutsbericht vom DGB und DPWV, abgedruckt. "Platte" ist politischer geworden und hat den Anteil der Berichterstattung über die Zeitung und ihre Projekte in den letzten Ausgaben etwas reduziert, was Raum geschaffen hat für andere Themen, womit sie insgesamt interessanter geworden ist.
ZEITDRUCK
Struktur
Am 1. Mai 1994 erschien die erste eigenständige Ausgabe von "ZEITDRUCK", dessen Umfang 24 Seiten beträgt. Es gibt keine festgelegte Gliederung, dennoch existieren mehrere durchgängige Rubriken bzw.Themen.
In der Rubrik "geschichten" berichten Jugendliche über ihr Leben: Gewalt in der Familie, Flucht, Leben auf der Straße, im Heim und vieles mehr. In den ersten drei Ausgaben wurde jeweils ein Interview mit einem/r MitarbeiterIn einer Institution, die mit Jugendlichen arbeiten, abgedruckt. Die internationale Dimension von Obdachlosigkeit findet kontinuierlich ihren Niederschlag, überwiegend in Form der Übernahme von Berichten aus polnischen, russischen, italienischen oder südamerikanischen Obdachlosenzeitungen, aber auch durch eigene Berichterstattung. Auf der Lyrikseite werden Gedichte von Jugendlichen veröffentlicht, und "zeck", die Kinderseite, zeichnet sich durch Rätsel, Comics und kurze Texte aus. Ein Bericht oder eine Dokumentation von "amnesty international" über die Unterdrückung und Verfolgung von Menschen in anderen Staaten gehört zum durchgängigen Repertoire der Zeitung. Die Vorstellung von sozialen Projekten für Kinder und Jugendliche findet sich ebenso in jeder Ausgabe wie die Abteilung "tips & tricks", in der die Erfahrungen von jungen Menschen mit staatlichen Sozialbehörden wiedergegeben und somit Rechte als auch Unzulänglichkeiten thematisiert werden.
Ab der zweiten Ausgabe gibt es drei zusätzliche Themen, die fortsetzend behandelt werden. Zum einen ist das die Serie "Neues aus der Pfarrstraße". In der Pfarrstraße gab es mehrere besetzte Häuser, in denen immer noch viele Jugendliche, jetzt in legalisierter Form, leben. In jeder Folge berichtet ein Jugendlicher über sein Leben dort und vorher, über Politik und das Leben im allgemeinen. Das Thema "Knast" bestimmt die beiden anderen neuen Rubriken. Unter der Überschrift "'Ich kam mir vor wie 'n Tier' - Knast in DDR" wird aus dem gleichnamigen Buch von Torsten Heyme der Dialog zwischen dem Autor und einem Gefangenen in Fortsetzungen abgedruckt. In der zweiten Reihe zum Thema berichten Jugendliche aus Jugendstrafanstalten bzw. Untersuchungsgefängnissen.
Seit Ausgabe Nr.4 gibt es in "Zeitdruck" "DOMPLATT": die Zeitung von Straßenkindern aus Köln veröffentlicht auf vier Seiten ihre Texte.
Intention und Konzeption
MitarbeiterInnen von Jugendfreizeiteinrichtungen haben 1990 "KARUNA - Freizeit ohne Drogen Int. e.V." gegründet. Dieser Verein betreibt verschiedene Projekte im Ostteil der Stadt, die im Vorfeld von Drogenabhängigkeit tätig werden.
Die "BLEIBE" ist seit März '93 Erstanlaufstelle für nichtseßhafte Kinder und Jugendliche in Friedrichshain. Hier wird versucht, den Jugendlichen bei ihrer Lebensplanung zu helfen. Dazu gehört seit Mai '94 die Herausgabe und der Verkauf von "ZEITDRUCK". Die "VILLA STÖRTEBECKER" ist ein Wohnprojekt mit sechs Wohnungen für minderjährige Drogen und Suchtgefährdete. "DRUGSTOP" wurde im März '93 als drogen- und alkoholfreies Cafe' in Lichtenberg eröffnet: Kieztreff, Veranstaltungsort für Kleinkunst und Ausstellungen, Kino, Beratungsstelle sowie Nachbetreuung für Kinder und Jugendliche aus der "VILLA". Die "NESTWÄRME" ist Anlaufstelle für gefährdete Jugendliche im Prenzlauer Berg. Dort gibt es Hilfe zur Erziehung, Freizeitarbeit und Beratung.[32]
Innerhalb des Vereins gab es Einrichtungen für Freizeit und Wohnen für die Jugendlichen, aber keine Angebote bezüglich Arbeit. Nach dem erfolgreichen Start von "Hinz & Kunz(t)" in Hamburg unterbreitete Claudia S. Anfang '94 den Jugendlichen in der "BLEIBE" die Idee, etwas ähnliches ebenfalls zu versuchen, was eine positive Resonanz hervorrief. Claudia S. ist Mitbegründerin von "KARUNA", Projektleiterin der "BLEIBE" und verantwortliche Redakteurin von "ZEITDRUCK".[33]
Die Intention war, daß die Jugendlichen ihre Probleme mit Schule, Eltern, Drogen, Obdachlosigkeit und vieles mehr selbst öffentlich machen, und diese nicht mehr nur durch die etablierte Presse dargestellt werden. Es ging darum, sich zu artikulieren, die Ausgrenzung aufzubrechen und die Problematik der Jugendlichen "dem Bürger" zu vermitteln. Diese Artikulationsmöglichkeit als sozialpädagogisches Mittel sollte zweierlei bewirken: einerseits Spaß an der Arbeit und Erfolgserlebnisse angesichts der gedruckten Eigenproduktionen, andererseits über diese Arbeit eine stärkere Auseinandersetzung mit der eigenen Situation. Zudem könnten sie durch den Zeitungsverkauf legal Geld verdienen.
Die Konzeption der Zeitung wurde von Anfang an mit den Jugendlichen zusammen entwickelt, Vorgaben vom Herausgeber gab es nicht. Die Redaktionssitzung war (und ist) das Beschlußgremium, das den Namen, den Inhalt und die Form festlegte. In der Zeitung sollten unzensiert die Lebensgeschichten der nichtseßhaften Jugendlichen, ihrer Ideen und Probleme veröffentlicht werden. Selbst durchgeführte Interviews, eigene Texte, Fotos und Comics waren geplant sowie ein kleiner Kulturteil beispielsweise in Form eines Interviews mit einer Musikgruppe. Die Zeitung soll "unsere Lebenswelt widerspiegeln".[34]
Texte von Prominenten zum Thema, wie ursprünglich angedacht, wurden in Anbetracht der Fülle des Materials, das von Jugendlichen geliefert wurde, nicht mehr veröffentlicht.
Redaktionelles Profil
Drei thematische Schwerpunkte fallen bei "ZEITDRUCK" besonders deutlich auf. Die Darstellungen der Lebenssituationen von obdachlosen Jugendlichen nehmen mit 17,1% den meisten Raum ein, was mit den vier Seiten von "DOMPLATT" zu erklären ist, beliefe sich der Faktor für diese Kategorie ansonsten auf 9,5%. Die Berichterstattung über Obdachlosigkeit in anderen Ländern nimmt mit 16,7% ebenso einen überdurchschnittlichen Stellenwert im Vergleich mit den anderen Zeitungen ein wie die Thematisierung der Aspekte Sucht, Gefängnis und Heime (12,4%), wobei letzteres aufgrund der Minderjährigkeit nur junge Menschen betreffen kann und somit für die Zeitung von Interesse ist. Infolge des inhaltlichen Konzepts nehmen die Artikel für und über Kinder ebenfalls relativ viel Raum mit 6,7% in Anspruch.
Die Intention der Herausgeber, daß die Jugendlichen ihre Probleme selbst darstellen, haben diese ausführlich und interessant erfüllt. Der Titel 'Obdachlosenzeitung' erscheint für diese Publikation allerdings zu eng gefaßt, wurden doch bisher Themen angesprochen, die über diesen Problembereich weit hinausgehen. Die breite thematische Palette läßt eher den Schluß zu, daß sich hier Jugendliche äußern, die mit den gesellschaftlichen Sozialisationsinstanzen nicht klarkommen, die sich in den Drogenkonsum flüchten, die ein Leben ohne Zuhause einem gewalttätigen vorziehen und somit zumindest teilweise nichtseßhaft sind. Die autobiographischen Berichte aus Heimen und Jugendstrafanstalten unterstreichen nochmal diese Ausrichtung, daß sozial benachteiligte und ausgegrenzte Jugendliche hier ein Sprachrohr etabliert haben, immer mit dem Blick über den Tellerrand, die Situation von Kindern und Jugendlichen in vergleichweise drastischeren Verhältnissen in anderen Ländern miteinbeziehend.
6. ENTWICKLUNGSSKIZZEN
Am 19. Februar 1994 gab es ein Treffen im "Haus der Demokratie", den "Runden Tisch Obdachlosenzeitung", an dem alle teilnahmen, die an der Herausgabe einer Obdachlosenzeitung in Berlin arbeiteten. Anwesend waren George Mathis mit zwei Leuten aus Paris ("HAZ","Le Reverbere"), Frank K. mit Kollegen ("Platte"), Sonja K. und einige MitarbeiterInnen von BIN ("mob") und Claudia S. mit einigen Jugendlichen ("ZEITDRUCK"), insgesamt etwa zwanzig Personen.
Im Verlauf der Diskussion, in der ausgelotet werden sollte, ob ein gemeinsames Zeitungsprojekt dieser Gruppen möglich sei, wurden die unterschiedlichen und unvereinbaren Vorstellungen und Konzepte immer deutlicher. Nachdem George Mathis abschließend 30 Exemplare der ersten "HAZ" auf den Tisch legte, war das Scheitern dieses Treffens offensichtlich. Dennoch entstand daraus eine zeitlich befristete Zusammenarbeit zwischen "HAZ" und "Platte" einerseits, sowie "mob" und "ZEITDRUCK" andererseits, dessen Vorbereitungen und Entwicklungen ich hier skizzieren will.
Diese Beschreibungen sollen verdeutlichen, inwieweit die Mitarbeit von Betroffenen stattfand und in welchen Bereichen sie praktiziert wurde. Desweiteren können die Angaben über Verkaufszahlen und Überschüsse sowie deren Verwendung Aufschluß darüber geben, ob diese Zeitungen als profitable Unternehmungen realisiert wurden oder als Projekte, die den Obdachlosen direkt zu Gute kommen.
Auch hier fällt die Darstellung von "mob" wesentlich umfassender aus. Die Zeitung unterschied sich anfangs konzeptionell von den anderen dadurch, daß versucht wurde, einen hohen Anspruch an politischer Berichterstattung und professioneller Gestaltung zu realisieren, woraus sich die konflikthafte Entwicklung zum Teil erklärt.
Die Vorstellung der InitiatorInnen bzw. verantwortlichen RedakteurInnen, ihrer Motivation und ihres Selbstverständnisses, ist notwendiger Bestandteil, um die Unterschiedlichkeit der Zeitungen und ihrer Entwicklungen nachvollziehbarer zu machen.
mob
Die RedakteurInnen
Vera R.[35], Diplom-Politologin, hatte sich schon vorher auf den Posten einer Redaktionsassistentin fürs BINFO beworben und arbeitete bei BIN an der "mob"-Gründung als erste der zukünftigen Redaktion mit. Sie hatte bereits während des Studiums beim DGB Bildungsarbeit mit Jugendlichen gemacht und erfuhr dort von einer anderen Mitarbeiterin, die Kontakte zu BIN hatte, daß der Verein eine Redakteurin suchte.
Auf ihrer ersten Vereinssitzung bemerkte Vera R. ein gewisses Maß an Konzeptionslosigkeit. Einerseits schafften sie es nur mit Mühe durch die ehrenamtliche Arbeit im Verein circa vierteljährlich das BINFO herauszugeben, andererseits waren sie so begeistert von "Hinz & Kunz(t)" in Hamburg, daß sie etwas ähnliches in Berlin ebenfalls auf den Weg bringen wollten. Nur wollte der Vorstand dafür kein Geld ausgeben. Sie fuhr Anfang '94 mit einer anderen Mitarbeiterin nach Hamburg, um Informationen über die Vorbereitung, den Anlauf, die Schwierigkeiten und die Kosten des Projekts aus erster Hand zu bekommen. Das Ergebnis dieser Unterredung war, daß die wichtigsten Voraussetzungen genügend Startkapital und feste MitarbeiterInnen sind. Das war dem Vorstand zwar auch klar, nur glaubte der, diese Arbeit auch auf ehrenamtlicher Basis realisieren zu können. Durch die Zuweisung der 100.000,- DM aus dem Bußgeldfond war die erste der Voraussetzungen erfüllt, mit der dann auch die zweite geschaffen werden konnte.
Vera R. beschrieb sich selbst so, daß sie keine besondere Qualifikation zur Herstellung einer solchen Straßenzeitung hatte. Das stellte aber für sie insofern kein Problem dar, da zu dem Zeitpunkt gar nicht klar war, wie das Konzept dieser Zeitung aussehen wird. Darüber hinaus glaubte sie aufgrund ihrer Ausbildung zur Politologin Artikel schreiben, Recherche anstellen und sich kurzfristig in ein Thema einarbeiten zu können. Hierzu stellte der Verein bzw. dessen MitarbeiterInnen ein Potential an Wissen und Erfahrung zum Thema Obdachlosigkeit dar, das es für die Zeitung nutzbar zu machen gelte. Sie fühlte sich allerdings nicht kompetent, ein solches Projekt aufzubauen, da ihr jegliche dazu notwendigen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse fehlten. Ihre hauptsächliche Motivation diese Stelle anzutreten, bestand in der Notwendigkeit, einen Job zu finden. Konkrete Ziele verband sie nicht mit dieser Arbeit.
Lars F.[36] hatte einige Semester Theaterwissenschaft, Theologie und Politologie studiert und während seines Studiums ASTA-Politik betrieben, wobei Öffentlichkeitsarbeit sein Schwerpunkt war. Er sagte von sich, daß er gerne schreibe und Öffentlichkeitsarbeit mache und sich darin auch kompetent empfinde. Seinen Lebensunterhalt bestritt er durch Jobs als Buchhalter in verschiedenen Firmen. Seit '89 war er in der Gewerkschaft engagiert: Sozial- und Jugendpolitik waren dort die Schwerpunkte. Über die Bekanntschaft mit einer Frau von BIN e.V. kam er zu dem Redaktionsposten bei "mob". Er sollte eigentlich hauptsächlich für die betriebswirtschaftliche Seite des Zeitungsprojekts zuständig sein. Über seine Tätigkeit im Bereich Sozialpolitik bei der Gewerkschaft war ihm das Thema Obdachlosigkeit zwar nicht unbekannt, dennoch war er kein "Experte". Seine Motivation, sich um diese Stelle zu bemühen, lag zum einen in der Überdrüssigkeit, die er für seine bisherige Tätigkeit empfand. Zum anderen stellte die Sozialpolitik, und hierbei besonders das Verhältnis von Sozial- und Gesellschaftspolitik, einen Interessensschwerpunkt seinerseits dar. Sein Ziel war, einer breiten Leserschaft transparent zu machen, daß Obdachlosigkeit eine logische Konsequenz der hiesigen Politik darstellt. Nach seinem politischen Selbstverständnis geht es darum, "an allen Rändern, wo es nur geht, zu versuchen, irgendeine Form von Widerstand zu mobilisieren und zu organisieren. Und ob ich das jetzt als Betriebsrat mache oder in der gewerkschaftlichen Jugendarbeit oder bei einer Obdachlosenzeitung, der Grundbezugsrahmen bleibt überall relativ gleich und da bleibt auch immer eine Distanz."[37]
Sonja K.[38], die einzige der Redaktion aus der ehemaligen DDR, kam über einen Freund mit der Mahnwache von Obdachlosen am Rosa-Luxemburg-Platz im Oktober '93 in Kontakt. Sie hatte in der DDR Philosophie studiert und ging 1985 im Zuge der Ära Gorbatschow in die Partei, die sie drei Jahre später wieder verlassen mußte. Während der Wende arbeitete sie in der Vereinigten Linken und in der PDS. In diesen zwei Jahren von '90 bis Ende '92 verlor sie alle ihre politischen Vorstellungen und Illusionen was die Wende betraf. Ende '91 trat sie aus der PDS aus. Darüberhinaus war sie von der West-Linken absolut enttäuscht. Sie hatte für die PDS zur Bundestagswahl kandidiert und in Niedersachsen Wahlkampf betrieben. Einerseits erlebte sie die Westlinken als destruktiv, sich gegenseitig zerfleischend. Andererseits war sie mit einem enormen Maß an Unwissen über die DDR konfrontiert, was aber nicht die guten Ratschläge ausschloß, wie die Linke zu dem damaligen Zeitpunkt die Revolution voranzutreiben hätte. Nach diesen vielen politischen und im Gefolge auch persönlichen Krisen hatte sie zum ersten Mal wieder das Gefühl, eine sinnvolle Arbeit zum Thema Obdachlosigkeit leisten zu können. Sie führte viele Gespräche mit Obdachlosen, bewegte sich oft in der Szene und fand insofern eine Nähe zu den Leuten, als sie die Angst, in dieser Gesellschaft "kein Bein mehr auf die Erde zu bekommen", mit ihnen teilte. Weihnachten '93 gab es in der "taz" eine vierseitige Beilage zum Thema Obdachlosigkeit. Die "taz" hatte sich mit ihr in Verbindung gesetzt und sie erstellte mit Obdachlosen und einer anderen nicht-obdachlosen Person diese Beilage. In diesem Kreis entstand dann die Idee einer regelmäßigen journalistischen und publizistischen Zusammenarbeit zu diesem Thema.
Ende Januar '94 traf Sonja K. auf George Mathis aus Paris, der ihr eine Zusammenarbeit anbot für die Herausgabe einer Berliner Obdachlosenzeitung. Sie lehnte ab, weil es ihr journalistisch nicht machbar erschien, eine Zeitung von Paris aus für Berlin herauszugeben. Parallel dazu setzte sich BIN mit ihr in Verbindung und nach einem Gespräch sagte sie ihre Zusammenarbeit zu.
Sonja K. wollte mit einer solchen Zeitung die Vereinzelung in der Szene aufbrechen, die mangelnde Kommunikation untereinander verbessern und politische Forderungen formulieren, die die Betroffenen aus ihrer eigenen Erfahrung ableiten können. Zudem wäre es für viele eine Möglichkeit, sich finanziell halbwegs abzusichern.
Die Vorbereitungen
Am 01. Februar gab es ein Treffen bei BIN, wo sich zum ersten Mal die drei zukünftigen RedakteurInnen begegneten. Ein Ergebnis hiervon war, daß sich die Redaktion sobald wie möglich zusammensetzen und ein Konzept entwerfen sollte. Der Vorstand legte fest, daß man so schnell wie möglich handeln müsse, weil George Mathis kurz vor der Herausgabe einer Berliner Straßenzeitung stehe. Diese Vorgehensweise wurde auch von Lars F. unterstützt und forciert: "entweder sofort los oder gar nicht".[39]
Am 5.Februar kamen die RedakteurInnen und zwei Vereinsmitarbeiter zusammen, um konkreter und detaillierter die nächsten Schritte und den weiteren Ablauf zu bestimmen. Von Vereinsseite wurden aber laut Vera R. ausschließlich formale und organisatorische Fragen angeschnitten, so daß die inhaltliche und konzeptionelle Debatte viel zu kurz kam. Erst zum Schluß wurde quasi stichwortartig der inhaltliche Entwurf diskutiert. Die Hamburger hatten bei dem Besuch vier Wochen zuvor empfohlen, nicht im Sommer, sondern im Winter mit einer solchen Zeitung zu starten. Auf diesen Einwand, dessen Berücksichtigung eine Vorbereitungszeit von einem halben Jahr bedeutet hätte, entgegneten die Vereinsmitarbeiter, daß dafür kein Geld vorhanden sei, und daß die Herausgabe der "HAZ" unmittelbar bevorstehe. "(...) die "HAZ" kam raus, (...) und wenn die erstmal die Plätze besetzen, dann sieht 's schlecht aus für die "mob". Also- haben wir die rausgepowert."[40]
Für den 10. Februar wurde zu einer öffentlichen Versammlung aufgerufen, auf der abrißartig das Konzept und der weitere Fahrplan dargestellt und zu Mitarbeit und Unterstützung aufgerufen wurde. Es wurden Folgetreffen angeboten für diejenigen, die der Zeitung in Form von Artikeln, Gedichten, Bildern o.ä. zuarbeiten, und solchen, die den Vertrieb und Verkauf mit aufbauen wollten. Ersteres entwickelte sich in der Folgezeit zur monatlich stattfindenden öffentlichen Redaktionssitzung und letzteres zum kontinuierlichen Vertriebstreffen.
Auf einer Pressekonferenz am 18.2.94 wurde das baldige Erscheinen von "mob" öffentlich angekündigt. Sonja K. hatte für eine Verschiebung der Pressekonferenz plädiert, um einer möglichen Kooperation, als potentielles Resultat des "Runden Tisches Obdachlosenzeitungen" am 19.2., nicht durch vollendete Tatsachen eine Absage zu erteilen. Für den Vereinsvorstand war eine Zusammenarbeit mit der "HAZ" nicht möglich, "schon allein aufgrund der Tatsache, daß die "HAZ" von einer französischen Obdachlosenzeitung aufgebaut wurde, die ihrerseits von französischen Faschisten gesponsert wurde.[41] (...) Unsere Pressekonferenz am 18.2. hat in der Tat damit zu tun, daß wir uns nicht von der "HAZ" das Wasser abgraben lassen wollten. Die "HAZ" kam bereits mit einer fertigen Zeitung aus Paris in Berlin an und hatte bereits vor uns ihre PR-Arbeit begonnen (Interview in Radio 100,6)."[42]
Bis zum Erscheinen der ersten Ausgabe einen Monat später mußten nicht nur die organisatorischen Notwendigkeiten geregelt werden (Einrichtung der Büroräume, Suche von Verkäufern etc.), die Redaktion hätte auch innerhalb kürzester Zeit ein Konzept für die Zeitung erstellen müssen, das von allen RedakteurInnen getragen wurde. Diese konzeptionelle Diskussion ist nach rückblickender Einschätzung der RedakteurInnen mindestens viel zu kurz gekommen bzw. ganz unterblieben.
Mitarbeit der Betroffenen
Ohne hinreichende inhaltliche Vorbereitung, was sowohl das Konzept für die Zeitung an sich betraf, als auch das Projekt insgesamt, also die Zusammenarbeit mit Betroffenen und deren Stellenwert und Einflußmöglichkeiten sowie der Aufbau eines Vertriebsnetzes, aber mit der Einschätzung, daß "wir drei inhaltlich eine relativ ähnliche Ausrichtung hatten"[43], die mit "sozialkritisch und links"[44] charakterisiert wurde, begann die Redaktion die Arbeit an der ersten Ausgabe. Trotz stark reduzierter Konzeptdiskussion kann man die Presseerklärung vom 18.2.1994 als quasi offizielles Konzept der Zeitung verstehen. Der Entwurf dieser Erklärung stammte von Sonja K., überarbeitet wurde er von Lars F. und von der gesamten Redaktion getragen. Wesentlich für die konzeptionelle Frage der Zusammenarbeit mit Obdachlosen erscheint mir folgender Auszug:
"...- werden Wohnungslose dieses Magazin entscheidend mitgestalten: von der Recherche bis zum Vertrieb. Drei RedakteurInnen sind in der Aufbauphase mit der Unterstützung, Vernetzung und Koordination der redaktionellen und an den Vertrieb gebundenen Arbeit der Wohnungslosen betraut."[45]
In der Praxis wurde eine Zusammenarbeit mit Betroffenen insofern versucht, als daß häufig Obdachlose in der Redaktion anwesend waren, die sowohl Teile ihrer Biographie darstellten als auch Vorstellungen bezüglich der Zeitung. Diese Berichte und Beschreibungen erschwerten aufgrund des generellen Zeitdrucks die innerredaktionelle Verständigung. Bezogen auf die Frage, eine Zeitung mit oder für Obdachlose zu produzieren, stellte sich der Alltag so dar, daß "dieses 'mit' eigentlich praktiziert wurde, aber dann wiederum auch nicht. Es wurde praktiziert dadurch, daß sie ständig anwesend waren, aber letztendlich auch nicht praktiziert, weil keine Entscheidungen mit ihnen zu fällen waren. Es war schier unmöglich."[46] Unter anderem deswegen, weil immer wieder andere Betroffene anwesend waren. Es gab keine Strukturen oder Kontinuitäten.[47] Erschwerend kam hinzu, daß die Redaktions- und Vertriebsräume nebeneinander lagen, so daß eine strikte räumliche Trennung unmöglich war. Das Kommen und Gehen der VerkäuferInnen sowie die Tatsache, daß die Vertriebsräume zunehmend den Charakter eines sozialen Treffpunkts, incl. Dusch-, Koch- und Waschgelegenheit, annahmen, war zwar prinzipiell nötig für die Betroffenen, der Arbeitsfähigkeit der Redaktion war es aber eher abträglich.
Lars F. bewertete im Nachhinein die Presseerklärung nicht als Konzept. Sie sei "mit der heißen Nadel gestrickt" und zu dem Zeitpunkt eine "wohlwollend idealistische Darstellung, wie wir es gerne gehabt hätten. Ich glaube, wenn ich die ersten zwei Wochen, die nach der Pressekonferenz kamen an täglicher Realität, da in den Räumen, schon hinter mir gehabt hätte, wäre mir so ein Satz nie mehr aus der Feder geflossen."[48]
Für Sonja K. stellte die Presseerklärung "keine Worthülse" dar. Sie sei nicht bis in die Feinheiten ausdiskutiert worden, es sei ein "intuitiver Anspruch" gewesen, der auch ihrer Meinung nach von allen ernst und ehrlich gemeint war. In der praktischen Arbeit habe sich dann erst herausgestellt, daß alle etwas anderes damit verbanden. Sie wollte die Fragestellungen, die von den Betroffenen aufgeworfen wurden, verfolgen, und zudem ein Mitsprache und Vetorecht für obdachlose MitarbeiterInnen in den Redaktionssitzungen.[49]
Einen weiteren, dauerhaften Konflikt verursachten die unterschiedlichen Ansprüche bezüglich der Texte, die gedruckt werden sollten. Die Vorstellungen von Lars F., wie Texte aufgebaut sein und aussehen sollten und ob sie seinem Verständnis davon entsprächen, was politisch ist und was nicht, führten laut Vera R. dazu, daß er Artikel sowohl von Obdachlosen als auch anderen überarbeitete und teilweise zusammenstrich.
"Ich finde das ganz schwierig, nicht für jede Zeile in der Zeitung geradestehen zu können."[50]
Von einer ansatzweisen gleichberechtigten redaktionellen Mitarbeit der Betroffenen konnte also keine Rede sein. Das drückte sich auch dadurch aus, daß nur ein oder zwei Betroffene an den Redaktionssitzungen teilnahmen und sie somit im Vergleich zur Redaktion, der Herausgeber und freien Mitarbeiter eine Minderheit darstellten.
Die Erfahrungen der Arbeit an der ersten Ausgabe,die dann am 18.3. erschienen ist, haben also deutlich unterschiedliche redaktionelle und konzeptionelle Vorstellungen zu Tage treten lassen. Die Idee einer 'Auszeit' für die tägliche Zeitungsarbeit zur Durchführung einer nachträglichen Konzeptionsdiskussion scheiterte aber immer an den 'Sachzwängen'. Einerseits mußte die nächste Ausgabe unbedingt rechtzeitig erscheinen, um den Vertrieb aufzubauen und zu stabilisieren, andererseits ging es darum, im Konkurrenzkampf mit der "HAZ" zu bestehen. "Wir waren eh immer froh, wenn wir überhaupt mal eine halbe Stunde Ruhe hatten."[51] In diesen kurzen Zeitabschnitten sei es dann ausschließlich darum gegangen, was als nächstes geregelt werden müsse und wann die Redaktion die nötige Zeit für ihre interne Klärung finden könne.
Zusammenarbeit von Redaktion und Herausgeber
In den Sitzungen der Redaktion mit dem Vorstand wurden laut Vera R. ebenfalls nur organisatorische und arbeitstechnische Fragen thematisiert. Ein Resultat davon war, daß die Redaktion nach der ersten Ausgabe auch den Vertrieb organisieren mußte, was dann so aussah, daß sie neben der redaktionellen Arbeit von morgens bis abends und auch am Wochenende die Zeitungen an die StraßenverkäuferInnen ausgegeben haben. Der Vertrieb wurde zu dem Zeitpunkt noch nicht in die Hände von obdachlosen MitarbeiterInnen gelegt, weil es noch keine gab, die diese Aufgabe auch hätten bewältigen können. Grundsätzlich sollte jemand bei der Ausgabe der Zeitung anwesend sein, um einen Überblick über die Verkaufszahlen zu bekommen. Desweiteren war zunächst unklar, wie der Vertrieb aussehen sollte. Ein anderes Problem, das eigentlich im Vorfeld der Gründung von "mob" hätte geklärt werden müssen, bestand in einer Vereinbarung mit der BVG bezüglich der Genehmigung des Zeitungsverkaufs in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln.
Nebenbei zogen sich über längere Zeit schwierige Verhandlungen zwischen Vorstand und Redaktion über ihre Arbeitsverträge. Außerdem bemängelten die RedakteurInnen die langwierigen und zeitaufwendigen Verhandlungen wegen der Anschaffung notwendiger Arbeitsmittel wie z.B. Computer.[52]
Der Vorstand hatte grundsätzlich die Vorstellung, "in einem Team zusammen mit den RedakteurInnen, VerkäuferInnen und SchreiberInnen konstruktiv und kooperativ zusammenzuarbeiten."[53] Die RedakteurInnen beschrieben demgegenüber einen Grundkonflikt, der darin bestand, daß sie angehalten worden seien, mit den AutorInnen des bisherigen BINFOs zusammenzuarbeiten bzw. ihre noch unveröffentlichten Texte in "mob" zu drucken. Dieser Konflikt "war zum überwiegenden Teil etwas sehr Unterschwelliges, eher Atmosphärisches. Es hat einzelne Knalleffekte gegeben an bestimmten Punkten."[54]
Auch hier hat es keine genügende Auseinandersetzung und Absprache darüber gegeben, wo die Kompetenzen des einen enden und die des anderen beginnen. Die Vorstellung des Herausgebers, in einem Team zusammenarbeiten, erschien angesichts dieses 'Experiments Obdachlosenzeitung' verständlich, vernachlässigte aber die funktionale Arbeitsteilung in diesem Projekt, wo der Herausgeber zwar Arbeitgeber ist und die notwendigen entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, aber gleichzeitig die Gratwanderung zwischen Respektierung der redaktionelle Autonomie und Erfüllung der konzeptionellen Ziele des Projekts gewährleisten muß.
Innerredaktionelle Konflikte
Im Zuge der weiteren Arbeit spitzten sich die gegensätzlichen konzeptionellen Vorstellungen zwischen Lars F. und Sonja K. dahingehend zu, daß ersterer keine Motivation mehr verspürte, mit den Betroffenen zusammenzuarbeiten, während letztere nach dem Motto verfuhr: "jeder kann kommen". Hinzu kamen drastische Differenzen in Bezug auf den Arbeitsstil. Während Lars F. wie ein "Buchhalter" Arbeitszeiten und Sitzungstermine festlegte, handhabte Sonja K. solche Verabredungen mit extremer Unverbindlichkeit. "Das prallte natürlich auch ständig aufeinander und mündete dann in dem Streß, daß keine Artikel von Sonja kamen oder zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie kommen sollten."[55] In der zweiten Ausgabe gab es aufgrund dieser innerredaktionellen Arbeitsschwierigkeiten kein Schwerpunktthema.
Die Beantwortung der Frage, warum diese Probleme nicht geklärt werden konnten, blieb letztlich unbefriedigend. Erklärend wurde von allen RedakteurInnen die ungenügende konzeptionelle Diskussion im Vorfeld und der enorme Zeit- und Konkurrenzdruck angeführt, der keinen Raum für interne Klärungsprozesse zuließ. Darüberhinaus schottete sich die Redaktion sowohl gegenüber dem Herausgeber als auch den Betroffenen bezüglich dieser Konflikte überwiegend ab, was im Nachhinein als Fehler eingeschätzt wurde.[56]
Sonja K. war thematisch für die "Szene" verantwortlich (Recherche, Kontakte etc.). Unabhängig davon, daß "es zuviel war" und sie sich damit überforderte, hielt sie diese zeitlich sehr aufwendige Arbeit aber für notwendig, da eine gewisse Anpassung an den "Rythmus der Szene" zur authentischen Berichterstattung unumgänglich sei. Aus diesem Grunde kam sie zu der nachträglichen Aussage, daß sie "eher damit leben kann, daß man 'ne Zeitung um eine Woche verschiebt, als daß man so arbeitet, daß man sie nur füllt."[57]
Nach dem Erscheinen der zweiten Ausgabe (8.4.) mit beschriebenen Mängeln zogen sich die RedakteurInnen für einen Tag zur Beratung zurück. Die Beschreibungen dieser Klärungsversuche waren sehr unterschiedlich und verdeutlichten nochmal die Diskrepanzen und Kommunikationsschwierigkeiten zwischen ihnen. "Es war wie ein Strudel, in dem wir alle drin waren. Das Gefühl, daß es so nicht weiter gehen kann, hatten wir alle drei."[58]
Die Eskalation der Konflikte
Am Montag dem 18.4.94 kam Sonja K. ohne Abmeldung nicht zur Arbeit. Auch am darauffolgenden Tag erschien sie nicht, war aber auch nicht erreichbar. Bedingt durch die Tatsache, daß in den nächsten Tagen die kommende Ausgabe, zu der Sonja K. mit einigen Artikeln beitragen sollte, ins Layout gehen mußte, um zum Drucktermin gestalterisch vorbereitet zu sein, bekam diese Verzögerung ihre Brisanz. Die beiden anderen RedakteurInnen hielten diese Zuspitzung der bisherigen Unzuverlässigkeit für nicht mehr tragbar. Dennoch erhielt der Herausgeber eher zufällig Kenntnis von der aktuellen Situation als zwei Vereinsmitarbeiter am Mittwoch in der Redaktion erschienen. In einem Gespräch kamen beide Seiten zu dem Ergebnis, daß Sonja K. gekündigt werden soll. Die RedakteurInnen wollten aber vorher eine Abmahnung schreiben und abwarten bis sie wiederkommt, um Genaueres zu erfahren.[59]
Am Donnerstag, 21.4., erhielt Sonja K. ihre fristlose Kündigung per Bote und am Tag darauf nochmals per Post, wovon die Redaktion nur noch telefonisch unterrichtet wurde. Sonja K. ihrerseits versuchte vergeblich am Freitag den Vorstand telefonisch zu erreichen. Die Verkäufer meldeten sich nach der Kündigung und versicherten sie ihrer Solidarität und kündigten an, daß sie ab Montag in den Streik treten wollten. Sonjas Entgegnung, daß die Kündigung rechtens sei, konnte die Verkäufer nicht umstimmen, da es ihnen darüber hinaus um eine Klärung der genauen Funktion von BIN bezüglich "mob" ging und sie ihr mangelndes Mitspracherecht bei der gesamten Zeitungsarbeit anprangern wollten.[60]
Am Montag, 25.4., besetzten einige Verkäufer die Redaktionsräume. Sie verlangten von BIN eine öffentliche Stellungnahme in Form einer Pressekonferenz zu den Punkten: welche Ziele verfolgt BIN mit "mob", wie sieht die finanzielle Situation des Projekts aus und warum haben die Betroffenen kein umfangreicheres Mitspracherecht bei der Gestaltung und Weiterführung des "mob"-Magazins.[61] Diese Form der öffentlichen Auseinandersetzung lehnte der Vorstand ab und drängte auf nichtöffentliche Gespräche, was die Besetzer wiederum verweigerten. Ausschließlich Sonja K. erhielt Zutritt zu den besetzten Räumen. Sie forderte die Besetzer zu Gesprächen mit BIN auf und mahnte sie, daß nichts in den Räumen zerstört und verändert werden oder verlustig gehen darf.[62]
Dienstagmorgen ließ der Vorstand die Redaktionräume polizeilich räumen ohne die RedakteurInnen davon vorher in Kenntnis zu setzen bzw. ihre Zustimmung oder Meinung dazu einzuholen. Die Besetzer führten mittags ihre schon am Tag zuvor angekündigte Pressekonferenz durch, auf der sie ihre Kritik und Fragen an den Vorstand öffentlich machten. Der Vorstand, der bei der Pressekonferenz nicht anwesend war, erklärte: "Das ist uns nicht leichtgefallen, doch wir hatten Sorge, daß da Gelder wegkommen."[63]
Sonja K. forderte eine gemeinsame Sitzung von Redaktion und Vorstand, um eine Stellungnahme zu ihrem Verhalten, das zur Kündigung geführt hatte, und zur Entwicklung des gesamten Zeitungsprojekts abzugeben und zu diskutieren. Nachdem ihr das verweigert wurde und sie darüber hinaus vom Vorstand der Rädelsführerschaft geziehen wurde, da sie während der Besetzung die Redaktionsräume betreten, die Besetzung aber nicht beendet hatte, erschien ihr jede weitere Initiative zwecklos. Sie veröffentlichte anschließend ihre Stellungnahme in der Mai-Ausgabe des "Scheinschlag", einer Kiez-Zeitung in Berlin-Mitte.[64]
Die direkte Konsequenz aus der Eskalation der vorhandenen Konflikte bestand darin, daß zunächst keine Kommunikation zwischen den verschiedenen Parteien möglich war und auch nicht angestrebt wurde. Die Redaktion verurteilte die vom Vorstand initiierte polizeiliche Räumung und kündigte an, ihre Position auch öffentlich zu machen. Zeitweise überlegten sie auch, selbst zu kündigen.[65]
Circa eine Woche später verlangte die Redaktion bei einem Treffen mit dem Vorstand, daß eine Vereinssitzung anzuberaumen sei, auf der über die Räumung und die allgemeinen Krise diskutiert und gegebenenfalls auch Konsequenzen gezogen werden sollten, sprich: die Abwahl des Vorstands. Auf dem Hintergrund des Klimas, das von Konfrontation geprägt war, bestand die Reaktion des Vorstands laut Vera R. darin, auch die Redaktion zur Disposition zu stellen, falls selbiges mit dem Vorstand getan werden sollte. Damit konnte die Redaktion sich einverstanden erklären. Die geforderte Vereinssitzung fand sechs Wochen später statt.[66]
In der vierten Ausgabe von "mob" vom 1.Juni wurden Stellungnahmen der Redaktion und des Vorstands abgedruckt.
"Unausgesprochene Konflikte und Schwierigkeiten, im Anfangsstreß klare Übereinkünfte und Strukturen gemeinsam zu erarbeiten, aber auch Mißverständnisse und diffuse Unzufriedenheiten veranlaßten einen Teil der VerkäuferInnen, die Redaktionsräume zu besetzen und vorübergehend den Verkauf weitgehend zu blockieren." Die Redaktion stellte klar, daß sie "einer polizeilichen Räumung keinesfalls zugestimmt hätte." Sie habe sich entschlossen, "eine Fortführung von "mob" zu ermöglichen." Bezüglich des Konflikts mit dem Vorstand wegen der Besetzung und Räumung ließe sich kein weitgehenderes Ergebnis konstatieren, "als daß die vorhandenen, zum Teil gegensätzlichen Positionen veröffentlicht und zur Diskussion gestellt werden können." "Für die Redaktion ist durch diese Krise nochmal sehr nachhaltig deutlich geworden, wie komplex und vielschichtig die Herausforderung ist, eine Zeitung von und mit Obdachlosen auf den Markt zu bringen und dort zu behaupten."[67]
"Um das Gesamtprojekt nicht zu gefährden und im Interesse der Mehrheit der VerkäuferInnen sah sich BIN e.V. gezwungen, die Redaktionsräume räumen zu lassen. Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen." Den Anlaß der Besetzung, "das Ausscheiden einer Redakteurin", will der Vorstand aber nicht öffentlich diskutieren. Die Aktion habe den Vorstand insofern überrascht, als die Unzufriedenheit einiger VerkäuferInnen, die als Hintergrund ausgemacht werden, bis zu dem Zeitpunkt nicht an den Vorstand herangetragen worden sei. Als Antwort auf die erhobenen Vorwürfe verweist der Vorstand darauf, "daß alle Vereinssitzungen und die monatlich stattfindenden Redaktionskonferenzen öffentlich waren und sind. Auch die VerkäuferInnen waren dazu eingeladen." Aber: "Sicherlich ist es noch nicht gelungen, die VerkäuferInnen optimal in den Redaktionsbetrieb mit einzubeziehen. Dazu gehört ganz bestimmt mehr als offene Redaktionskonferenzen und Mitgliederversammlungen." Zur finanziellen Situation stellte der Vorstand fest, daß sich "mob" noch nicht selbst trage und BIN die Zeitung mit Spendengeldern finanziere. Bisher habe "mob" 55.000,- DM von BIN erhalten. "Dem Projekt geht es ausschließlich darum, - neben den politischen und journalistischen Zielen - den Wohnungslosen eine Chance zu geben, sich mit der Zeitung zu identifizieren, sich für ihre eigenen Belange einzusetzen, Selbstbewußtsein und Initiativen zu entwickeln sowie selbstverständlich, sich damit Geld zu verdienen."[68]
Auf der nächsten Redaktionssitzung nach Erscheinen der vierten Ausgabe, an der auch eine Autorin der Stellungnahme des Vorstands teilnahm, kam es zu einer heftigen Debatte darüber, daß der Vorstand sich im Nachhinein nicht von der Räumung distanziert hatte, was die meisten Anwesenden für durchaus angebracht gehalten hätten.
Die Ruhe...
Nachdem der Mai noch von den "Nachwehen" der Besetzung geprägt war, wurde es im Juni zunehmend ruhiger in der Redaktion. Auf einen Vorschlag von Lars F. begann Tjark K. Anfang Juni als dritte Kraft mit seiner Arbeit in der Redaktion. Er hatte journalistische und redaktionelle Erfahrungen durch seine Veröffentlichungen in verschiedenen Berliner Zeitungen. Durch seine jahrelange Arbeit in einem AIDS-Projekt war er vertraut mit der Problematik der Balance zwischen Abgrenzung und Emphatie bezogen auf die Klientel. Es stellte sich schnell heraus, daß er dieser Anforderung souveräner gerecht wurde im Gegensatz zu dem vorherigen Arbeitsstil der Redaktion, indem er sich einerseits mit den Betroffenen zusammensetzte und auch ihre Texte kritisierte, sich aber andererseits nicht verwickeln ließ, was sich z.B. darin ausdrückte, daß er im Falle einer zu extensiven Anwesenheit von Betroffenen die nötige Grenze zu ziehen imstande war. Der Effekt davon war eine Entlastung für alle. Sowohl periodisch stattfindende interne Redaktionsbesprechungen als auch Absprachen zeitlicher und inhaltlicher Art konnten realisiert werden. Die Vorbereitungen für die fünfte Ausgabe gestalteten sich konstruktiv und bis auf finanzielle Engpässe schien sich die Zeitungsarbeit zu stabilisieren. Zudem hatte sich im Verlauf der Auseinandersetzungen zwischen Redaktion und Betroffenen als Konsequenz der Besetzungsaktion eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit einem Kern von sechs bis acht Obdachlosen entwickelt.[69]
...vor dem Sturm
Am 28. Juni fand die von der Redaktion geforderte Vereinsitzung statt, an der diese Gruppe von obdachlosen Mitarbeitern auch teilnahm. Die späte Terminierung dieser Vereinssitzung hatte der Vorstand damit begründet, daß einer kurzfristigen Einladung nur wenige Vereinsmitglieder würden folgen können. Dennoch erschienen zu diesem Termin neben dem vierköpfigen Vorstand lediglich vier weitere Mitglieder,[70] die über die vergangenen Konflikte und Debatten gar nicht informiert gewesen seien. Die Intention der Redaktion, den Vorstand nach einer Diskussion über die Verantwortung für die Besetzung und Räumung von den Mitgliedern abwählen zu lassen, erschien in Anbetracht dieser Situation unrealistisch.[71]
Stefan S., Vereinsmitglied und BINFO-Autor, verteilte auf dieser Sitzung seinen Gegenentwurf zu dem offiziell vom Vorstand veröffentlichten, der eine gänzlich andere Perspektive dieser Krise vermittelte. "Wir haben damit (der Räumung, d.V.) vor unseren eigenen Ansprüchen kapituliert und etwas getan, was wir nie hätten tun dürfen. Auch der Anlaß der Besetzung war ein eindeutiger Fehler unsererseits. Wir haben eine unserer Redakteurinnen fristlos gekündigt, obwohl eine erste Abmahnung das übliche Verfahren ist. (...) Wir haben uns in der positiven Resonanz auf "mob" gesonnt und völlig übersehen, daß damit völlig neue Herausforderungen auf uns zukommen, die unser bisheriges sozialpädagogisches Selbstverständnis völlig in Frage stellen. Die Wohnungslosen bei "mob" sind nicht unsere Klienten, sondern Partner, mit denen wir kooperieren wollen und müssen. "mob" ist ihre Zeitung und nicht unsere. Wir sind nur Herausgeber. (...) Wir haben dem Projekt nicht genügend Autonomie gewährt, sondern die Beteiligten nur in begrenztem Umfang partizipieren lassen. (...) Wir ziehen daraus die Konsequenz, für diesen Fehler die politische Verantwortung zu übernehmen und als Vorstand geschlossen unseren Rücktritt zu erklären. Nur ein personeller Wechsel im Vorstand des Herausgebervereins kann sicherstellen, daß der Vertrauensbruch, den wir allein zu verantworten haben, nicht zu einem Problem eskaliert, der das Projekt ernsthaft in Gefahr bringt."[72]
Die ohnehin vorhandene Polarisierung der Debatte wurde laut Vera R. durch den Vorstand noch vorangetrieben, indem dieser die schlechte finanzielle Situation der Zeitung mit einer unzureichenden Motivation der VerkäuferInnen in Verbindung brachte, obwohl gerade diejenigen, die sich mittlerweile kontinuierlich engagierten, anwesend waren. Für die Redaktion war eine weitere Zusammenarbeit mit diesem Vorstand nicht mehr machbar, sie hatte ihrerseits unter diesen Umständen eine Kündigung ernsthaft in Erwägung gezogen. Abschließend, nach massiven Angriffen auch seitens der Betroffenen, habe sich der Vorstand gezwungen gesehen, seine Tätigkeit als Herausgeber einzustellen.[73]
Regina T. vom Vorstand beschrieb die Vorwürfe als teilweise diffamierend und es sei deutlich zum Ausdruck gekommen, daß eine fachliche und inhaltliche Mitarbeit von BIN nicht mehr gewünscht wurde. Entscheidender aber war der finanzielle Stand der Zeitung. "Unsere Überlegungen, das Projekt zu halten, sind in dem Moment zerronnen, als wir Klarheit über die finanzielle Situation erlangten. Das Projekt war betriebswirtschaftlich nicht mehr zu halten. Die völlig unzureichenden Vorschläge von Lars F., das Projekt finanziell zu retten und die Stellen zu halten, haben wir von einem fachlich qualifizierten Berater überprüfen lassen und sind auch nach eingehender Beratung durch unsere Anwälte zu dem Schluß gekommen, daß wir die "mob" finanziell abwickeln mußten. Hätten wir dies nicht getan, wären wir nicht nur mit einem "blauen Auge" davongekommen, sondern mit einem Riesenberg Schulden."[74]
Finanzielle Entwicklung und Vertrieb
"mob" hatte mit 100.000 DM begonnen und 70.000 DM durch den Verkauf der ersten fünf Ausgaben eingenommen. Von diesen 170.000 DM entfielen in dem Zeitraum vom 1.2.- 31.7.1994 für Gehaltskosten ca. 70.000 DM und für Produktionskosten (Layout, Druck etc.) ca. 50.000 DM. Die laufenden Kosten wie Miete, Telefon, Strom etc. schlugen für dieses halbe Jahr mit ca. 35.000 DM zu Buche und Anschaffungen vom Briefpapier bis zum Computer wurden in der Höhe von ca. 15.000 DM getätigt.[75]
Die durchschnittlich verkauften 14.000 Exemplare jeder Ausgabe reichten bei weitem nicht zur Deckung der Kosten. Die anfängliche Überlegung ging dahin, die rein technischen Produktionskosten durch Anzeigen zu kompensieren, und das Projekt monatlich mit einer verkauften Auflage von 25.000 Exemplaren zu stabilisieren. Weder das eine, noch das andere ließ sich realisieren, so daß das Startkapital zur Deckung genutzt wurde.[76]
Der Vertrieb, die Ausgabe der Verkäuferausweise und der Zeitungen, gestaltete sich am Anfang sehr chaotisch. "Es war alles 100%ig durchdacht, es funktionierte nur einfach nicht, beim besten Willen nicht."[77] Es war keine Übereinstimmung herstellbar zwischen der formal festgehaltenen Menge an ausgegeben Zeitungen und der Summe des eingenommen Geldes. Einen Monat lang sei es "kunterbunt durcheinander" gegangen, nach der Einführung neuer Formblätter und anderer Veränderungen habe sich die Erfassung der Abläufe der Realität etwas mehr angenähert. Nach einigen Monaten wäre, nach Meinung von Lars F., wahrscheinlich ein zufriedenstellender Zustand erreichbar gewesen, doch die Zeit und das Geld haben nicht ausgereicht. Hätten sie den Vertrieb von heute auf morgen effektiver gestalten wollen, hätte das bedeutet, diese Arbeit einem "Profi" zu überantworten und nicht mehr von Betroffenen durchführen zu lassen. Das aber wollten sie nicht.[78]
Darüber hinaus lag das wahrscheinlich größte Manko des Vertriebs in der mangelhaften Präsenz von "mob" auf der Straße. "Das ist ja das, was im Grunde genommen so bitter daran ist, daß eine Zeitung, die sich sehr wohl in einer kostentragenden Auflage verkauft hätte, wenn denn alle, die sie kaufen wollten auch hätten kaufen können. Daß das eben nicht möglich war, den Vertrieb so zu organisieren, daß sie ausreichend verkauft worden ist."[79]
Das hier angedeutete Problem läßt sich meines Erachtens auch mit einem effektiver strukturierten Vertriebsablauf nicht unmittelbar aus der Welt schaffen, tangiert es doch die Motivation und das Engagement der VerkäuferInnen. In einem Gespräch mit drei quasi hauptamtlichen, obdachlosen Mitarbeitern von "mob" wurden mehrere Erklärungsansätze beschrieben, die ich hier kurz auflisten will.
- Zunächst stellt es generell eine Überwindung dar, ZeitungsverkäuferIn zu werden, weil man sich dadurch als Obdachlose(r) "outet".
- Die ganz überwiegende Mehrheit kommt nur einmal, um sich die obligatorischen ersten zehn Freiexemplare zu holen und erscheint dann nie mehr. Bei "mob" gibt es ca. 20 Obdachlose, die regelmäßig verkaufen, aber 380 sind als VerkäuferInnen registriert.(Dez.'94)
- Die meisten VerkäuferInnen gehen ihrer Tätigkeit aus rein finanziellen Gründen nach. Sie verstehen die Zeitung nicht als ihr Projekt, als ihr Sprachrohr.
- Letzteres hat Auswirkungen auf ihr Verkaufsengagement, auf die Art und Weise, wie sie potentiellen KäuferInnen gegenübertreten. Angebotene Vertriebstreffen oder VerkäuferInnenschulungen werden kaum wahrgenommen bzw. als Bevormundung empfunden.
- Zum Verkauf gehört ein offensives und lautstarkes Auftreten, was anstrengend ist und teilweise weniger Geld einbringt als das traditionelle Betteln.
- Weit verbreitete Unzuverlässigkeit und Unverbindlichkeit: sie haben ein anderes Zeitgefühl, leben von einem Tag zum anderen.
- VerkäuferInnen kommen nicht mehr wieder, weil sie Zeitungen auf Kommission gekauft haben und diese nicht bezahlen können.
- Die Zeitungen werden auch über einige Wärmestuben vertrieben. Von Bedeutung ist dabei, ob die dortigen SozialarbeiterInnen die VerkäuferInnen unterstützen und motivieren.
- Feststellbar ist eine Motivationssteigerung und Identifizierung durch den Abdruck eigener Texte in der Zeitung. Nur ist die Angst vor dem Schreiben sehr groß.[80]
Diese Aspekte erwähnten auch die Verantwortlichen der anderen Berliner Obdachlosenzeitungen.
Durch diese Auflistung soll allerdings nicht der Eindruck erweckt werden, daß das finanzielle Ende von "mob" I den VerkäuferInnen anzulasten sei. Die gravierenden betriebswirtschaftlichen Mängel wurden erst im Nachhinein deutlich, nachdem der Vorstand einen erfahrenen Buchhalter mit der Aufarbeitung der Buchführung beauftragt hatte. "Leider haben wir uns in der fachlichen Qualifikation von Lars F. getäuscht. Das Projekt wäre sicherlich völlig anders gelaufen, wenn wir einen Menschen eingestellt hätten, der einen formalen Abschluß in Betriebswirtschaft und Buchhaltung vorweisen kann und über die nötige Erfahrung mit Projekten verfügt, und der engagiert mit den Betroffenen an dem Projekt gearbeitet hätte."[81]
Daß der Vertrieb nicht effektiver und nachvollziehbarer strukturiert und die Buchführung laut des Buchprüfers mehr als ungenügend durchgeführt wurde, ist überwiegend dem informellen Geschäftsführer Lars F. anzulasten. Die Begründung, sie, also die Redaktion, hätten den Vertrieb den Betroffenen nicht entziehen wollen, entbindet sie ja nicht der Verantwortung für dessen Funktionsfähigkeit. Ein Betroffener äußerte sich dahingehend, daß der Geschäftsführer durchaus hätte Einfluß nehmen können, daß er aber nicht den "Nerv" gehabt hätte, "in dieses Chaos einzugreifen". Die Konzentration aller drei Hauptamtlichen auf die redaktionelle Arbeit und die daraus resultierende Vernachlässigung der Vertriebsarbeit war nicht geplant und läßt sich allenfalls mit der nicht vorhandenen Erfahrung bezüglich eines Zeitungsprojekts rechtfertigen.
Der Herausgeber muß sich fragen lassen, warum er nicht frühzeitiger seinem Recht und seiner Verantwortung nachgekommen ist und detaillierte Zahlen und Abrechnungen verlangt hat.
"mob" - Obdachlose machen mobil
Stefan S., BIN-Mitglied und BINFO-Autor, hat sich seit dem "Zoff bei mob" [82] in der Zeitung engagiert. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Allgemeine Pädagogik an der Hochschule der Künste. Nach der finanziellen Abwicklung führte er die Gespräche mit dem bisherigen Herausgeber über die Weiterführung des Projekts.In den Verhandlungen einigte man sich darauf, daß die angemieteten Räume und die notwendigen Arbeitsmittel wie Computer, Fax und Telefon gegen Übernahme der entsprechenden Kosten von dem neuen Träger weiterhin genutzt werden können. Die 160.000 vorhandenen, nicht verkauften Exemplare der bisherigen Ausgaben stellten das Startkapital des am 1.August gegründeten neuen Trägervereins "mob - Obdachlose machen mobil" dar.
Nach zähen Verhandlungen konnten die Layout- und Druckkosten reduziert und durch Reglementierungen die laufenden Bürokosten eingeschränkt werden, so daß sich die monatlichen Fixkosten von vorherigen 15.000 DM auf aktuelle 8.000 DM verringerten.[83] Zudem entfielen die bisherigen Gehaltskosten, da die jetzigen 'Profis' ehrenamtlich arbeiten.
Die erste Ausgabe der neuen "mob" erschien am 28. September. "mob" II hat quasi bei Null angefangen. Das Geld zur Finanzierung einer neuen Ausgabe mußte immer erst durch einen genügenden Verkauf der letzten erwirtschaftet werden. Diese Notwendigkeit den Betroffenen immer wieder zu erklären, sei unumgänglich und mühsam gewesen, habe aber mittlerweile dazu geführt, daß sie einen Finanzplan erstellt hätten.[84]
Redaktionelle Arbeit
Stefan S. beschrieb das Arbeitsprinzip der neuen Redaktion, in der Obdachlose gleichberechtigt mitarbeiten, als ein gänzlich anderes. "Wir arbeiten mit dem Chaos und nicht gegen das Chaos, würde ich mal vereinfachend sagen. Und wenn Probleme auftreten, dann ist die Lösung also nicht, das Chaos zu reduzieren, sondern es voranzutreiben."[85] Sozialarbeit habe bisher immer autoritär funktioniert und lasse keine Selbstbestimmung und Selbstorganisationsformen der Leute zu.
Zentrale Bedeutung für die Redaktionsarbeit habe der Computer. Einige der Betroffenen haben sich nach einer Einführung diese Fähigkeiten angeeignet. Insgesamt existiere nun das Bewußtsein, daß alle möglichen Texte in den Computer eingegeben werden müssen, um potentiell für die Zeitung nutzbar zu sein. Diese Entwicklung habe maßgeblich dazu beigetragen, daß zunehmend mehr Beiträge der Wohnungslosen in der Zeitung stehen. Stefan S. mißt dem einen hohen pädagogischen Stellenwert bei, da soziale Arbeit bisher darin bestand, Menschen immer nur mit etwas zu versorgen, sie aber von Kompetenzen weitgehend ausgeschlossen blieben. Beim Computer sei das anders: die Leute haben einen Zugriff darauf, können sich die Fähigkeiten aneignen, es gibt keine Vorgaben seitens der Maschine, sie können schreiben was sie wollen und es verwenden, wie sie wollen.
"Das ist eine Lebensgemeinschaft, die Leute leben in diesem Projekt, in diesen Räumen. Sie arbeiten da tagsüber, sie saufen da abends manchmal und sie pennen da nachts. Und zwar Leute, mit einem ganz hohen Konfliktpotential, die es aber immer schaffen, sich irgendwie zusammenzuraufen."[86] Er bezifferte die Gruppengröße mit fünf bis fünfzehn. Vier bis fünf wohnen dort, und wenn es kalt wird, können es auch acht bis zehn werden. Zudem gebe es einige Leute, die jeden Tag anwesend sind.
Es habe sich ein innerer Kreis herausgebildet, der die täglichen Öffnungszeiten von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr gewährleistet. Diesem Kreis sei mittlerweile, nachdem sie die dritte Ausgabe erstellt haben, auch die Logik der Zeitungsproduktion klar:
Erscheinungsdatum am Monatsanfang - Drucken gegen Ende des vorherigen Monats - davor Layout - hierfür Strukturierung der Ausgabe nötig - Artikel müssen geschrieben sein - Planung der Ausgabe und Themen. Das sei ein kollektiver Lernprozeß, der die Leute befähigt, perspektivisch zu denken und sich auch schon Gedanken über die übernächste Ausgabe zu machen.
Betriebswirtschaftliche Führung
Jens L.[87], der die Aufarbeitung der Buchführung von "mob" I im Auftrag von BIN durchgeführt hatte, übernahm bei der neuen "mob" die betriebswirtschaftliche Führung des Projekts. Es wurden Vertriebsstrukturen und Kontrollmechanismen eingeführt, die sämtliche Bewegungen von Zeitungen und Geld nachvollziehbar machen.
Das Projekt hatte sich bis Anfang Dezember finanziell stabilisiert, obwohl sich die letzten Verkaufszahlen "bedenklich" entwickelt hatten. Nachdem von der sechsten Ausgabe, also der ersten "neuen mob", 25.000 Exemplare verkauft wurden, waren es von der siebten nur noch 15.000 Stück. Zu dem Zeitpunkt des Interviews waren von der aktuellen achten Ausgabe nach einer Woche 2.500 Exemplare verkauft. Die Auflagenhöhe von 50.000 soll ab Januar '95 auf 30.000 reduziert werden, wobei die finanzielle Ersparnis nur gering sein wird.[88]
Die seit Juli laufende Spendenkampagne für "mob" hatte bis zum 30.11.94 über 5.000 DM erbracht und das Anzeigenvolumen konnte erhöht werden. Es standen noch offene Rechnungen von "mob" I aus und es werden Ablösungen an BIN für die Computer zu zahlen sein, so daß Rücklagen gebildet werden sollen. Insgesamt aber stellt die Zeitung einen Zweckbetrieb des gemeinnützigen Vereins "mob - Obdachlose machen mobil" dar, der sich selbst trägt.[89]
Resümee
Die Beschreibung der Entwicklungen von "mob" I ist notwendigerweise lückenhaft, eine Skizze eben und kein Bild, hätte sie doch sonst den drei- bis vierfachen Umfang, wären alle Positionen, Widersprüche und Unklarheiten der an diesem Prozeß beteiligten AkteurInnen dargestellt worden. Daß die Obdachlosen in diesem Entwicklungprozeß eher am Rand zu stehen scheinen, ist aber kaum der selektiven Wahrnehmung des Autors geschuldet, als vielmehr die Widerspiegelung des Grundkonflikts dieser neuen Art von Zeitung, der bei "mob" am deutlichsten in Erscheinung getreten ist.
"An einer Frage jedoch kommt keine dieser Zeitungen vorbei: Zeitung f ü r Obdachlose - dann sind sie Verkäufer und die Zeitung ist Einnahmequelle - oder Zeitung m i t Obdachlosen. Letzteres erfordert Mitspracherecht der Unbehausten in redaktionellen und allen anderen Fragen."[90]
"Um die Zeitungsarbeit und die betriebswirtschaftliche Organisation möglichst professionell zu gestalten"[91], hatte BIN drei RedakteurInnen angestellt, womit ungewollt, aber zwangsläufig der 'Raum' für Obdachlose in der Redaktion eng wurde. Darüber hinaus ziehen drei Festanstellungen finanzielle Sachzwänge nach sich, die redaktionelle Flexibilität und Experimente nicht zulassen, und vor allem benötigt der Prozeß der Einbeziehung und des Hineinwachsens von obdachlosen Menschen in die Zeitungsarbeit sehr viel Zeit, die in einem professionell angelegten Redaktionsablauf nicht vorhanden ist.
Die personelle Zusammensetzung der Redaktion und die Kürze der Vorbereitungszeit verursachten Konflikte während der Produktionsphasen, die eigentlich im Vorfeld entschärft oder geklärt werden sollten. Hier liegt meines Erachtens die Verantwortung des Herausgebers, der aus der Überzeugung, schnell auf die kommende Konkurrenz aus Paris reagieren zu müssen, die nötige Sorgfalt bei der Auswahl der zukünftigen Redaktion hat vermissen lassen, sind doch diese Stellen nicht einmal öffentlich ausgeschrieben worden, wodurch keine personelle Alternative zu der dann eingestellten Redaktion zur Auswahl existierte.
Die polizeiliche Räumung der Besetzung halte ich für einen fatalen Fehler, läßt doch dieses "mit Kanonen auf Spatzen schießen" ein Kooperationsverständnis zum Ausdruck kommen, das wenig Raum für reale Gleichberechtigung und Mitsprache schaffen kann.
Die Redaktion ihrerseits hat es versäumt, sowohl ihre internen Arbeitsprozesse zu strukturieren, als auch die Mitarbeit von Obdachlosen in eine institutionelle Form zu bringen. Mit der Einstellung von Tjark K. sind solche Ansätze realisiert worden, wodurch belegt scheint, daß die konstruktive Zusammenarbeit von 'Profis' und Obdachlosen möglich ist. Ein gravierender Irrtum bestand meiner Meinung nach darin, daß sich die Redaktion aus gut gemeinter Loyalität nach außen abschottete, wodurch ihre internen Konflikte diese Eigendynamik annehmen konnten. Die Hinzuziehung von außenstehenden Personen, sei es z.B. jemand aus der Redaktion von "Hinz & Kunz(t)" aus Hamburg oder eine professionelle Supervision, und die damit zwangsläufig festzulegenden Zeiten für Diskussionen und Reflexionen hätten durchaus die Entwicklung produktiverer Arbeitsgrundsätze mit sich bringen können.
Ein Resultat der nicht genügend geleisteten Strukturierung der Arbeitsprozesse des gesamten Projekts war der mangelhafte Vertrieb. Lars F. als informeller Geschäftsführer und betriebswirtschaftlicher Leiter von "mob" scheint mit der Dimension der an diesen Posten verbundenen Aufgaben überfordert gewesen zu sein, sind doch im Nachhinein Unzulänglichkeiten offenbar geworden, die sich zur Zeit in einer juristischen Klärung befinden[92] und zu einer nachträglichen kritischen Distanz der Betroffenen zum Geschäftsführer geführt haben, nachdem im Zuge der Krise um die Räumung der besetzten Redaktionsräume die Redaktion und die VerkäuferInnen enger kooperiert hatten.[93]
Die Umstrukturierung von einer 'professionellen' zu einer von den Betroffenen selbst erstellten Zeitung scheint mir gelungen. Der verringerte finanzielle Druck durch die Reduzierung der Fixkosten schafft Freiräume, Variationsmöglichkeiten und ein größeres Maß an Zeit, um den vorhandenen Kapazitäten und Fähigkeiten der Betroffenen gerecht zu werden. Die Problemhaftigkeit dieses "Selbstfindungsprozesses" und die Tatsache, daß die Betroffenen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit und in dem Projekt leben und es gleichberechtigt mitgestalten, macht die Bedeutung der Entwicklung von "mob" I zu "mob" II aus.
HAZ
Der Herausgeber
George Mathis begann als Straßenverkäufer anderer Obdachlosenzeitungen in Paris, bevor im Juli '93 die von ihm gegründete "Le Reverbere" erschien. Der ehemalige Fern- und Taxifahrer hatte nach der Scheidung acht Jahre auf der Straße gelebt. Den Erfolg der Zeitung, von der mindestens 200.000 monatlich verkauft werden, führt er auf die Tatsache zurück, daß sie die einzige in Paris ist, die "auf der Straße geschrieben wird", also "auf Baustellen, Bänken oder in Cafes". Die Überschüsse fließen in die Krankenversorgung, Suchtbehandlung und Rentenfinanzierung von Obdachlosen.
Die "HAZ" in Berlin "soll inhaltlich und vielseitig die Armut vertreten, aber unabhängig sein von Senatssubventionen. Ich will Politiker und Wirtschaftsbosse drängen, sich stärker zu engagieren, Parteien zu Äußerungen zwingen."[94]
Der verantwortliche Redakteur
Frank K.[95] ist gelernter Einzelhandelskaufmann und arbeitete ein Jahr in diesem Beruf, bevor er für acht Jahre auf Erdölmontage ins Ausland ging, wo er das Trinken begann. Nach seiner Rückkehr begann er mit einem Entzug und einer Therapie, woraufhin er aber einige Wochen später wieder rückfällig wurde. Die folgenden zwei Jahre waren von seiner extremen Alkoholsucht geprägt, in deren Verlauf er seine Frau und sein Kind sowie seine Arbeit verlor. Ein Jahr verbrachte er in "Läusepensionen", am Bahnhof Zoo oder er "machte Platte" (unter freiem Himmel nächtigen, d.V.) irgendwo in der Stadt. Seit Sommer 1990 ist er "trocken".
1992 machte er sich mit Hilfe eines Freundes selbstständig, gründete eine Werbefirma, erstellte Visiten- und Speisekarten, führte Auto- und Bauträgerbeschriftungen durch. Seit Mitte '93 hatte er die Idee einer Zeitung, in der, ausgehend von seiner persönlichen Erfahrung, der mit dem Alkoholismus verbundene soziale Abstieg inclusive Obdachlosigkeit an die Öffentlichkeit gebracht werden sollte. Durch eine Fernsehsendung erfuhr er von "Hinz & Kunz(t)", insbesondere dem Vertrieb über den Straßenverkauf durch die Obdachlosen selber, was ihn zu der Überzeugung kommen ließ, das Gleiche in Berlin zu realisieren. Mit seinem Freund entwickelte er das Konzept der Zeitung und installierte das Layout auf dem Computer. Anfang '94 erfuhr er von den anderen Berliner Zeitungsprojekten. Er nahm dann am "Runden Tisch" am 19.2. teil, woraus die Zusammenarbeit mit George Mathis entstand.
Die Vorbereitungen
George Mathis hatte durch ein Interview, das die "Berliner Zeitung" mit ihm in Paris geführt hatte, erfahren, daß es in Berlin noch keine Obdachlosenzeitung gab. "Wir fuhren nach Berlin, berichteten in "Le Reverbere", nahmen über die "Ratten" (eine Berliner Theatergruppe von Obdachlosen, d.V.) Kontakt zur Szene auf und spürten Interesse."[96] Die genaueren Umstände dieser Kontakte und der Erstellung der ersten Ausgabe, die beim "Runden Tisch" vorgelegt wurde, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Ein geplantes zweites Interview mit Frank K. kam nicht zustande, darüber hinaus erhielt ich keine Antwort auf drei Briefe mit einigen konkreten Fragen und telefonisch war ebenfalls niemand in der Redaktion erreichbar.
Die Vereinbarung zwischen "Le Reverbere" und "Platte" sah laut Frank K. so aus, daß letztere nicht erscheinen wird und die Berliner die Herstellung und den Vertrieb der "HAZ" übernehmen werden, gedruckt werden sollte in Paris. Es wurde der Förderverein "HAZ e.V." und die "HAZ Verlags GmbH" gegründet, wobei die Gesellschaft die Produktion übernahm, während der Verein die Überschüsse verwaltete. Einziger Gesellschafter war George Mathis.
Kurz darauf wurden 30.000 Exemplare der ersten Ausgabe als kostenlose Starthilfe nach Berlin geschickt, die aber wieder eingestampft werden mußten, weil sie Bilder enthielten, die ohne Zustimmung der Inhaber der Veröffentlichungsrechte abgedruckt worden waren. Es erfolgte ein Neudruck ohne diese Streitobjekte. Es wurde noch eine Nachauflage geschickt, die aber niemand angefordert habe.[97]
Redaktionelle Arbeit
Die zweite Ausgabe wurde von der Berliner Redaktion erstellt, die aus vier Personen bestand, die alle entweder arbeits- oder obdachlos waren und trockene Alkoholiker. Dazu kam eine in Paris lebende professionelle deutsche Journalistin. Die Zeitung wurde auf einer Diskette nach Paris geschickt, wo sie gedruckt wurde. Hier entstanden erste Unstimmigkeiten, da Texte gestrichen bzw. gekürzt wurden.
Vertrieb und Finanzen
Nach dem Verkaufsstart der ersten Berliner Obdachlosenzeitung am 9. März '94 war der Andrang von Obdachlosen, die Verkäufer werden wollten, laut Frank K. sehr groß. Es gab einen Vertriebsbus am Bahnhof Zoo, von dem aus der Verkauf organisiert wurde.
Aufgrund der großzügigen Ausgabe von Freiexemplaren in der ersten Zeit bezifferte Frank K. die Einnahmen der Verlags GmbH mit ca. 40.000 DM für die ersten beiden Ausgaben. Als die Nachauflage der zweiten Ausgabe geliefert werden sollte, sei stattdessen der Gesellschafter gekommen, um die Finanzen zu überprüfen und die Einnahmen nach Paris zu überweisen. Die Buchführung habe er einsehen können, aber die kompletten Einnahmen seien ihm verweigert worden. Zum einen gab Meinungsunterschiede über die Anzahl der gelieferten Menge und andererseits seien von den Überschüssen schon Projekte gestartet worden. Dem Gesellschafter sei daraufhin die Erstattung der Druckkosten angeboten worden, was dieser ablehnte.
Es war mir nicht möglich, diesen Konflikt aus benannten Gründen detaillierter zu beschreiben. George Mathis äußerte sich dazu kurz in einem Interview: "Die alte Mannschaft hat die Gelder nicht sachgerecht verwaltet. Das klären die Gerichte. Keine Einnahmen wurden aber nach Paris abgefordert. Eine Redaktion hat es eigentlich nicht gegeben, inhaltlich war die Zeitung nicht gut."[98] Zu dem Zeitpunkt des Interviews mit Frank K. war dieser Streit noch offen, es waren noch keine Zahlungen erfolgt.
Mit der Entlassung des Berliner Geschäftsführers der GmbH endete die Zusammenarbeit und die Redaktion machte sich selbstständig.
Die Redakteurin
Nach der Kündigung bei "mob" setzte sich Sabine G., die Rechtsanwältin und Vertreterin von George Mathis in Berlin, mit Sonja K. in Verbindung, die Gesprächsbereitschaft signalisierte. Ihr Motiv war, daß sie journalistisch in der Art und Weise weiterarbeiten wollte, wie sie es bei "mob" begonnen hatte. In den folgenden zwei Gesprächen wurde ihr ein Einstellungsangebot unterbreitet, das sie unter zwei Bedingungen annahm. Die Zeitung sollte komplett in Berlin produziert und die potentiellen Überschüsse sollten ebenfalls in Berlin verwendet werden.[99]
Die Vorbereitungen
Innerhalb eines Monats realisierte Sonja K. in Zusammenarbeit mit Sabine G. die Herausgabe der dritten Ausgabe der "haz". Ein kleines Büro mit Computer stand zur Verfügung, Layout, Druck und Vertrieb mußten neu organisiert werden. Wichtig war ihr, den Betroffenen in der Szene ihren Wechsel zu vermitteln und sich gleichzeitig das Veröffentlichungsrecht für bestimmte Dinge zu sichern, was sich als problemlos herausstellte. Für die inhaltliche Gestaltung hatte sie anfangs kein ausgearbeitetes Konzept, sie verwendete erstmal schon begonnene und fertiggestellte Artikel.
Wesentlich an dieser ersten Ausgabe war für sie, daß sich George Mathis in einem Interview zu seinen Vorstellungen über die "haz" äußerte, insbesondere was die Verwendung der Überschüsse betraf.[100]
Die redaktionelle Arbeit
Sonja K. empfindet es als großen Mangel, daß es für die "haz" keine größeren, geeigneten Räume gibt, die sowohl als fester Anlaufpunkt für die Betroffenen als auch für Redaktionssitzungen nutzbar wären. Die Zeitung macht noch nicht soviel Gewinn, um größere Gewerberäume mieten zu können. Ihre Bemühungen, ein Objekt zu finden, wo Redaktionsräume und Wärmestube getrennt, aber nahe zueinander gelegen sind, sind noch nicht abgeschlossen.
Am "haz"-Bus am Zoo, dem einzigen Vertriebspunkt der Zeitung, lassen sich keine Redaktionssitzungen durchführen, so daß sie sich auf eine Einzelarbeit mit den Obdachlosen, die schreiben konzentriert hat. Regelmäßig schreiben fünf Betroffe, und unregelmäßig fünf weitere, was bedeutet, daß sie mit letzteren, oft Wochen nachdem sie von ihnen einen Text erhalten hat, das Manuskript mit ihnen überarbeiten kann. In der Regel erhält sie handschriftliche Texte, die sie korrigiert, per Computer abschreibt und anschließend mit den Autoren diskutiert, was zur Zeit nur extensiv für sie zu bewältigen ist.[101]
Vertrieb und Finanzen
Nach anfänglich eigenhändiger Führung eines Kassenbuches hat mittlerweile ein Steuerberater die Buchführung übernommen. Am Vertriebsbus wird jedes verkaufte Exemplar eingetragen. Die Nummer des Verkäufers, an den die Zeitungen ausgegeben werden, wird vermerkt und er zeichnet auch gegen. Es findet ein täglicher Abschluß dieser Buchhaltung statt. Am Ende jeder Ausgabe gibt es eine Bestandskontrolle, so daß insgesamt eine relativ lückenlose Erfassung des Zeitungsverkaufs durchgeführt wird.[102]
Die "haz" begann mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren, von denen die Hälfte verkauft wurde. Mit der nächsten Ausgabe wurde die Stückzahl auf 30.000 reduziert und nur 13.000 wurden verkauft, was das bisherige absolute Tief darstellte und auf den sehr heißen Juli zurückgeführt wurde. Die Verkaufszahlen haben sich dann bei etwa 20.000 Exemplaren eingependelt.
Die Kosten inclusive Gehalt, Layout, Druck, Miete, Telefon etc. belaufen sich auf ca. 17.000 DM, womit ein Überschuß von 3.000 DM bei entsprechenden Verkaufszahlen erreicht wird. Unkalkulierbare zusätzliche Kosten wie z.B. Reparaturen am Vertriebsbus lassen Sonja K. zu der Einschätzung gelangen, daß die Überschüsse nicht dazu ausreichen, sich vertraglich bei üblichen Marktpreisen für Gewerbemieten längerfristig zu binden.
Obdachlose AutorInnen erhalten siebzig Pfennig Honorar pro Druck zeile, d.h. bei zweispaltigem Layout wird jede Spalte extra berechnet. Neben dem finanziellen Verdienst, eben Arbeit, die bezahlt wird, hat das für sie auch die Bedeutung, bekannt zu werden.[103]
Bei der "haz" arbeiten ca. 30 VerkäuferInnen regelmäßig, worunter Sonja K. jeden zweiten Tag versteht, und mindestens dieselbe Anzahl sporadisch im Falle akuten Geldbedarfs. Es ist aber eine Minderheit, die sich für das Projekt engagiert, jeden Tag arbeit, sich überlegt, wo und wie läßt sich die Zeitung am besten verkaufen und es wird nach ihrer Meinung eine Minderheit bleiben. Anfänglich sei es allen egal gewesen, was in der Zeitung steht, ging es doch ausschließlich um den Verkauf. Das änderte sich z.B., wenn eigene Texte gedruckt oder Fragen aufgegriffen wurden, die ihnen selber auf den Nägeln brennen. "Ich denke, daß die Verkäufer die Zeitung in der Regel doch lesen, zwar oberflächlich, also auszugsweise. Sie lesen nur, was sie interessiert. Aber es gibt auch über dieses Lesen eine andere Reflexion oder Wahrnehmung ihrer eigenen Situation, die über ihr unmittelbares, alltägliches Einzeldasein hinausgeht." Desweiteren hat Sonja K. festgestellt, daß sich Verkäufer Ziele setzen, wieviel Zeitungen sie am Tag verkaufen wollen. "Da kommt eine ganz andere Zielstrebigkeit in das eigene Verhalten hinein und das halte ich für einen ganz wesentlichen Schritt, sich überhaupt wieder Ziele zu setzen, überhaupt wieder in die Zukunft zu denken."[104] Eine Zeitung könne, abhängig von der Rahmenkonzeption (Wärmestube, Beratungsstelle o.ä.), die Obdachlosen dazu befähigen, überhaupt ein Projekt, in welcher Art und Weise auch immer, mitzugestalten.
Resümee
Die "haz" hat sich seit und durch ihre redaktionelle Umgestaltung meines Erachtens deutlich verbessert. Eine parteilich engagierte, professionelle Berichterstattung korrespondiert mit einem umfassenden Abdruck interessanter und aufschlußreicher Texte der Betroffenen. Der Anspruch, eine gleichberechtigte Mitgestaltung der Obdachlosen in allen Belangen zu verwirklichen, ließ sich bisher mangels bezahlbarer und geeigneter Räumlichkeiten nicht gänzlich umsetzen. In Anbetracht dieser Situation erscheint mir die Arbeit mit Einzelnen an ihren Texten eine adäquate Zwischenlösung, bedeutet sie doch für die Betroffenen ernstgenommen und in ihrem Ausdruck respektiert zu werden, was eine notwendige Voraussetzung für eine eventuelle weitere Zusammenarbeit darstellt.
Der strukturelle Nachteil der nicht vorhandenen größeren Redaktionsräume war meiner Einschätzung nach zumindest für die Anfangsphase von Vorteil für die Redakteurin. Sie gewann dadurch zwangsläufig das erforderliche Maß an Distanz zu den Betroffenen, das sie bei "mob" nicht herzustellen imstande schien.
Platte
Die Vorbereitungen
Innerhalb kürzester Zeit erstellte die ehemalige Berliner Redaktion der "HAZ" die erste Ausgabe der "Platte", die am 1.5.94 erschien. Das Layout, das Frank K. schon ein halbes Jahr zuvor entwickelt hatte, kam nun zur Anwendung. Kontakte zu Druckereien gab es auch schon vorher, weil die alte "HAZ" -Redaktion preisgünstige Alternativen gesucht hatte, um nicht mehr in Paris drucken lassen zu müssen. Die Technik wie Computer und Schneidplatte der ehemaligen Werbefirma von Frank K. waren ebenfalls vorhanden, so daß die notwendigen Voraussetzungen für die neue Zeitung existierten.
Bezüglich der Texte waren einige Veränderungen nötig, um nicht Veröffentlichungsrechte, die der "HAZ" zustanden, zu verletzen. Das wurde zum Teil dadurch gelöst, daß in der ersten Ausgabe der "Platte" auf fünf Seiten Artikel anderer Zeitungen nachgedruckt wurden.
Redaktionelle Arbeit
Ein Redaktionsrat aus fünf Leuten legt mehrheitlich die Themen der "ein bis zwei richtigen Artikel" der Ausgabe fest und entscheidet über die Auswahl der Texte, die ihnen von Betroffenen zugesandt worden sind. Das Konzept der Zeitung, daß sie "auf der Straße geschrieben" wird, wurde laut Frank K. bisher beibehalten. Bei den Texten werde lediglich die Rechtschreibung korrigiert, stilistisch aber nichts verändert. Die Redaktion selber besteht aus Leuten, "die bis vor kurzem noch auf der Straße gelegen haben."[105] Frank K. war und ist für das Layout zuständig, kümmerte sich aber zunehmend um die vom Verein initiierten Projekte.
Vertrieb und Finanzen
Der Vertrieb wird von Betroffenen organisiert. Eine Dreier-Gruppe von ehemaligen Abhängigen organisiert den Vertrieb, regelt den Verkauf an den bestimmten Verkaufsorten, überwacht die Einhaltung der Regeln (kein Alkohol) und zahlt die Einnahmen ein.
Zweiwöchentlich erscheint die Zeitung in einer Auflage von 50.000 Exemplaren, wovon bis zum Zeitpunkt des Interviews durchschnittlich 30.000 verkauft wurden, was also eine monatliche Einnahme von ca. 60.000 DM bedeutet. Darüber hinaus werden Freiexemplare für neue Verkäufer und bestimmte Institutionen ausgegeben.
In der 11. Ausgabe vom 15.11.94 wurden dazu einige Zahlen veröffentlicht. "Platte" wird von "50 permanenten und 1000 temporären Verkäufern" vertrieben. Von den Einnahmen -eine Mark pro Zeitung für den Verkäufer, die andere fließt zurück- werden folgende Ausgaben bestritten:
Druckkosten pro Ausgabe ca. 9000 DM (monatlich also 18.000 DM); Miete, Strom etc. ca. 2000 DM; Miete, Pacht für die Projekte ca. 3500 DM; Bezahlung von zwei Vollzeit- und zwei Halbtagskräften ca. 9000 DM: insgesamt ca. 32.500 DM im Monat. Darüber hinaus wird Geld ausgegeben für Zeilenhonorar, Versicherung, Kraftstoff, Verkäuferfeste etc. Es werden also Überschüsse in der Größenordnung von ca. 20.000,- DM im Monat erwirtschaftet.
Projekte
"Die Initiatoren der "Platte" sind sich darüber klar geworden, daß es nicht nur darum gehen kann, daß ein paar Leute sich ein paar Mark verdienen, hier geht es um viel mehr. Die weiterführende Hilfe sieht deshalb so aus, daß wir (die Redaktion, der Verein, die Verkäufer) darum kämpfen, von den Ämtern, Behörden, von den verantwortlichen Stellen in Städten, Ländern und Gemeinden, in den politisch zuständigen Organen nicht mehr als aussteigende "Rollheimer", sondern als Menschen in vorübergehenden Notunterkünften, die sehr wohl ein Konzept und klare Vorstellungen von einer Problembewältigung haben, behandelt und respektiert und vor allen Dingen auch entsprechend unterstützt werden."[106] Ich will hier nicht ins Detail gehen und die Konzepte der verschiedenen geplanten Projekte darstellen, sondern lediglich einen Abriß der Aktionen geben.
Im April '94 wurden Bauwagen gekauft und Ende des Monats auf brachliegendes Land des ehemaligen Grenzstreifens bei Frohnau gebracht. Die "Plattenburg" stellte einen Antrag bei der Landesregierung von Brandenburg auf Gründung einer Gemeinde und Bewirtschaftung des Landes. Am 10. Mai wurde polizeilich geräumt. Eine Woche später besetzten 15 Leute der "Platte" das Stadtgut Stolpe. Sogar der Ministerpräsident Stolpe kam vorbei und sicherte alle erdenkliche Hilfe zu. Zwei Wochen nach der Besetzung erhielten die neuen Bewohner den Räumungsbeschluß durch die Stadtgüter GmbH. Es folgten Anträge, Anhörungen und Gespräche mit dem Gemeinderat, dem Ministerium und der Stadtgüter GmbH, es wurden Miet- und Pachtgesuche unterbreitet sowie Vorschläge und Konzepte. Einen erneuten Räumungsbefehl lehnte das Amtsgericht ab wegen ungeklärter Eigentumsverhältnisse. Eine gütliche Einigung in der Folgezeit war bedingt durch die Abwesenheit der verantwortlichen Vertreter bei entsprechenden Terminen nicht erreichbar, so daß am 22.7. geräumt wurde.
Im weiteren Verlauf suchte die "Platte" nach einem Grundstück, auf dem sie ihr Konzept der "Nur-Dach-Häuser" umsetzen könnten, die sie nach einem finnischen Modell selber konzipiert haben und auch selber bauen könnten.[107] Nach langer Suche und vielen Verhandlungen konnte "Platte" im November ein zwei Hektar großes Gelände bei Bernau mit einer alten Gärtnerei pachten. Diese soll abgerissen und neu gebaut werden, ebenso wie ein Wohnobjekt zur Unterbringung der Betriebszugehörigen, alles in der Nur-Dach-Konzeption. Der Gärtnereibetrieb soll zum 1.2.95 wieder aufgenommen werden. Darüber hinaus war ein Künstleratelier geplant und die Errichtung eines Jugendclubs durch die Bernauer Jugend angedacht.[108]
Resümee
"Platte" verkauft mit 60.000 Exemplaren pro Monat die meisten Obdachlosenzeitungen in der Stadt. Die Bedeutung dieser Zeitung besteht aber mehr darin, daß sie den Aufbau eines Wohn- und Arbeitsprojekts für die Betroffenen durch die Überschüsse des Zeitungsverkaufs ermöglicht, als in der Herausgabe der Zeitung an sich und den damit verbundenen Verdienstmöglichkeiten der VerkäuferInnen. Obschon die hohen Verkaufszahlen, die auf einen funktionierenden Vertrieb und auf eine hohe Motivation der VerkäuferInnen verweisen, einen Erfolg und die Voraussetzung für diese "weiterführende Hilfe" darstellen, verdeutlicht doch die Realisierung eines solchen Projekts in Eigenregie und mit selbst erwirtschafteten Mitteln die Machbarkeit von Selbsthilfe im Obdachlosenbereich. Die Reaktivierung von vorhandenen Fähig- und Fertigkeiten jedweder handwerklicher Art in der "Szene" gehört hierbei ebenso zum Konzept wie die praktische Qualifizierung der Ungelernten. Offensichtlich haben die monatelangen Bemühungen bei der Suche nach einem Pachtgrundstück, die kontinuierlich in der Zeitung geschildert wurden, die KäuferInnen von der Konzeption der Initiatoren überzeugt, so daß sie mit dem Kauf zur Umsetzung beitragen wollten.
Einschränkend sei hier aber deutlich darauf hingewiesen, daß die herrschende Obdachlosigkeit auch durch erfogreiche Selbsthilfeprojekte nicht abgeschafft werden kann. Das Bedeutsame liegt eher in der Tatsache, daß solche Projekte Vorbildcharakter haben und motivationsstiftend sein können für weitere Betroffene. Die Organisierung der Obdachlosen in kleinsten Ansätzen in Form von Zeitungen oder anderen Zusammenhängen könnte sich im Laufe der Zeit zu einer Art Lobby entwickeln, die auf lokaler Ebene in Zusammenarbeit mit den 'Profis' der Obdachlosenhilfe den Interessen der Betroffenen mehr Gehör zu verschaffen imstande wäre.
ZEITDRUCK
Die Redakteurin
Claudia S. hat Germanistik studiert und noch während ihres Studiums den Verein "KARUNA" mitgegründet. "Ich bin ja außerdem noch so 'n Wendeprodukt. Während meines Studiums war der Mauerfall und wenn der nicht gewesen wäre, würde ich heute im Zentralinstitut für Sprachwissenschaft sitzen."[109] Zum Ende ihres Studiums arbeitete sie im Juli '92 für fünf Wochen an der Universität in Worcester bei Boston an dem Abschluß eines Forschungsprojekts. Diese Erfahrung brachte sie zu der Entscheidung, nicht professionell als Germanistin im Wissenschaftsbetrieb arbeiten zu wollen. Sie bezeichnete ihr Spezialgebiet, die Sprachwissenschaft, als sehr interessant. Aber das Verhältnis von Zusammenarbeit mit Menschen und der Arbeit am Schreibtisch bzw. Computer, das sie mit 1:99 quantifizierte, entsprach nicht ihren Vorstellungen und Bedürfnissen. Somit entschied sie sich für die Anstellung bei "KARUNA", wo sie ab Oktober '92 als Projektleiterin die" BLEIBE" aufbaute.
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, daß in der DDR die MitarbeiterInnen in den Jugendclubs keine Sozialarbeiter waren. Es gab keine Sozialarbeiterausbildung, lediglich ein Studium "Jugendclubleiter", was nach Angaben von Claudia S. nur wenige absolviert hatten. Unter den Gründungsmitgliedern von "KARUNA" befand sich kein einziger Sozialarbeiter, stattdessen ein Stukkateur, ein Baumaschinist, eine Lehrerin, eine Germanistin usw. In der DDR war es üblich, daß Leute aus anderen Berufen in die Jugendarbeit eingestiegen sind.
Claudia S. arbeitete hauptamtlich in der "BLEIBE" und war daneben verantwortlich für den Aufbau der Zeitung. Mittlerweile beansprucht die Zeitungsarbeit fast die vollständige Arbeitszeit. Die hinzugekommene Arbeit an der Zeitung entsprach dann noch mehr ihren Vorstellungen, weil sie neben den Kontakten mit den Jugendlichen ihr ursprüngliches Betätigungsfeld als Germanistin, die Arbeit mit Texten, ausfüllen konnte. Ihr war es wichtiger, daß die Jugendlichen Spaß an der Arbeit haben, etwas schreiben und auch dabei lernen, z.B. mit dem Computer umzugehen, als die Möglichkeit, über den Verkauf Geld zu verdienen.[110]
Die Vorbereitungen
Claudia S. und einige Jugendliche haben an dem "Runden Tisch" am 19. Februar mit der Vorstellung teilgenommen, "daß man womöglich eine gemeinsame Zeitung machen könnte."[111] Ihrer Einschätzung nach hatten aber alle anderen Parteien schon ihr Konzept, von dem sie eigentlich auch gar nicht ablassen wollten. Es sei merkwürdig gewesen, sie hätten geredet und geredet und George Mathis habe immer wieder betont, er wolle nur die Idee transportieren und ansonsten gar nichts weiter. "Aber dann lag sie da, die Zeitung. Das war natürlich für uns, die wir alle in den Kinderschuhen steckten, 'n bißchen hart."[112] Als klar gewesen sei, daß nichts zusammen geht, habe "mob" den Leuten von" ZEITDRUCK" angeboten, als Beilage zu erscheinen. Das erschien als nicht akzeptabel und war dennoch typisch: Jugendliche als Beilage und nicht als Spezifikum. Nach dem Scheitern dieses Kooperationsversuchs fiel dann die Entscheidung, eine eigene Zeitung herauszugeben. Mit "mob" wurde eine zeitlich befristete Zusammenarbeit vereinbart. In den ersten beiden Ausgaben von "mob" konnte "ZEITDRUCK" jeweils eine Seite gestalten, womit sie die Möglichkeit hatten, ihr Projekt vorzustellen, Öffentlichkeit herzustellen und auf den Start ihrer eigenen Zeitung aufmerksam zu machen, der für den 1. Mai terminiert war. Es gab eine Absprache mit "mob", alternierend vierzehntägig zu erscheinen: "ZEITDRUCK" am Anfang des Monats und "mob" Mitte des Monats. Trotzdem erschien "mob" auch am 1. Mai.
Die Finanzierung der ersten Ausgabe wurde durch die Stiftung "Demokratische Jugend" geleistet, die schon andere Projekte von "KARUNA" gefördert hatte, wodurch die Antragsbewilligung relativ unkompliziert erfolgte.
Redaktionelle Arbeit
Die redaktionellen Vorarbeiten für die erste Ausgabe fanden unter schlechten Voraussetzungen statt. Es gab noch keine eigenen Redaktionsräume, so daß in der "BLEIBE" und in Privatwohnungen gearbeitet werden mußte, und es mangelte an den notwendigen technischen Arbeitsgeräten, so daß die Zeitung "irgendwie chaotisch mit vielen Engagierten zusammengeschustert"[113] worden ist. Zur zweiten Ausgabe stand ein Redaktionsraum zur Verfügung und die Stiftung "Demokratische Jugend" hatte nochmal finanzielle Mittel für zwei Computer bereitgestellt und ein Auto für den Vertrieb geschenkt.
Auf den wöchentlichen Redaktionssitzungen werden die Themen und die Gestaltung gemeinsam festgelegt. Claudia S. bringt sowohl ihre eigenen Ideen, die sie aber nicht als Vorgaben verstanden wissen will, als auch die Texte und Fotos, die ihr zugeschickt worden sind, ein. " Es ist Demokratie pur, und wir sitzen da stundenlang und reden über allen möglichen Kram."[114]
Es sind ca. zehn Leute, die regelmäßig bei der Zeitung mitarbeiten. Vorrang für die Jugendlichen hat die Arbeit an der Zeitungsproduktion, während das Geldverdienen absolut in den Hintergrund getreten ist. Probleme gibt es nur auf Vertriebsebene, redaktionell klappt es gut.
Die Ausgaben vier und fünf (Sept. und Okt.) wurden von einer Augsburger Consulting-Firma technisch produziert und finanziert. Der Geschäftsführer hatte "ZEITDRUCK" dieses Angebot gemacht, "weil sich Wirtschaftsunternehmen stärker im sozialen Bereich engagieren sollten."[115] Dieses sozialpolitische Engagement wurde auf den letzten Seiten jeweils begründet und andere dazu aufgefordert. "Solange der Nachwuchs auf die Straße ausweichen muß, weil keine geeigneten Plätze geboten werden, darf kein Pfennig aus dem Steuersäckel für neue Regierungsgebäude, Atomkraftwerke oder die Bundeswehr ausgegeben werden. Politischer Druck ist also die allererste Aufgabe, der wir nachgehen müssen. Doch solange die wirklich Verantwortlichen sich vor der Wahrnehmung ihrer Pflichten drücken, muß Hilfe her. Denn die Kids brauchen uns jetzt."[116]
Plötzlich, von einem zum anderen Tag, hat diese Augsburger Firma im Oktober ihre Unterstützung beendet, was aber nicht ausführlich erklärt wurde. Dadurch, daß das gesamte Material für die nächste Ausgabe schon abgeschickt worden war, entfiel diese und es sollte im Dezember eine Doppelausgabe erscheinen. Zu Anfang Dezember zog die Redaktion in neue Räume, die in unmittelbarer Nähe zum "DRUGSTOP" liegen, so daß eventuell einige Jugendliche eher zu einer Mitarbeit zu bewegen wären, weil sie nicht mehr bis in einen anderen Bezirk fahren müßten.
Auch bei der Erstellung dieser Doppelausgabe gab es finanzielle und technische Schwierigkeiten, so daß nochmals umdisponiert und neu konzipiert wurde. "Erst jetzt, wenige Tage vor Weihnachten, könnte unsere Zeitschrift in Druck gehen. Doch leider macht die verlorene Zeit unsere Ausgabe unaktuell. Zudem kommen überhöhte Druckkosten zur Weihnachtszeit. Dafür erwartet Euch zum 5. Februar des neuen Jahres eine um 8 Seiten erweiterte ZEITDRUCKausgabe. Zudem kommt ZEITDRUCK ab 1995 nun nicht mehr als Zeitung, sondern eher als Magazin."[117]
Finanzielle Entwicklung und Vertrieb
Die Zeitung war bisher kaum von hohen Verkaufszahlen abhängig, um ihre Existenz zu gewährleisten. Durch die Unterstützung der Stiftung "Demokratische Jugend", als auch der Tatsache, daß Claudia S. nicht über die Verkaufseinnahmen finanziert werden mußte, konnte "ZEITDRUCK" in der dritten Ausgabe einen Gewinn von fast 5.000 DM nach den ersten beiden Ausgaben öffentlich machen. Das "socialsponsoring" aus Augsburg war eine zusätzliche finanzielle und arbeitstechnische Entlastung, die nun, nach dem Wegfall, durch verstärkte Verkaufsbemühungen kompensiert werden muß. Die Redaktion arbeitet jetzt mit einer Berliner Agentur zusammen, die das Layout kostenlos erstellt. Zur Finanzierung der Druckkosten reichen die bisher durchschnittlich verkauften ca. 4.000 Exemplare allerdings nicht aus. Die Auflage soll mit der nächsten Ausgabe von 15.000 auf 6.000 Exemplare reduziert werden.[118]
Seit dem 15.10.94 gibt es zwei Stellen, die nach dem Arbeitsförderungsgesetz beantragt worden sind, d. h. sie werden vom Arbeitsamt und der Senatsverwaltung finanziert. Eine davon für einen Layouter, die andere für den Vertrieb. Der Vertrieb lief bisher über den Handverkauf der Jugendlichen und über die Jugendclubs. Er wurde mehr oder weniger nebenbei organisiert, was zur Zeit durch den neuen Vertriebsleiter strukturiert und effektiviert werden soll.
Die VerkäuferInnen mit Druck zum Verkaufen anzuhalten, bewirkt laut Claudia S. gar nichts, es geht nur mit Motivation. Auch hier geht die Erfahrung gerade der sehr jungen, etwa zwölfjährigen VerkäuferInnen dahin, daß sie durchs "Schnorren" (Betteln) mehr und leichter Geld erhalten als durch den Zeitungsverkauf, wo sie aktiv werden und reden müssen. "Das hatten wir als sozialpädagogisches Konzept: sie müssen nicht mehr betteln, sondern können ein Produkt anbieten. Das ist aber gar nicht so wichtig."[119] Der Entwicklung von Kontinuität steht auch entgegen, daß die Jugendlichen den Verkauf in "Hau-Ruck-Aktionen" durchführen. Sie verkaufen relativ viele Zeitungen und haben dadurch entsprechend viel Geld, was für die nächste Zeit ausreicht. Es gibt auch ein Stück Ablehnung bei den Jugendlichen, die Angst in einen Resozialisierungsprozeß zu rutschen. Es sei für die Jugendlichen ungewohnt, irgendetwas zu machen und damit Geld zu verdienen, eben diese Regelmäßigkeit. Dann gebe es immer mal wieder so einen "Block": "und jetzt mach' ich erstmal wieder gar nichts".[120] Diese Probleme treten auch bei anderen Projekten des Vereins auf.
"ZEITDRUCK" hatte schon für 1994 einen Antrag beim Bundesministerium für Frauen und Jugend auf einen Druckkostenzuschuß gestellt, der aber abgelehnt wurde, weil es kein bundesweites Projekt ist. Dieser Antrag wurde für 1995 erneut gestellt, einerseits weil die Zeitung seit September '94 durch die Kooperation mit "DOMPLATT" aus Köln nicht mehr nur ein Berliner Straßenblatt ist, und andererseits wird eine Zusammenarbeit mit anderen deutschen Großstädten angestrebt. "Ohnehin ist die Problematik nichtseßhafter Kinder und Jugendlicher nicht auf Berlin beschränkt, die Probleme sind überall ähnlich."[121] Deswegen wird eine bundesweite Zusammenarbeit sowohl inhaltlich als auch im Vertrieb zu erreichen versucht. Darüber hinaus existieren ansatzweise Kooperationen mit Straßenzeitungen aus Italien, Dänemark, Tschechien und Polen.
Die Vertriebs- bzw. Verkaufsprobleme wurden und werden auf den Redaktionssitzungen immer wieder thematisiert. Die Überlegungen gingen auch in die Richtung, andere Vertriebswege oder Erscheinungsformen ins Kalkül zu ziehen, die dann allerdings von dem Muster 'Obdachlosenzeitung mit Handverkauf' abweichen würden. Wichtig sei nur, daß solch eine Veränderung öffentlich klargestellt werden müßte. Noch wichtiger aber sei die Weiterexistenz von "ZEITDRUCK", da die Kinder und Jugendlichen sich mit ihrer Zeitung identifizieren.
Resümee
"ZEITDRUCK" läßt sich zwar auch zu den Obdachlosenzeitungen rechnen, hebt sich aber von diesen durch die ausschließliche Berichterstattung aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen deutlich ab. Drei Gründe scheinen die vergleichsweise konfliktarme Entwicklung des Projekts ermöglicht zu haben. Zum einen haben sie sich genügend Zeit genommen, um die konzeptionellen Fragen zu klären. Desweiteren haben an diesem Gründungsprozeß die Betroffenen von Anfang an gleichberechtigt teilgenommen, und schließlich halte ich den Faktor für wichtig, daß die Zeitung aus einem bestehenden, sozialen Zusammenhang heraus entwickelt wurde, wie ihn die "BLEIBE" für die Jugendlichen darstellte.
Obwohl die Zeitung von 'Profis' initiert wurde und mit Claudia S. eine Akademikerin und Sozialarbeiterin zur "Chefredakteurin" hat, kann man meiner Meinung nach eindeutig von einer Zeitung sprechen, die von und mit Betroffenen hergestellt wird, und nicht für sie. Daß die durch die Vertriebsprobleme bedingte perspektivische Existenzunsicherheit eventuell auch dadurch überwunden wird, daß "ZEITDRUCK" z.B. über Kioske ihre LeserInnen findet, erscheint mir praktikabel und gerechtfertigt. Wesentlicher als die Tatsache, daß einige jugendliche Obdachlose durch den Verkauf Geld verdienen können, ist die Bedeutung der Zeitung für die Kinder und Jugendlichen, die sie machen, und ihrer insbesondere jungen LeserInnen. Zudem halte ich es für nicht unwahrscheinlich, daß die Absatzchancen für" ZEITDRUCK" auch über konventionelle Vertriebswege eher steigen, zumal die VerkäuferInnen offenbar nur gering motiviert sind.
7. MOBILISIERUNGSFAKTOR U N D MARKTLÜCKE
(Zusammenfassung)
Meiner Meinung nach stellen die Obdachlosenzeitungen in Berlin einen Mobilisierungsfaktor für Betroffene dar u n d schließen zudem eine publizistische Marktlücke. Letzteres aber nicht im Sinne einer profitträchtigen Verwertbarkeit, sondern eher als Kritik am praktizierten Journalismus der (Print-) Medien.
Keine der Zeitungen begann und entwickelte sich als originäre Selbsthilfegruppe. Die InitiatorInnen waren entweder SozialarbeiterInnen ("mob" und "ZEITDRUCK") oder ehemalige Betroffene, die sich schon wieder etabliert hatten ("HAZ" und "Platte"). Aus diesem Grunde möchte ich von professionell angeleiteten Selbsthilfegruppen sprechen, wobei sich die Fähigkeiten der InitiatorInnen nur zum Teil auf die Zeitungsarbeit bezogen, als mehr auf die Durchführung und Strukturierung von Projektarbeit.
Die Beschreibungen der Betroffenen ihrer Mitarbeit bei einer Zeitung und der dadurch eingetretenen Veränderungen in ihrem Leben, die regelmäßig dort veröffentlicht wurden, bekunden in der Regel vornehmlich Positives. Zunehmend werden zwar auch die Probleme und Widrigkeiten eines Verkaufsalltags dargestellt, dennoch überwiegen eindeutig die Vorteile, die sich aus ihrer Tätigkeit ergeben.
Neben der Verdienstmöglichkeit durch den Verkauf, infolge dessen sich hin und wieder einige der für den "Normalbürger" üblichen Partizipationsmöglichkeiten am Konsumgeschehen realisieren lassen, wie z.B. Restaurant und Kinobesuche, der Kauf neuer Kleidung oder die Übernachtung in einem sauberen und ruhigen Pensionszimmer, werden immer wieder Veränderungen des Selbstwertgefühls und des Selbstbewußtseins konstatiert. Die mehr oder weniger regelmäßige Verkaufs-, Vertriebs- oder Redaktionstätigkeit vermittelt Lebenssinn, der üblicherweise nur darin besteht, von einer Wärmestube zur nächsten Suppenküche zu ziehen, um satt zu werden, ab und zu zu duschen und sich nachmittags über den nächtlichen Schlafplatz Gedanken zu machen. So überlebensnotwendig dieser Ablauf ist, so ist er doch gleichermaßen nur auf das ÜBERleben reduziert. Zudem wird durch die Arbeit die weit verbreitete Isolation ein Stück weit überwunden, es entsteht ein Gefühl der sozialen Zusammengehörigkeit innerhalb eines Zeitungsprojekts. Darüber hinaus stellt für die meisten ihre Tätigkeit den Ansatz einer Rückkehr zu geregelter Arbeit dar, die auch bezahlt wird und sie somit vom Betteln oder Sozialamt unabhängig macht. Das ist insofern von Bedeutung, als von Betroffenen Ämter- oder Behördengänge als wahre Qual erlebt werden, so daß sie oft auf ihre Ansprüche verzichten und sogar das Betteln vorziehen. Auch der Wegfall der bisher notgedrungen praktizierten Kleinkriminalität und Prostitution durch den neuen Verdienst wird beschrieben. Ferner wird davon berichtet, daß Verkäufer nun die Kraft finden, einen Alkoholentzug erfolgreich durchzuhalten, wobei sie von bis kurz zuvor ebenfalls Abhängigen unterstützt werden. Desweiteren stellt nicht nur der Kauf einer Zeitung für sie eine Anerkennung dar, sondern die Bereitschaft der KäuferInnen auch zu einem Gespräch mit den Betroffenen macht sie selbstsicherer, zeugt es doch von Interesse an ihrer Situation, die sie ansonsten meistens als Anlaß von Ablehnung und Ausgrenzung erleben. Diese positiven, individuell erfahrenen Fortschritte können natürlich nicht die strukturellen Benachteiligungen, denen sie unterliegen, gravierend verändern. Nur in Einzelfällen erhielten Verkäufer aufgrund ihrer Tätigkeit eine Wohnung. Dennoch stellt die Aneignung der Betrachtungsweise, selbst etwas bewegen zu können, den notwendigen ersten Schritt dar.
Nur eine Minderheit der Obdachlosen ist überhaupt in der Lage, den Schritt von der passiven Haltung zur aktiven Mitgestaltung zu vollziehen. Geht man von den Verkaufszahlen der Zeitungen aus wird offensichtlich, daß sich überhaupt nur eine sehr begrenzte Anzahl durch den Verkauf einen notdürftigen Erwerb sichern kann. Ob es irgendwelche Kriterien oder sozialen Merkmale wie z.B. Bildung, Alter, Dauer der Obdachlosigkeit etc. gibt, die die Aktiven untereinander verbinden, konnten mir selbst die dort Tätigen nicht beantworten.
Ein anderer Aspekt erscheint erwähnenswert, den Stefan S. im Interview beschrieben hat. Die verschiedenen, in den letzten ca. vier Jahren entstandenen Projekte in der Obdachlosen-Szene, wozu nicht nur die Zeitungen, sondern auch Theatergruppen, Literaturlesungen über, von und mit Obdachlosen, gemeinsame Arbeiten von Künstlern und Regisseuren mit Betroffenen usw. zählen, treiben Spaltungen und Differenzierungen in der Szene voran und erzeugen Spannungen. Da gebe es die "Stars", die auf Tournee gehen, zu publizieren beginnen, zu Konferenzen fahren oder politische Lobbyarbeit leisten. Daneben existiere die Gruppe der "Hiwis", die daran mitarbeitet und davon profitiert, desweiteren die "Laufburschen" usw. Diese Ausdifferenzierung setze sich nach oben und unten fort, wodurch von der ehemals angenommenen, dennoch nie real vorhandenen, Gleichheit der Wohnungslosen nun gar nicht mehr die Rede sein könne. Diese Projekte seien auch eine Reaktion auf den veränderten Problemdruck, der sich aus der Zunahme der Obdachlosigkeit unter jungen Menschen, Frauen und innerhalb der unteren Mittelschicht ergebe. Die Resulte dieser Spaltungen wie informelle Hierarchien, stereotypische Klassifizierungen oder Neid auf hohe Verkaufszahlen eines anderen wurden von den Betroffenen und auch den Initiatoren geschildert.
Die Frage nach der publizistischen Marktnische im Sinne eines profitablen neuen Absatzmarktes stellt sich bisher in Berlin nicht. Während nur "Platte" nennenswerte Überschüsse erwirtschaftet, sind die anderen drei Zeitungen auf Spenden, Anzeigen und "socialsponsoring" angewiesen, um ihre Existenz zu sichern. Sollten sich auch hier durch erhöhte Verkaufszahlen Gewinne in größeren Dimension ergeben, stellt die rechtliche Konstruktion der gemeinnützigen Vereine ein Hindernis dar, das eine private Bereicherung nicht zuläßt.
Dennoch haben diese Zeitung eine inhaltliche publizistische Marktlücke gefüllt. Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit den Themen Wohnungslosigkeit und Armut, die angesichts der politischen Entwicklungen der letzten 15 Jahre immer weitere Kreise der Bevölkerung betreffen oder bedrohen. Diese brisanten politischen Aufgabenstellungen haben sowohl mit Sozial- und Innenpolitik, als auch Wirtschafts- und Wohnungsbaupolitik zu tun. Die Darstellung des Zusammenspiels dieser Politikfelder, konzentriert auf das Thema Obdachlosigkeit, stellt das Neue an diesen Zeitungen dar.
Die etablierten Zeitungen behandeln dieses Thema entweder in Form eines spektakulären Einzelfalls oder als statistische Größe, die mit Zahlen und Fakten das Problem zu beschreiben sucht. Die Obdachlosenzeitungen dagegen haben die Möglichkeit, die Strukturen und Bedingungen des Alltags der Betroffenen zu vermitteln, was aber nur solange realisiert werden kann, wie sie ein Basis- und Betroffenenkonzept verfolgen, was schon die alternativen Zeitungen in den 70er Jahren in ihrer Abgrenzung zu den etablierten kennzeichnete.[122] Ein weiterer Aspekt den Stamm beschrieb, daß die professionellen Zeitungen Themen der alternativen aufgegriffen haben, scheint sich bei den Obdachlosenzeitungen zu bestätigen. Sonja K. berichtete, daß sie vier Fälle nennen könnte, in denen die "HAZ" ein Thema in der Zeitung behandelte, das von größeren Redaktionen aufgenommen und weiter bearbeitet wurde. Im Gegensatz zu der damaligen Alternativpresse erreichen die heutigen Obdachlosenzeitungen eine höhere Auflage und breitere Bevölkerungskreise. Wenn sie denn gekauft, um gelesen zu werden, und nicht nur aus Solidarität, was aber wahrscheinlich für die Mehrheit der KäuferInnen nach Einschätzung der Betroffenen und einer Umfrage in Paris[123] gilt, so könnten sie den Status einer "populären Fachzeitschrift" erlangen.
Der Begriff Obdachlosenzeitung läßt zunächst die Assoziation entstehen, als handele es sich dabei um eine ausschließlich von Obdachlosen hergestellte Publikation. Das trifft aber auf keine derjenigen zu, die in höherer Auflage im Straßenverkauf angeboten werden. Die Kenntnisse und Beziehungen in technischer und finanzieller Hinsicht können Betroffene aus ihrer Situation heraus gar nicht aufweisen, was allerdings nicht ausschließt, daß sie nach einer entsprechenden Einarbeitung und Erfahrung die Zeitung selbstständig und eigenverantwortlich herausgeben. Unabhängig davon, ob dieses Ziel konzeptionell anvisiert wurde, stellt die Durchführung eines solchen Projekts ein Experiment dar. Wesentlich für die Etablierung einer Zeitung, die auch als authentisches Sprachrohr der Betroffenen fungieren soll, erscheint mir die Motivation und Einstellung der "Profis". Toleranz, Geduld, Abgrenzungsfähigkeit und die Bereitschaft, sich auf die Betroffenen einzulassen, alles Charakteristika der Sozialarbeit, scheinen unabdingbare Voraussetzungen zu sein, soll es ein Blatt werden, mit dem sich die Obdachlosen identifizieren können, was wiederum, nach Meinung obdachloser Mitarbeiter, Bedingung für Motivation und Engagement der VerkäuferInnen ist.
In Berlin existieren vier, zum Teil sehr unterschiedliche, Obdachlosenzeitungen. So sehr diese Tatsache interessante Vielfalt und Wahlmöglichkeit bedeudet für Käufer und Verkäufer, bin ich doch der Meinung, daß nur eine oder zwei Zeitungen auf eine größere Akzeptanz der Bevölkerung stoßen würde. Die regelmäßige Konfrontation mit unterschiedlichen Zeitungen besonders in der U-Bahn, wo zusätzlich Musikanten und notleidende Menschen die Aufmerksamkeit und eine Spende der Fahrgäste erbitten, trägt eher zur Verwirrung oder Desinteresse bei. Zudem könnten im Falle einer Konzentration der Kompetenzen und finanziellen Mittel auf weniger Zeitungen, diese umfangreicher und ausführlicher auf soziale Probleme eingehen, die über die Obdachlosigkeit hinausreichen und dadurch mehr Menschen ansprechen.
Die Idee dieser Art von Zeitung scheint zumindest so attraktativ, daß immer mehr Initiativen in anderen Städten bekannt werden.
LITERATUR
keine Angaben
Fußnoten
[1] vgl. Frankfurter Rundschau vom 24.10.94, BISS Nr.2, Hinz & Kunz(t) Nr.2
[2] vgl. Rosenke, S.73
[3] vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 5.2.1994
[4] haz Nr. 3, S. 8
[5] Frankenberg u.a., 1991, S.8
[6] vgl. Heins, S. 71
[7] vgl. Heins, S. 81
[8] vgl. Heins, S. 144; Rosenke, S. 75; Schmid, S. 151
[9] Michael Puhlmann, S. 230
[10] vgl. Hinz & Kunz(t) Nr.1, S. 5
[11] Untertitel von THE BIG ISSUE
[12] vgl. Vilmar, S. 17
[13] vgl. Friedrichs, S. 308 [14] vgl. Friedrichs, S. 324
[15] mob Nr.1, S.3
[16] Regina T., Vorstandsmitglied von BIN e.V., 13.6.94
[17] Regina T., 13.6.94
[18] Regina T., 13.6. und 14.12.94, Stefan S., Vereinsmitglied von BIN e.V., 8.12.94
[19] Regina T., 14.12.94
[20] Presseerklärung vom 18.2.1994
[21] Lars F., 3.6.94, Sonja K., 4.8.94, Vera R.,24.10.94
[22] Lars F., 3.6.94
[23] mob Nr.6, S.3
[24] Stefan S., 8.12.1994
[25] ebenda
[26] Burga K. auf der Vereinssitzung am 30.11.94
[27] Frank K., 23.8.1994
[26] Sonja K., 21.11.1994
[29] haz Nr.3, Juni 1994, Seite 2
[30] Platte Nr.3, S. 16 und 17
[31] Frank K., 23.8.1994
[32] Selbstdarstellung im Pressespiegel nach Erscheinen der Nr.1
[33] Interviews vom 18.8. und 5.12.1994
[34] Claudia S., 18.8.1994, zitiert die Jugendlichen
[35] Interview vom 24.10.1994
[36] Interviews vom 3.6. und 19.11.1994
[37] Lars F., 3.6.1994
[38] Interviews vom 4.8. und 21.11.1994
[39] Lars F., 19.11.1994
[40] Regina T., Vorstandsmitglied von BIN e.V., vom 13.6.1994
[41] Diesem Vorwurf hat George Mathis in einem Interview in haz Nr. 3 widersprochen.
[42] Regina T., 14.12.1994
[43] Vera R., 24.10.94
[44] Sonja K., 4.11.94
[45] Pressekonferenz 18.2.1994, Presseerklärung, Seite 1
[46] Vera R., 24.10.94
[47] ebenda
[48] Lars F., 19.11.1994
[49] Sonja K., 21.11.1994
[50] Lars F., 3.6.1994
[51] Vera R., 24.10.94
[52] ebenda
[53] Regina T., 14.12.1994
[54] Lars F., 19.11.1994
[55] Vera R., 24.10.1994
[56] Sonja K., 21.11. und Lars F., 19.11.1994
[57] Sonja K., 21.11.1994
[58] ebenda
[59] Vera R., 24.10.1994
[60] Sonja K., 4.8.1994
[61] Flugblatt der Besetzer
[62] Sonja K., 4.8.1994
[63] die tageszeitung vom 27.4.94, Seite 18
[64] Sonja K., 4.8.1994
[65] Vera R. 24.10.1994
[66] ebenda
[67] mob Nr.4, Seite 3
[68] mob Nr.4, Seite 13
[69] Vera R., 24.10 und Lars F., 19.11.1994
[70] Stefan S. bezifferte die Mitgliederanzahl von BIN mit ca. 10 aktiven und 50 nominellen.
[71] Vera R., 24.10.1994
[72] Unveröffentlicht, liegt dem Verfasser vor.
[73] Vera R., 24.10.1994
[74] Regina T., 14.12.1994
[75] Lars F., 19.11.1994
[76] ebenda
[77] ebenda
[78] ebenda
[79] ebenda
[80] Gespräch mit Horst H., Heiko M. und Ralf S., 6.12.1994
[81] Regina T., 14.12.1994
[82] die tageszeitung vom 27.4.94, Seite 18
[83] Jens L., 6.12.1994
[84] Stefan S., 8.12.1994
[85] ebenda
[86] ebenda
[87] Jens L., 6.12.1994
[88] ebenda
[89] Jens L. auf der Vereinssitzung am 30.11.1994
[90] Sonja K., HAZ Nr.5, Seite 2
[91] Regina T., 14.12.1994
[92] Jens L., 6.12.1994
[93] Stefan S., 8.12.1994
[94] haz Nr.3, S. 8 und 9, Interview mit George Mathis
[95] Frank K., Interview vom 23.8.1994
[96] haz Nr.3, S. 9
[97] Frank K., 23.8.1994
[98] haz Nr.3, S. 9
[99] Sonja K., 21.11.1994
[100] ebenda
[101] ebenda und 4.8.1994
[102] ebenda
[103] ebenda
[104] ebenda
[105] Frank K., 23.8.1994
[106] Platte Nr.2, S. 14
[107] Frank K., 23.8.1994
[108] Platte Nr.12, S.27
[109] Claudia S., 5.12.1994
[110] ebenda
[111] ebenda
[112] ebenda
[113] ebenda
[114] ebenda
[115] ZEITDRUCK Nr.4, Seite 3
[116] ebenda, Seite 24
[117] Brief an alle AbonenntInnen vom 21.12.1994
[118] Claudia S., 5.12.1994
[119] ebenda
[120] Claudia S., 18.8.1994
[121] Claudia S., 5.12.1994
[122] vgl. Stamm, S. 246
[123] haz Nr.3, S. 8
Autor
Thomas Knuf
Adalbertstr.25
10179 Berlin
Rosenke, Werena: "Bunte Blätter": die bundesdeutschen Straßenzeitungen ... etabliert. Bielefeld 1995
Werena Rosenke
"Bunte Blätter": die bundesdeutschen Straßenzeitungen haben sich etabliert
Eine Bestandsaufnahme
- Einführung
- Entstehungsgeschichte
- Ziele und Arbeitsweisen
- Die verkaufsorientierten - "Straßenzeitungen mit sozialem Touch"
- Versuch einer Einschätzung - Hilfe zur Selbsthilfe
- Straßenzeitung - kein Projekt für wohnungslose Frauen?
- Konkurrenz schadet dem Geschäft
- Beteiligung und Qualifizierung der Betroffenen
- "Aus Bettlern werden Gesprächspartner"
- Nicht Mitleid, sondern Interesse
- Zusammenfassung
Einführung
Zeitungen, die von Wohnungslosen (mit)gestaltet und/oder auf der Straße von Wohnungslosen verkauft werden, sind eine relative neue Erscheinung in der Bundesrepublik. Zwar kam bereits im Juni 1992 in Köln der Bank-Express - heute Bank-Extra - heraus, der Boom wurde aber erst nach dem fulminanten Start von BISS im Oktober 1993 in München und Hinz & Kunzt im November 1993 in Hamburg ausgelöst. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt habe ich 31 Zeitungsprojekte gezählt. Bis zur Veröffentlichung dieses Beitrages werden vermutlich noch einige dazu gekommen sein. Die Zeitungen sind nicht nur eine Großstadterscheinung, sondern es gibt sie auch in Klein- und Mittelstädten. Zwar ist die überwiegende Zahl der Projekte in den westlichen Bundesländern angesiedelt, aber gerade in den letzten Monaten sind Zeitungen in Schwerin, Chemnitz, Rostock, Leipzig erschienen bzw. in Vorbereitung.
Die Zeitungen unterscheiden sich deutlich nach Form und Inhalt, Anspruch und Organisationsprinzip, so daß eine einheitliche Bezeichnung problematisch ist. Am neutralsten erscheint mir noch der Begriff Straßenzeitung.
Grob lassen sich die Blätter zwei Kategorien zuordnen:
- aufklärungsorientierte Publikationen, wollen bei der Bevölkerung durch Aufklärung Verständnis wecken, beschäftigen sich hauptsächlich mit der Thematik Wohnungslosigkeit und verstehen sich als Medium und Sprachrohr Betroffener;
- verkaufsorientierte Publikationen, wollen möglichst vielen Wohnungslosen durch den Straßenverkauf eine Möglichkeit eröffnen, "sich selbst zu helfen". Diese Blätter sind mehr als andere auf eine hohe Auflage und regelmäßiges Erscheinen angewiesen. Dies impliziert ein weitgehend professionelles Mitarbeiterlnnenteam sowie Inhalte mit größerer Breitenwirkung.
Grundlage dieser Zuordnung ist die Hauptintention. Natürlich wollen viele aufklärungsorientierte Zeitungen ihr Blatt auch verkaufen und umgekehrt haben verkaufsorientierte selbstverständlich auch einen Aufklärungs- und Informationsanspruch und wollen Lobby Betroffener sein.
Entstehungsgeschichte
Für die verkaufsorientierten Blätter dient zumeist die wohl etablierteste und professionelleste Straßenzeitung als Vorbild, die englische "The Big Issue". Gordon Rodnick, Initiator und Hauptfinanzier der Zeitung, brachte die Projektidee von einer seiner Geschäftsreisen aus New York mit. "Street News" hieß die Wohnungslosenzeitung, die dort schon auf der Straße angeboten wurde. Rodnick, Inhaber der Kosmetikkette "The Body Shop", hat BIG ISSUE schon mit mehreren hunderttausend DM unterstützt. BIG ISSUE erschien erstmalig im September 1991 als Monatsmagazin mit einer Startauflage von 50.000 Exemplaren. Inzwischen hat Big Issue Ableger in anderen britischen Städten und erscheint allein in London mit einer wöchentlichen Auflage von 100.000 Exemplaren, die von ca. 800 Verkäuferlnnen vertrieben werden. Knapp 70% der Einnahmen werden durch den Verkauf erwirtschaftet, der Rest durch Werbung, Spenden und Sponsoren. Ebenfalls zum Projekt gehört der vom Herausgeber John Bird formulierte Anspruch, Verkäuferlnnen nebenher in einem Beruf des Zeitungsmetiers auszubilden, zumindest zu qualifizieren. Bird will bei den Wohnungslosen Verantwortung für das eigene Leben wecken. Sie sollen wieder lernen, auf eigenen Füßen zu stehen, so daß letztendlich die Mitarbeit im Zeitungsprojekt überflüssig wird. Ansonsten lautet Birds Devise: "Keine moralisierende Botschaft! Almosen halten Menschen nur in Unselbständigkeit." Entsprechend ist die Zeitung auch aufgemacht: Vierfarbdruck, 40 Seiten Umfang, eine bunte Themenmischung mit leicht sozialem Touch: Gesundheit, Kultur, sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, Konsumterror, Freizeit, Rezensionen, Kulturkalender. Daneben gibt es die ständigen Rubriken: News (Kommunalpolitisches und Vermischtes) (2 Seiten), International (1 Seite), Capital Lights (Betroffenenforum) (2 Seiten), Missing (Vermißtensuche) (l Seite), Leserbriefe und nützliche Adressen. Gut die Hälfte des Verkaufspreises bleibt den Verkäuferlnnen.
Ziele und Arbeitsweisen
Einige Prinzipien sind allen Projekten - verkaufs- und aufklärungsorienten - gemein:
- Hilfe zur Selbsthilfe" leisten
- nicht Mitleid, sondern Interesse wecken
- Beteiligung von Betroffenen
- Kommunikation zwischen wohnungsloser und wohnender Bevölkerung erleichtern, um Vorurteile abzubauen.
In der Interpretation dieser Grundprinzipien gibt es jedoch deutliche Unterschiede. Typische Beispiele für die Kategorie "aufklärungsorientiert" sind Blätter wie Bank-Extra, Köln, Heidelberger Rundschlag, Adler-Express, Karlsruhe, DAS DACH, Chemnitz, Platte (Rheinland-Pfalz), Die Kippe, Leipzig.
Einige dieser Zeitungen wie der Adler-Express erscheinen nur unregelmäßig oder müssen das Erscheinen vorübergehend einstellen. In diesem Projekt kommt man ganz ohne professionelle Mitarbeiterlnnen aus. Gearbeitet wird ausschließlich ehrenamtlich. Das Erscheinen des Blattes ist damit vollkommen abhängig von der aktuellen Zahl engagierter Mitarbeiterlnnen. Bei der geringen Auflage steht der Straßenverkauf naturgemäß nicht im Mittelpunkt der Aktivitäten. Sprachrohr sein, die Öffentlichkeit mit den eigenen Problemen bekanntmachen, z.T. um Verständnis werben. Dies sind die Stichworte, mit denen sich dieses Projekt beschreiben läßt.
Ganz explizit im Vordergrund steht die Aufklärungsfunktion bei dem "Dach" aus Chemnitz. Herausgeber ist die Tagesstätte für Wohnungslose der AWO Chemnitz. Die Zeitung wird "gemeinsam mit Gästen der Einrichtung" erstellt. Die Herausgeber verstehen die Zeitung als Teil ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Finanziert wird sie von der AWO Chemnitz und z.T. durch den örtlichen Sozialhilfeträger. Ziel ist es, "einer breiten Öffentlichkeit Informationen über wohnungslose Menschen und deren Lebenswelten zu vermitteln, um bestehende Vorurteile abzubauen." Dazu erhalten die Betroffenen die Möglichkeit, ihr Schicksal darzustellen. Das Dach erscheint vierteljährlich in einer Auflage von 1000 Ex. und wird kostenlos verteilt.
Nach ganz ähnlichem Prinzip arbeitet "Platte - Die Obdachlosen-Zeitung", ein Zeitungsprojekt in Rheinland-Pfalz. Im Herbst 1993 ist die erste Ausgabe erschienen. Initiator, Herausgeber und Vollfinanzier ist das rheinland-pfälzische Sozialministerium. Die Zeitung ist Teil eines geplanten und z.T. schon realisierten Projektesets: Kältebus, Schlafsackausgabe im Winter, Restaurants nach dem Vorbild der Frankfurter LobbyRestaurants. Der Projektleiter und -koordinator, Ralf Blümlein, mutmaßt zu den Gründen des ministeriellen Engagements: "Selbstdarstellung der Betroffenen befördern, Bild der Obdachlosen geraderücken, eine Lobby schaffen". Seine Einschätzung wird vom Ministerium bestätigt. Das Ministerium selbst hat keinen direkten Kontakt zu den Betroffenen oder zu Einrichtungen in Rheinland-Pfalz, mit denen die Aktivitäten im Rahmen des Gesamtprojekts abgestimmt werden könnten. Die Kommunikation wird von Blümlein organisiert. Die Gesamtkosten des Zeitungsprojekts für vier Ausgaben pro Jahr werden vom Ministerium getragen. Die Finanzierung ist zeitlich nicht begrenzt. Auf den Verkauf der Zeitung ist man nicht angewiesen, sie wird verteilt und ausgelegt. Wohnungsloseneinrichtungen, Kirchengemeinden etc. werden mit den nötigen Exemplaren beschickt. Auf den ersten Blick hat die Zeitung nicht allzuviel mit den Betroffenen selbst zu tun, sieht man davon ab, daß einzelne Texte von Betroffenen und Fotos, die Nicht-Betroffene gemacht haben, veröffentlicht werden. Aber für Blümlein ist es "die Zeitung der Betroffenen": Er pendele übers Land, suche die Wohnungslosen auf der Straße auf, diskutiere mit ihnen das Konzept des Blattes, sammele Beiträge ein. Er stehe auch in ständigem Kontakt zu den Einrichtungen, die die einzelnen Initiativen begrüßten und unterstützten. Anfragen erreichten ihn aus allen Landesteilen und inzwischen auch aus anderen Bundesländern.
Die "Kippe" in Leipzig wird von dem Verein "Hilfe für Wohnungslose" herausgegeben und ist Teil des "sozialarbeiterischen Projekts Teestube". Inhaltlicher Schwerpunkt ist die Wohnungslosigkeit, dargestellt in Interviews, Berichten, Kommentaren und in Porträts von Betroffenen. Die Ziele sind eindeutig: "Lobby schaffen", "Bevölkerung sensibilisieren", "Stimme sein für Betroffene, die sich über ihre Empfindungen, Meinungen und Hoffnungen artikulieren wollen", "lnteressen wecken". Es wird aber nicht nur informiert, sondern die Betroffenen sollen an der Herstellung beteiligt sein, so daß sie "das Gesicht der Zeitung wesentlich mitprägen" und die Zeitung verkaufen. Bei einer Auflagenhöhe von 1500 Ex. steht der Verkaufsaspekt sicher nicht im Vordergrund.
Das Kölner Blatt "BANK-EXTRA" ist eines der ältesten Zeitungsprojekte von Wohnungslosen. Bereits im Juni 1992 erschien die erste Auflage als Initiative von (ehemals) Betroffenen und Sozialarbeiterlnnen. Es ist ein Zeitungsprojekt, daß wohnungslosen Menschen die Möglichkeit geben soll, "sich mal so richtig auszukotzen", wie es in einer Pressemeldung vom Februar 1993 heißt, jedoch richtet sich das Blatt auch an Menschen mit Wohnung. Und in der Tat, die können viel erfahren von der Lebensrealität wohnungsloser Männer und Frauen in einer reichen bundesdeutschen Stadt. Regelmäßig werden Biographien veröffentlicht. In langen Textbeiträgen schildern Wohnungslose, solche die es waren oder die Angst haben, es über kurz oder lang zu werden, ihren Weg nach unten. Regelmäßig wird auch über die aktuelle Wohnungslosenpolitik in Köln, über Behördenwillkür, die Auseinandersetzung um die Öffnung der U-Bahnen im Winter berichtet bzw. einschlägige Briefwechsel mit Stadtratsabgeordneten, kirchlichen und anderen Würdenträgern dokumentiert. Meistens sind es die Betroffenen selbst, die mit ihren in der Regel nicht redaktionell bearbeiteten Texten zu Wort kommen. Leserlnnenbriefe von Nicht-Betroffenen werden aber auch gern veröffentlicht. Jetzt arbeiten acht Leute in der Redaktion, davon zwei Wohnungslose. Nach eigenen Angaben ist die Auflage des Bank - Extra von 400 Ex. bei Gründung auf jetzt 10.000 gesteigert worden, jedoch trägt sich das Projekt finanziell nicht selbst, die Defizite werden von der Benedikt - Labre - Hilfe getragen.
Die Zeitung, die alle zwei Monate erscheinen soll, wird nicht hauptsächlich im Straßenverkauf vertrieben, sondern entweder abonniert oder in Kirchengemeinden, bei Veranstaltungen oder an der Kölner Klagemauer verkauft. Aber eigentlich, so die Leute von BANK-EXTRA, müßte der Vertrieb neu organisiert werden. In den letzten Monaten sind anscheinend verstärkt Anstrengungen unternommen worden, den Straßenverkauf anzukurbeln. Jedoch bei lediglich acht Verkäuferlnnen hält er sich nach wie vor in engen Grenzen. Seit Anfang '95 wurde auch das bisherige Motto "Von Berber für Berber" auf dem Titelblatt durch "Kölns Obdachlosen Zeitung" ersetzt.
Die verkaufsorientierten - "Straßenzeitungen mit sozialem Touch"
Auch diese Überschrift kann nur ein sehr grobes Raster sein. Ähnlich wie bei den Aufklärungsblättern gibt es auch in dieser Kategorie zum Teil erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Zeitungen. Am deutlichsten an "Big Issue" orientiert sind das Hamburger "Hinz & Kunzt" und das in Hannover herausgegebene "Asphalt" .
Die Idee zu Hinz & Kunzt kam dem Hamburger Diakoniechef Dr. Stefan Reimers, nachdem er BIG ISSUE in London kennengelernt hatte. In Hamburg gab es einige Anlaufschwierigkeiten, mußte doch eine Gruppe von Betroffenen gefunden werden, die mitmachen wollte. Gefunden wurden diese schließlich mit der Selbsthilfegruppe OASE, die sich im Sommer 1993 im Zuge der Vorbereitungen zur "Nacht der Wohnungslosen" in Hamburg gegründet hatte. Mit einer Anschubfinanzierung des Diakonischen Werkes in Höhe von DM 50.000 startete das Projekt im November 1993 mit einer Auflage von 30.000 Exemplaren. Gegenwärtig werden pro Monat 110.000 Exemplare auf Hamburgs Straßen an den Mann und die Frau gebracht, ca. 800 Verkäuferlnnen-Ausweise hat Hinz & Kunzt ausgestellt. Zwischenzeitlich wurde H&K zweiwöchentlich herausgegeben. Dieses Experiment mußte aber abgebrochen werden, weil sich die Verkaufszahlen um fast 50% reduzierten. Finanziell trägt sich das Blatt inzwischen selbst. In Redaktion und Vertrieb gibt es insgesamt neun festangestellte Mitarbeiterlnnen: vier sog. "NichtBetroffene" in Redaktion und Projektleitung, fünf ehemalige Wohnungslose, die den Vertrieb der Zeitung organisieren. Zu H&K gehören auch Wohnprojekte für die wohnungslosen Verkäuferlnnen, ein Rechtshilfe- und Gesundheitsfond, mit dem H&Kler unterstützt werden sowie als neueste Idee der sog. Wohnungspool, der Mitte Oktober gestartet wurde.
H&K will kein neues "Problemblatt" sein, sondern ein "verkaufbares Boulevardblatt mit sozialer Tendenz". Wer schreibt im "Hinz & Kunzt"? In der Regel sind es professionelle Journalistlnnen. Einen festen Stamm von Betroffenen, die selbst schreiben, gibt es nicht, was jedoch als Manko wahrgenommen wird.
Die meisten der Betroffenen sitzen aber weder in der Redaktion noch schreiben sie für die Zeitung, sondern sie tragen den Verkauf des Blattes. In einer Selbstdarstellung von "Hinz & Kunzt" heißt es dazu, "dem Betteln Konkurrenz zu machen, Hilfe zur Selbsthilfe ist das Prinzip dieses Projektes. Obdachlosen und wohnungslosen Menschen wird durch den Zeitungsverkauf die Möglichkeit geboten, einer regelmäßigen Tätigkeit nachzugehen, deren Dauer sie selbst bestimmen. Sie können dadurch etwas Geld verdienen. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Kontakte zu normalen Bürgern, mit denen sie vorher als Bettler keinen Kontakt hatten. Das Selbstwertgefühl vieler Verkäuferlnnen wird langsam wieder gestärkt und ermöglicht ihnen so, sich schrittweise aus ihrer Isolation zu befreien."
Zwischen Sozialbehörde und Hinz&Kunzt wurde eine Übereinkunft getroffen, daß die Verkäuferlnnen ihren Sachbearbeiterlnnen auf dem Sozialamt erst nach einem halben Jahr ihren Verdienst darlegen müssen. Dabei ist es dann immer noch Ermessenssache, ob der Verdienst auf die Sozialhilfe angerechnet wird oder nicht.
Für den Verkauf gibt es strenge Regeln: jede/r potentielle Verkäuferln muß belegen, daß sie/er wohnungslos ist. Erst dann erhält sie/er einen Verkäuferlnnenausweis. Darüber hinaus muß jede/r Verkäuferln einen Verhaltenskodex einhalten. Die ersten zehn Zeitungsexemplare werden den Verkäuferlnnen vom Diakonischen Werk als Starthilfe gespendet. Von dem Wiederverkaufspreis von 1,80 DM behalten die Verkäuferlnnen 1,00 DM für sich. Die Verkaufsgebiete werden Woche für Woche neu vergeben. Eng angelehnt an H&K wurde im August 1994 "Asphalt" erstmals in Hannover verkauft. "Asphalt" ist ein gemeinsames Projekt des Diakonischen Werkes Hannover und der Hannoveraner Initiative obdachloser Bürger HIOB e.V.
Das Magazin erscheint monatlich in einer Auflage von 50.000 Exemplaren. Vom Verkaufspreis von DM 1,50 behalten die inzwischen knapp 140 Verkäuferlnnen DM 1,00 für sich. Von der Hanns-Lilje-Stiftung hat "Asphalt" eine Anschubfinanzierung erhalten. Die Zeitung finanziert sich zu gleichen Teilen aus Verkauf, Werbeeinnahmen und Spenden.
Im Blatt sollen nicht nur "Obdachlosenstorys" erscheinen. sondern "ein breites Spektrum an sozialen und kulturellen Themen." Ähnlich wie bei H&K liest man im Editorial und in der Selbstdarstellung zum Zweck des Blattes, daß die wohnungslosen Menschen durch den Verkauf des Blattes "ihr Schicksal in die Hand nehmen. ---- Nicht nur ihre materielle Situation verändert sich dadurch. Aus Bettlern werden Gesprächspartner. Asphalt bietet eine Alternative zum Betteln."
Die Macherlnnen legen Wert darauf, daß auch in der Redaktion "ehemals Obdachlose" arbeiten, "die durch Asphalt wieder Arbeit und Wohnung gefunden haben". Mit Stolz werden diese in der Zeitung vorgestellt.
Verstöße gegen die Verkäuferregeln - kein Alkohol, kein Schnorren oder Pöbeln, Verkauf nur auf zugewiesenem Platz und nur mit Ausweis - werden streng durch die Verkäuferbetreuung geahndet und können letztendlich zum Verlust der Verkaufsberechtigung führen. Die Betreuer haben die Legitimation einzuschreiten, sie wiederum unterstehen dem Leiter des Vertriebs.
Als Stadtillustrierte versteht sich die Münchener BISS. "BISS" erschien erstmalig im Oktober 1993 in München mit einer Auflage von 10.000 Exemplaren. Inzwischen ist das Blatt mit einer Auflage von 40.000 Exemplaren auf dem Markt. Die Zeitung erscheint zweimonatlich. "BISS" will kein reines Wohnungslosenmagazin sein, sondern ein Projekt für und unter Mitarbeit von Bürgern in sozialen Schwierigkeiten. Dazu gehöre die Arbeitslosigkeit genauso wie die Wohnungslosigkeit. Natürlich will man auch zu einem gewissen Grad "Sprachrohr" sein, Nicht-Betroffene Bürgerlnnen informieren. Aber vor allem werde angestrebt, "Leute, denen es schlecht geht, zusammenzubringen", ihnen über ein Kommunikationsangebot oder über die Möglichkeit, beim Straßenverkauf der Zeitung mitzumachen, "Hilfe zur Selbsthilfe" anzubieten. Besonders erfreulich sei es natürlich, wenn es darüber hinaus gelinge, Themen in der Öffentlichkeit zu plazieren, die sonst dem allgemeinen Medieninteresse entgehen.
Den "BlSS"-Leuten ist es wichtig, Kontakt zu den Verkäuferlnnen halten zu können, sie zu kennen und ihnen in schwierigen Situationen, falls sie dies dann wünschen, Unterstützung anbieten zu können. Die "BlSS"-Verkäuferlnnen haben feste Verkaufsplätze, sie erhalten Verkäuferlnnenausweise und verpflichten sich auf einen Verhaltenskodex.
Die Idee zu dem Münchener Projekt ist bereits im April 1991 auf einer Tagung zur Obdachlosigkeit der Evangelischen Akademie in Tutzing geboren worden, an der auch Betroffene teilnahmen. In der Vorlaufphase interessierten sich jeweils ca. 1/3 Betroffene, Sozialarbeiterlnnen und Journalistlnnen für das Projekt. Inzwischen sind es ca. 20 Leute, hauptsächlich Betroffene und Journalistlnnen, die zusammenarbeiten. Die knapp 50 festen Straßenverkäuferlnnen können von dem Verkaufspreis von DM 2,50 DM 1,30 für sich behalten. Eine Anschubfinanzierung hat es in München nicht gegeben, man lebt von Spenden und dem Verkauf der Zeitung. Arbeitete die Redaktion in der Anfangsphase noch ehrenamtlich, so gibt es jetzt fünf Stellen, von denen zwei mit ehemaligen Wohnungslosen besetzt sind. Es sollen jedoch noch weitere Arbeitsplätze für Betroffene auf ABM oder BSHG-Basis eingerichtet werden. Darüber hinaus soll die Geschäftsführung professionalisiert werden. Die Weiterqualifizierung der betroffenen Mitarbeiterlnnen ist zwar Programm, konnte aber bislang nicht realisiert werden. Klaus Honigschnabel, der Chefredakteur, räumt ein, daß das Verhältnis zwischen den journalistischen und organisatorischen Profis und den Betroffenen in der gemeinsamen Redaktion durchaus problematisch sein kann. Für beide Seiten jeweils ungewohnte Umgangsformen machten die Arbeit nicht immer leichter, ebenso die Probleme der Betroffenen untereinander und deren "mangelnde Konstanz und Zuverlässigkeit", wie von den Nicht-Betroffenen kritisiert wird. Natürlichsollen auch bei "BISS" Betroffene selbst Texte schreiben, aber Auswahl und Redaktion seien, laut Honigschnabel, immer eine "Gratwanderung". Entweder liefern Betroffene Anregungen für einen Beitrag, der dann von einem Profi gemacht wird oder man recherchiert und redigiert gemeinsam oder es wird ein authentischer Text von einem Betroffenen veröffentlicht. Wichtig ist bei dieser Gratwanderung ein Prozeß, den Honigschnabel als "betreutes Schreiben" bezeichnet: Profis bieten Hilfestellungen an, von der gemeinsamen Bearbeitung eines Artikels bis zur Begleitung bei einem Interviewtermin.
Der "Wohnungs-Looser- Obdachlosenzeitung" für Deutschland, auch ein verkaufsorientiertes Blatt, kommt nach eigenen Angaben ganz ohne professionelle Mitarbeiterinnen aus, und betont, von "Pennern" gegründet worden zu sein. Inhaltlich steht im "Wohnungs-Looser" eindeutig die Wohnungslosigkeit im Mittelpunkt. Dennoch will sie nicht in erster Linie "Aufklärungszeitschrift" sein, sondern den Betroffenen als Mittel dienen, "sich durch den Verkauf einen Lebensunterhalt zu verdienen". Das Blatt im Zeitschriftenformat wird in verschiedenen Orten auf der Straße verkauft. Daß Betroffene in der Zeitung auch schreiben, ist für die Macher ein "Nebeneffekt", der "für eine Wiedereingliederung sehr wichtig sein" könnte. Die Macher sind ehemalige Wohnungslose und die "Macher der ersten deutschen Wohnungslosenzeitung, dem Berberbrief." Idee des "WohnungsLooser" ist, Wohnungslosen nicht nur in den Großstädten eine Möglichkeit des Zusatzverdienstes durch den Zeitungsverkauf zu bieten. Deswegen geht es ihnen darum, "daß unsere Kolleginnen und Kollegen auch auf dem Land durch den Verkauf einer Zeitung ihr Geld verdienen". In Michelstadt wird deswegen eine Hauptausgabe des WL produziert, die je nach Bedarf durch eine Lokalausgabe ergänzt oder ersetzt werden kann. Als Service bietet Michelstadt an: Redaktion und/oder Druck und/oder Satz. Mit den Einnahmen sollen die Kosten gedeckt und ein Wohnprojekt finanziert werden.
Versuch einer Einschätzung - Hilfe zur Selbsthilfe
"Hilfe zur Selbsthilfe" zu leisten ist das wichtigste Ziel aller Zeitungen. Dieses Ziel wird dabei sehr unterschiedlich definiert.
Bei Hinz & Kunzt und anderen verkaufsorientierten Straßenzeitungen wird Selbsthilfe als Stufenmodell gedacht, mit dem Straßenverkauf als "erstem Schritt /.../ zu fester Arbeit und eigener Wohnung". Ähnlich auch Asphalt: Mit dem Verkauf nehmen die Wohnungslosen "ihr Schicksal in die eigene Hand. /.../ Aus Bettlern werden Gesprächspartner. /..../ Aber auch in der Redaktion arbeiten /.../ ehemalige Obdachlose, die durch Asphalt wieder Arbeit und Wohnung gefunden haben."
Biss bezeichnet sich als ein Projekt, an dem "in allen Phasen - von der Idee über die Herstellung bis zum Vertrieb Betroffene beteiligt sind." Damit "soll Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden." Auch BISS spricht vom Stufenmodell: Herstellung der Zeitung und Verkauf, dadurch Stärkung des Selbstwertgefühls, wodurch den Betroffenen ermöglicht werde, "sich schrittweise aus der Isolation von Armut und Ausgrenzung zu befreien."
"Den einzelnen dazu bringen, Ja zu sich selbst zu sagen, ist unser Anliegen", heißt es bei motz&co.
Selbsthilfe als Möglichkeit Perspektiven zu entwickeln und sich zu artikulieren, so sieht es Bank-Extra: "Anlaß eine derartige Zeitung zu gründen, war die Erkenntnis, daß Wohnungslose kaum Möglichkeiten haben, auf ihre Situation und ihre Probleme in der Öffentlichkeit aufmerksam zu machen und ihre Vorstellungen und Wünsche bezüglich eines menschenwürdigen Daseins auszudrücken.
Die redaktionelle Mitarbeit Wohnungsloser sowie der Straßenverkauf hilft außerdem, das Selbstwertgefühl und das Selbstbewußtsein zu steigern und neue Perspektiven zu entwickeln."
Ganz prakmatisch will der Wohnungs-Looser auch den Wohnungslosen abseits der Großstädte eine Möglichkeit des Zusatzverdienstes durch den Zeitungsverkauf bieten.
So unterschiedlich das Verständnis der "Hilfe zur Selbsthilfe" auch sein mag, ob Stufenmodell oder Selbstbejahung oder die Verschaffung eines Zusatzverdienstes - so läßt sich eine Tendenz zur Individualisierung des Selbsthilfegedankens nicht leugnen. Eine Individualisierung wäre aber nicht emanzipatorisch, sondern wirkte gesellschaftlich stabilisierend, denn sie entließe die Reichen und Satten, sie entließe den Sozialstaat - sicher nicht beabsichtigt - aus der Verantwortung. Zugespitzt formuliert heißt das, entweder richtet man sich in der Nische der Selbsterfahrung ein, finanziert das eigene, natürlich bessere "Wohnprojekt" und verdient etwas dazu - oder man beteiligt sich mit einer neuen Variante an dem alten Gesellschaftsspiel "survival of the fittest". Wer will, der kann sich wieder aufbauen lassen und ein anerkanntes, nützliches Mitglied der Gesellschaft werden. Das Stufenmodell suggeriert dies - und ermöglicht damit ungewollt die Differenzierung zwischen "guten" und "schlechten" Armen, zwischen den Verkäuferlnnen, die ihre Chance wahrnehmen, die "Alternative zum Betteln wählen". Die Ziele der Straßenzeitungen wären damit pervertiert. Abgesehen von den wenigen, denen es tatsächlich gelingen wird, sich in der Arena zu behaupten, wäre mit solch einem individualisierenden Selbsthilfeverständnis nur den Sozialpolitikern und Stammtischstrategen Rückenwind gegeben, die schon immer mutmaßten, daß sich die meisten Armen in der Hängematte "Sozialstaat" ausruhen und die meinen, wer will, der kann auch Arbeit und Wohnung finden.
Um solchen Vereinnahmungen vorzubeugen, muß ein Selbsthilfebegriff entwickelt und in die Öffentlichkeit transportiert werden, der sich nicht auf Selbsterfahrung oder auf eine neue Variante der Einzelfallbetreuung mit inhärentem "Besserungsanspruch" reduzieren läßt. Selbsthilfe meint auch einen gemeinsamen Prozeß des sich Selbst-Bewußtwerdens als Gruppe der Randständigen, als Voraussetzung für eine parteiliche und nicht individuelle Interessenvertretung und politischen Artikulation Wohnungsloser für das Recht auf Arbeit, Wohnen, Existenzsicherung.
Das Verständnis der "Hilfe zur Selbsthilfe" hat Konsequenzen auf für die weiteren zentralen Anliegen der Straßenzeitungen .
Straßenzeitung - kein Projekt für wohnungslose Frauen?
Das Konzept des Straßenverkaufs entspricht offensichtlich nicht den Bedürfnissen wohnungsloser Frauen. H&K spricht von einem Verkäuferinnen-Anteil von 5%. Die Tatsache, daß sich überwiegend, sowohl im Verkauf auf der Straße wie auch unter den betroffenen Mitarbeiterlnnen in den Redaktionen nur verschwindend wenige Frauen befinden, wird in keiner Zeitung problematisiert. Damit fallen die Zeitungen noch hinter das Problembewußtsein des etablierten Hilfesystems zurück.
Wollen die Zeitungsprojekte glaubwürdig bleiben, muß darüber diskutiert werden, warum wohnungslose Frauen kaum beteiligt sind und welche Möglichkeiten es geben kann, den Frauen den Einstieg in die Zeitungen zu eröffnen.
Konkurrenz schadet dem Geschäft
Es ist nicht zu leugnen, daß es schon jetzt Konkurrenz zwischen einzelnen Straßenzeitungen gibt.
m Juni 1995 fusionieren die ehemaligen Berliner Konkurrenzblätter mob und haz zur motz&co. Damit hat sich der Berliner Markt für Straßenzeitungen mutmaßlich etwas entspannt, aber noch immer existieren zwei verkaufsorientierte und damit von hohen Auflagen abhängige Blätter in Berlin: motz&co und Die Platte. Die Konkurrenz wird noch dadurch verschärft, daß beide Blätter mit dem Verkaufserlös nicht nur den Zusatzverdienst für die Verkäuferlnnen sichern müssen, sondern ihre Projekte finanzieren wollen, die laut eigenem Bekunden einen ebenso großen Stellenwert haben, wie der Straßenverkauf durch Betroffene. Im Nachhinein wird das Scheitern von mob und haz auf die unzureichende Vorbereitung zurückgeführt, bedingt durch die Konkurrenzsituation in Berlin: fast zeitgleich planten vier Initiativen die Herausgabe einer Straßenzeitung. Um als erste auf dem Markt zu sein, wurde der Binnenstruktur der Projekte zu wenig Beachtung geschenkt. Bei der fragilen Struktur solcher Projekte in denen Profis und Laien, Etablierte und Nicht-Etablierte, Menschen mit und ohne Wohnung versuchen, möglichst gleichberechtigt zusammenzuarbeiten, hatte es dann im Berliner Projekt "mob" schon sehr bald nach dem Start geknallt. "Zoff bei mob" titelte die Berliner tageszeitung am 27.4.94 "Verkäufer des Obdachlosenmagazins "mob" fordern mehr Mitspracherecht". Der Herausgeber, die Berliner Initiative gegen Wohnungsnot (BIN) e.V., ein seit 10 Jahren bestehender Zusammenschluß von Fachleuten, hauptsächlich Sozialarbeiterlnnen, die sich haupt- und ehrenamtlich für Wohnungslose engagieren, läßt die von den Betroffenen besetzten Redaktionsräume polizeilich räumen. Eine Zusammenarbeit ist nicht mehr möglich, BIN e.V. zieht sich aus dem Projekt zurück. Der Versuch Betroffener, mob selbst herauszubringen, ist gescheitert.
Konkurrenz entsteht aber auch da, wo bereits etablierte Zeitungen mit Lokalausgaben einen neuen Markt erschließen wollen, oder wo in der Fläche kostenlos verteilte Straßenzeitungen mit örtlichen Initiativen zusammenprallen.
Wenn die Straßenzeitungen einen emanzipatorischen Anspruch haben, d.h. wenn die Wohnungslosen nicht auf die Rolle der Verkäuferln reduziert werden sollen, muß es in Zukunft Konkurrenzschutz-Abkommen geben. In Orten, in denen lokale Initiativen von oder mit Wohnungslosen eine Zeitung herausgeben (wollen), dürfen die etablierten Straßenzeitungen ihre Blätter nicht vertreiben.
Beteiligung und Qualifizierung der Betroffenen
Die große Mehrheit der Betroffenen ist als Verkäuferlnnen in das Projekt integriert. Es gibt nur wenige Zeitungen, die einen festen Stamm an wohnungslosen Autorlnnen haben. Die Projektleitung ist in der Regel in der Hand professioneller Journalistlnnen, Betriebswirtschaftlerlnnen oder Sozialarbeiterlnnen. Die Qualifizierung der wohnungslosen ehrenamtlichen Mitarbeiterlnnen hat keine hohe Priorität, beschränkt sich entweder auf die sog. Verkäufereinweisung oder ist auf "später" verschoben. Abgesehen von dem Verkauf bleibt Wohnungslosen bzw. in den meisten Zeitungen Ex-Wohnungslosen noch die Vertriebsorganisation als Tätigkeitsfeld - also Zeitungsausgabe und Verkäuferlnnenbetreuung und -kontrolle.
Gleichzeitig ist in den Äußerungen und Selbstdarstellungen der Projekte immer wieder die Rede von "Beteiligung der Betroffenen", von ihren Möglichkeiten "das Gesicht der Zeitung zu prägen" von "gleichberechtigter Zusammenarbeit". Exemplarisch sei hier die Selbstdarstellung von H&K zitiert: "wohnungslose Verkäufer... Ex-Obdachlose im Vertrieb... und ein professionelles Team. Hinz&Kunzt wird von professionellen Journalisten, Fotografen und Layoutern gestaltet. Denn nur, wenn die Zeitung ihr Geld wert ist, funktioniert das Projekt langfristig. Eine Betriebswirtin macht die Projektund Anzeigenleitung, ein Sozialarbeiter steht den Verkäufern für praktische Hilfe zur Verfügung. Alle Mitarbeiter verbindet der Spaß daran, sich in einem ungewöhnlichen Projekt zu engagieren." Diese Konstellation ist m.M. nach aus mehreren Gründen problematisch.
1. Es wird Gleichheit vorgespiegelt, wo praktisch keine Gleichheit ist.
Professionelle, Sozialarbeiterlnnen oder Journalistlnnen, die in solch einem Projekt angestellt sind, sind anderen Bedingungen unterworfen als Wohnungslose, die entweder ehrenamtlich oder in ungesicherten Beschäftigungsverhältnissen mitarbeiten. Für die Professionellen ist es der Job, mit den sich daraus ergebenen Verpflichtungen und Interessen, d.h. sie sind an einem möglichst reibungslosen Ablauf interessiert, da sie ihre Existenz über die Arbeit in dem Projekt absichern. Für sie stellt sich der Erfolg des Blattes mutmaßlich anders dar als für Wohnungslose, die über das Projekt eben nicht existentiell abgesichert sind.
2. Es wird die lllusion geschürt, als sei der Aufstieg vom/von Verkäuferln zum/zur festangestellten Mitarbeiterln, mit festem Einkommen und eigener Wohnung für alle erreichbar. H&K: "Fünf ehemalige Hinz&Kunzt Verkäufer sind mittlerweile fest angestellt und organisieren den Vertreib, von der Zeitungsausgabe bis zur Verkäuferbetreuung. Das entspricht der Idee eines Stufenmodells: Der Zeitungsverkauf als erster Schritt, auf den weitere folgen und schließlich in feste Arbeit und eigene Wohnung führen." Wie attraktiv dieses Stufenmodell für die Wohnungslosen bei H&K wohl ist, geht schon aus einer Verkäuferlnnenbefragung von H&K hervor: mehr als 2/3 wollen gern in eine feste Arbeitsstelle wechseln. Bei einem Tagesverdienst für eine/n der festen 150 Verkäuferlnnen von 30,- bis 40,- DM bei mindestens fünf Verkaufstagen pro Woche muß dies nicht wundern.
3. Die Ex-Wohnungslosen, die in den Projekten eine feste oder auch nur zeitlich befristete, aber sozialversicherungspflichtige Anstellung bekommen haben, sind in einer schwierigen Situation. und geraten möglicherweise in einen Interessenskonflikt. Sind sie in erster Linieganz wie die anderen festangestellten Mitarbeiterlnnen an dem reibungslosen Funktionieren der Zeitung interessiert oder identifizieren sie sich eher mit den Interessen der anderen Wohnungslosen, ihrer Herkunftsgruppe? Darüber hinaus sind gerade die Ex-Wohnungslosen in der sog. Verkäuferbetreuung, die oftmals ja eine Kontrollfunktion beinhaltet, eingesetzt und müssen sich dort in konfliktträchtige Situationen begeben.
Wenn die Wohnungslosen ernsthaft das "Gesicht der Zeitung mitprägen" und nicht nur leibhaftiges Aushängeschild sein sollen, ist es notwendig, der Qualifizierung der wohnungslosen Mitarbeiterlnnen wesentlich höhere Priorität einzuräumen, so daß sie auch in zentralen Funktionen gleichberechtigt mitarbeiten können.
Darüber hinaus scheint es notwendig, daß wohnungslose und nicht-wohnungslose, haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterlnnen Klarheit über ihre unterschiedlichen Interessen an dem Projekt bekommen. Dazu bedarf es einer Selbstorganisation der Betroffenen und ex-Betroffenen eines Projektes, die gemeinsam ihre Interessen identifizieren und auch gegenüber den Herausgebern und eventuell auch gegenüber den anderen professionellen Mitarbeiterlnnen formulieren. Nur dann haben sie die Chance zu definieren, was den Erfolg des Blattes ausmacht: regelmäßiges Erscheinen, kontinuierliche Steigerung der Auflage, Verbesserung des Layouts, öffentliche Anerkennung, Einwerben von Spenden das alles braucht einen störungsfreien Ablauf oder die Option, verschüttete Fähigkeiten zu reaktivieren oder neu zu entdecken, Kreativität zu entfalten, Zeitsouveränität zu gewinnen, eigene Interessen zu identifizieren und auch öffentlich zu artikulieren, sich aus Abhängigkeiten zu befreien. Diese Ansprüche bergen die Gefahr, einen reibungslosen Ablauf zu stören. Wenn die Erfolgsdefinition allein den Professionellen überlassen bleibt, dann kann den Betroffenen das Projekt aus der Hand genommen werden.
Für die meisten Zeitungen ist das sicher eine schwierige Gradwanderung. Die Erfolgsfrage muß immer wieder austariert werden. Um so wichtiger ist es, daß mögliche Interessendifferenzen nicht verkleistert, sondern offen artikuliert werden.
"Aus Bettlern werden Gesprächspartner" -
Zeitungen wollen die Kommunikation zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen vereinfachen
Informieren, Vorurteile abbauen, Verständnis wecken, mit der Lebenssituation Betroffener bekannt machen - also die klassische Öffentlichkeitsarbeit ist ein Aspekt der Kommunikation. Diesem Anspruch werden alle Zeitungen, unabhängig von ihrer jeweilen Schwerpunktsetzung uneingeschränkt gerecht. Selbst Projekte, die sich bewußt nicht als "Elendsmagazin" definieren, berichten im Vergleich zur allgemeinen Presse umfangreich über Wohnungslosigkeit und Wohnungsnot bzw. über sozialpolitische Themen insgesamt. Es gibt keine Straßenzeitung, die nicht wenigstens zwei Seiten für Texte von Betroffenen freihält. Hinzu kommt, unabhängig von den Inhalten reicht oft schon allein die Existenz eines solchen Projektes, um in den Medien, besonders der Regionalpresse, aber auch überregional das Thema Wohnungslosigkeit zu plazieren. Die Straßenzeitungen sind damit ein ganz wichtiger Faktor in der Öffentlichkeitsarbeit über das bislang eher randständige Thema "Wohnungslosigkeit".
Der direkten Kommunikation, dem Käuferln-VerkäuferlnVerhältnis wird in allen Projekten, besonders aber in den verkaufsorientierten Blättern große Bedeutung beigemessen. In nahezu jeder Selbstdarstellung/Editorial wird darauf hingewiesen, daß das Gespräch zwischen Käuferln und Verkäuferln ein Schritt aus der Isolation sei, dazu beitrage das Selbstwertgefühl der Wohnungslosen zu steigern oder zu stabilisieren, sogar die Chance beinhalte, über einen solchen Kontakt zu einer Wohnung zu kommen.
Kritisch läßt sich dazu die Frage stellen, ob diese Verkaufsgespräche nicht überbewertet werden und auch damit bei den Verkäuferlnnen Erwartungen geweckt werden, die nicht erfüllt werden können. Der Anspruch, "Kontakte zu 'normalen Bürgern' ermöglichen" durch den Verkauf eines Produktes, inklusive eventuell eines kurzen Verkaufsgesprächs, macht skeptisch. Der Vorgang Geld gegen Ware ist in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen heute die Regel. Daß sich dadurch besondere menschliche Kontakte entwickeln lassen, die in der Lage sind, die Isolation von Individuen zu überwinden, dürfte nur in Einzelfällen möglich sein, ebenso dürfte die Chance, beim Verkaufsgespräch eine Wohnung angeboten zu bekommen eher gering sein. Die Verkaufsgespräche sollen dadurch aber nicht abgewertet werden. Vor allem nicht vor dem Hintergrund der Tatsache, daß in zahlreichen Städten versucht wird, die Armut zu beseitigen, in dem die Armen aus dem Blickfeld geräumt werden. Private Wachdienste patrollieren in Bahnhöfen oder Einkaufspassagen, Geschäftsleute schließen sich zu einschlägigen Interessengemeinschaften zusammen, Kommunen verhängen Bettelverbote.
In solch einer Situation ist der Zeitungsverkauf auf der Straße durch Wohnungslose wichtig, um Wohnungslose im Straßenbild zu etablieren, nicht als Gewöhnung an Elend, sondern als Schutz für alle Wohnungslose, ob sie nun verkaufen oder nicht, vor Vertreibung durch Straßennutzungsverordnungen oder private Wachdienste. Zugleich wird aber auch deutlich, welche Brisanz Zeitungswerbesprüche wie "Verkaufen statt Betteln", "aus Bettlern werden Verkäufer", "Zeitung als Alternative zum Betteln" haben können. Durch solche Werbesprüche werden nicht gesellschaftliche Vorurteile abgebaut, sondern bestärkt: Wer sich bessern will, der kann es auch! Damit passen sich die Zeitungen nicht nur opportunistisch dem vermeintlichen Pflichtverständnis und der Arbeitsmoral der Durchschnittsbürgerln an, sondern verhelfen auch einem überwunden geglaubten Fürsorgeanspruch zu neuer Anerkennung: dem Besserungsanspruch. Aus Arbeitsunwilligen werden Arbeitswillige, aus Wohnunfähigen werden Wohnfähige. Diejenigen, die bei den Zeitungen nicht mitmachen wollen oder können werden nun doppelt stigmatisiert: erstens als Wohnungslose und zweitens als besserungsunwillige Wohnungslose.
Nicht Mitleid, sondern Interesse
Dieser Anspruch ist sicher auch aus rein wirtschaftlichen Gründen richtig. Eine Straßenzeitung, die sich auf Dauer auf einem lokalen Zeitungsmarkt etablieren will, kann nicht auf die pure Mildtätigkeit des Publikums hoffen. Allzu groß wären die Schwankungen in der Nachfrage: im Winter hohe Auflagen, im Sommer geringe Auflagen. So ließe sich ein fester Stamm an haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterlnnen bzw. Verkäuferlnnen nicht halten. Folglich sind die Zeitungen vor Ort gezwungen, sich Marktlücken zu sichern. Dies kann in der einen Stadt durch einen ausführlichen und qualifiziert gemachten Veranstaltungskalender gelingen, in der anderen durch einen Kulturschwerpunkt oder durch ein Stadtmagazin, das sich kritisch mit der Lokalpolitik auseinandersetzt.
Zugleich ist dieser Anspruch, nicht Mitleid, sondern Interesse zu wecken, auch Ausdruck eines neuen Selbstverständnisses, mit dem man sich von der traditionellen Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Wohnungslosenhilfe absetzt, die viele Jahre lang und bisweilen auch heute noch glaubt, ohne die Mitleid erregenden Bilder armer Menschen nicht auskommen zu können.
Jedoch - die Straßenzeitungen haben soviel öffentlichen Zuspruch und Protektion gefunden, weil sie von Wohnungslosen verkauft werden. Die Beteiligung von Armen ist ein wichtiges Verkaufsargument, mit dem sowohl Verkäuferlnnen als auch Herausgeber manchmal unterschwellig, zuweilen unverhohlen spekulieren. "Sie hatte ihren Verkäuferausweis an der Brust hängen, was ich noch schäbiger fand, als die Elendspornographie, die sonst so zelebriert wird. Die Masche: "lch habe das Startkapital noch nicht zusammen", war ein schöner Erfolg für sie, vielleicht aber für Euch nicht.", so ein Leserbrief in der motz&co, Nr. 3. Für die Glaubwürdigkeit der Zeitung ist es wichtig, sich so offen und offensiv wie die motz es getan hat mit solchen Käuferlnnenerfahrungen auseinanderzusetzen. Im Blatt nimmt die Redaktion zu dem Leserbrief ausführlich Stellung: "Wer eine Obdachlosenzeitung verkauft, braucht das Geld unmittelbar. Oft wird es sofort ausgegeben. Sparsamkeit ist keine Straßenkultur. Dies um so mehr, wenn ein Suchtverhalten dahinter steckt. /.../
In der Juni-Ausgabe von Asphalt findet sich ein eindringlicher Appell des Herausgebers: "Viele haben sich ihre Würde und ihre Achtung zurückerarbeitet, einige zahlen Schulden ab, andere brauchen das Geld, um die Kaution für die Wohnung zu bezahlen und Damit die Hoffnung weiterblüht, möchte ich Sie, liebe Leserin und lieber Leser bitten, mindestens eine neue Käuferin bzw. einen Käufer zu gewinnen, damit wir unsere Auflagenhöhe auch im Sommer halten können. Sie verbessern damit die Lebens-Situation unserer Asphalt-Verkäuferlnnen! Herzlichen Dank für Ihr Engagement!" (Asphalt, Nr. 10, Juni 1995) Ob sich mit solch einem Antichambrieren Auflagenschwankungen verhindert werden können, bleibt abzuwarten.
Zusammenfassung
Die Straßenzeitungen schaffen Öffentlichkeit über ein ungeliebtes Thema.
Die Straßenzeitungen dürfen sich nicht als sozialpolitisches Feigenblatt mißbrauchen lassen, sie müssen deshalb in aller Öffentlichkeit deutlich sagen, daß sie kein Ersatz für eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik sind, daß der Straßenverkauf ein ungesichertes Beschäftigungsverhältnis ist und bleibt, daß es nur für eine verschwindend geringe Zahl von Betroffenen im Projekt selbst eine gesicherte Beschäftigung geben kann. Sie müssen auch in aller Öffentlichkeit sagen, daß sie mit ihren Projekten kein Ersatz für eine verfehlte Wohnungspolitik sein können, daß sie durch die Projekte nicht allen Wohnungslosen zu einer Wohnung verhelfen werden. Diese Offenheit sind die Zeitungen auch den wohnungslosen Mitarbeiterlnnen schuldig.
Die Straßenzeitungen dürfen die Wohnungslosen nicht auf die werbewirksame Rolle der Verkäuferlnnen reduzieren, sondern müssen Raum zur Qualifikation lassen, so daß wohnungslose Laien, das "Gesicht der Zeitung" an verantwortlicher Stelle prägen können.
Die Straßenzeitungen sollten den Straßenverkauf nicht als "Alternative zum Betteln" feiern, sondern als Rückeroberung des öffentlichen Raumes durch Ausgegrenzte.
Wollen sie sich nicht zu einer neuen karitativen Variante der Wohnungslosenhilfe entwickeln, kann nicht alleiniges Ziel die individuelle Hilfe zur Selbsthilfe sein. Die Straßenzeitungen haben durch ihre Infrastruktur, durch die Möglichkeit, Öffentlichkeit zu schaffen das Potential, Nukleus einer sozialen Bewegung Ausgegrenzter zu sein. Sie können der Ort sein, an dem Wohnungslose ihre Kräfte bündeln, um ihre Interessen zu identifizieren und parteilich zu artikulieren, um damit staatlichen Institutionen, einer selbstgefälligen Öffentlichkeit und einem etablierten Hilfesystem auf die Sprünge zu helfen.
Wohin die Reise geht, ist indessen noch nicht entschieden.
Dieser Beitrag ist unter dem Titel "Straßenzeitungen" erschienen in: Ronald Lutz (Hg.): Wohnungslose und ihre Helfer. Bielefeld 1995. Für die wohnungslos wurde der Beitrag an einigen Stellen aktualisiert.
In: wohnungslos 4/95, S. 154 - 169