Ohne Obdach auch die Würde los
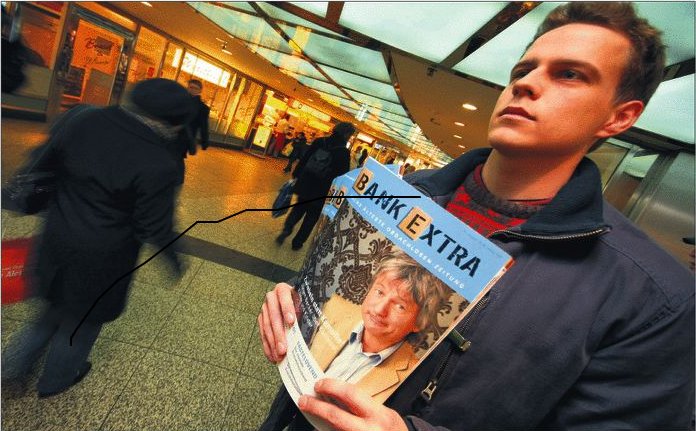 "Darf ich Ihnen die Bank Extra anbieten?" Es kostet Überwindung, Obdachlosenzeitungen an den Mann zu bringen. Ergebnis nach zwei Stunden: Zwei verkauft.
"Darf ich Ihnen die Bank Extra anbieten?" Es kostet Überwindung, Obdachlosenzeitungen an den Mann zu bringen. Ergebnis nach zwei Stunden: Zwei verkauft.
Obdachlosenzeitungen in der Hand und abgetragene Kleidung am Leib machen unsichtbar: Der Selbstversuch bestätigt die Caritas-Kritik, dass Menschen am Rand der Gesellschaft zu wenig wahrgenommen werden. Meist sieht man sie ja auch früh genug, um sie dann übersehen zu können.
Eine Stunde lang Kälte, Rumstehen für nichts, das Gefühl, Luft zu ran, eine Stunde nur Frust und steife Glieder. Und dann endlich kommt sie daher, Ende 20, interessiert und freundlich: Eine junge Frau will eine Obachlosenzeitung. Die ersten einssiebzig! Aber sie stutzt: "Du bist doch so jung. Bist Du wirklich obdachlos?"
Erwischt. Der älteste Pulli mit dem scheußlichen Muster, die längst ausgemusterte Jacke und ausgelatschte Turnschuhe reichen nicht aus, um den Reporter glaubwürdig als Obdachlosen zu brandmarken. Zumindest nicht bei Menschen wie meiner ersten Kundin, die genau hinsehen. Aber das tun die wenigsten. Bemängelt auch der Caritasverband und hat deshalb die Kampagne "Soziale Manieren für eine bessere Gesellschaft" gestartet. Zwei Stunden Selbstversuch als Verkäufer von Obdachlosenzeitungen – und man erhält eine leise Ahnung davon, wie es sich anfühlt auf der anderen Seite der Schnittstelle zwischen den Menschen, die dazugehören und den anderen am Rande der Gesellschaft.
In der heutigen Zeit sollte jeder mit jedem reden können. Dazu gehört auch, dass man Obdachlosen nicht aus dem Weg geht."
Stefan Schneider forscht zum Thema Wohnungslosigkeit.
Portraits solcher Menschen gehören zum Caritas-Kampagne, begleitet von Aussagen wie "Ein Lächeln erfreut jeden. Auch mich". Die Caritas will aber keinen Knigge aufstellen, sagt Sprecherin Claudia Beck: "Vielmehr wollen wir die Menschen sensibilisieren für den Umgang mit Leuten um Rand der Gesellschaft. Man sollte nicht jeden anlächeln, ganz klar. Eher sollte man die Kriterien, rnit denen man anderen Leuten begegnet, auch auf den Umgang mit den Betroffenen übertragen." Ziel ist auch, dass sich Menschen mit der Situation der Betroffenen befassen, die das sonst nicht tun würden.
Klirrend kalt ist es an diesem Dienstagnachmittag in Köln. Dazu regnet es. "Bei diesem Wetter geht jeder weiter, du verkaufst nicht eine Zeitung", hatte Rainer zuvor gesagt. "Die Leute halten ihren Regenschirm als Schutz vors Gesicht, damit sie dich nicht anschauen müssen." Rainer ist 42 Jahre alt, obdachlose und verkauft seit zwölf Jahren die "Bank Extra – Kölns älteste Obdachlosenzeitung" in Köln.
An diesem Tag hört man Rainer – der nie ohne seinen Bruder Andreas (45) loszieht – nicht in der Schildergasse rufen, der Einkaufsstraße in der Innenstadt. "Bank Extra hier!", ist sonst einer seiner Sprüche. Heute ist die Aussicht auf einen erfolgreichen Verkauf – 20 Zeitungen setzt er an einem guten Tag ab – wegen des Wetters wie das Wetter: schecht. Nur vor Weihnachten spielt Regen keine Rolle: "Da entdecken die Leute ihr soziales Gewissen."
Weil er an diesem Tag nicht verkauft, hat mir Rainer seinen Platz überlassen, seinen Stammplatz, direkt vor dem Eingang von C&A. Dort steht er Tag für Tag, "immer so vier bis fünf Stunden". Zuvor hat er mich, den Testverkäufer, noch abschätzig gemustert: "Aber der verkauft hier jetzt nicht auch noch, oder?" Nein, hat Reiner Nolden beruhigt, der den Zeitungsverkauf des gemeinnützigen Vereins Oase e.V. organisiert. "Er ist nur heute für ein paar Stunden hier, um zu sehen, wie die Passanten reagieren." In Koblenz und Mainz geht das nicht. Da gab es zwar mal die "Platte", doch die ist seit einem Jahr eingestellt – trotz guter Verkaufszahlen. Die Zuschüsse fließen jetzt in die Tafelläden.
Rainer in Köln ist noch nicht ganz überzeugt. Von der Kampagne hat er noch nichts gehört, dafür auf der Straße schon viel erlebt. Er könnte sicher vieles erzählen, wie die Passanten auf der Straße mit ihm umgehen – und wenige Erfahrungen wären positiv. Doch genau das sprudelt aus ihm heraus: "Einmal hat mir ein Stammkunde eine Jacke bei C&A gekauft. Die war eine Nummer zu groß. Er ist dann nochmal rein und hat sie umgetauscht." Eine große Gabe für einen, der sich für ein kleines Licht auf den Straßen einer Metropole hält.
Wie viele wohnungslose Menschen wie Rainer es in Deutschland gibt, weiß niemand so genau. Leute, die auf der Straße leben, kann man schlecht zählen. Laut einer Studie der Hamburger Behörde für Soziales aus dem Jahr 2002 besteht für wohnungslose Menschen nur während der ersten sechs Monate eine realistische Möglichkeit, diesen Verhältnissen dauerhaft zu entfliehen. Der Verlust der Wohnung ist oft der letzte, deutliche Schlusspunkt einer ganzen Kette von Schicksalsschlägen, wie Verlust des Arbeitsplatzes, Scheidung oder finanzieller Schieflage.
Die Ziele der Caritas-Kampagne hingegen, die so selbstverständlich anmuten, haben die meisten Passanten an diesem Nachmittag in Köln wohl noch nicht erreicht. Die meisten hasten vorbei, schauen weg, oder ihnen ist der Augenkontakt unangenehm, sie verleugnen meine Anwesenheit. Das klingt drastisch und ist auch meinem Frust geschuldet, der mit jeder Minute wächst. Die Zeitungen einfach still hinhalten, hatte Verkäufer Willi (37) geraten: "Wenn Du rufst, verschreckst du die Leute."
"Die Leute sollten Interesse zeigen und uns auch mal ansprechen. Vielleicht haben sie ja Verbesserungsvorschläge."
Willi (37), obdachlos
Nun, Willi steht auch in einer Zwischenstation eines U-Bahnhofs – in U-Bahnen und auf Bahnsteigen ist der Verkauf in Köln tabu – und weiß: "Hier zu brüllen, wäre nicht gut." Aber auf mein stilles Dasein in der Fußgängerzone reagiert niemand. Doch wo ist die Grenze zur Belästigung, was den Verkäufern von Obdachlosenzeitungen ebenso verboten ist wie Alkoholkonsum während des Verkaufs? Ich werde aktiver, traue mich zunächst nur im Flüsterton zu fragen: "Bank Extra?" Und: "Darf ich Ihnen eine Bank Extra anbieten?" Da: War das etwa ein Lächeln, wenn auch nicht wenigstens von einer kurzen Antwort begleitet? Und hier: Ein Mann mittleren Alters verzieht den Mundwinkel und schüttelt den Kopf. Soll er doch. Wenigstens eine Reaktion. "Passanten reagieren sehr unterschiedlich. Von Polemik bis zum normalen Umgang ist alles dabei", sagt Michel.
"Der Verkauf kann sehr frustrierend sein, nicht jeder kann das", sagt Stefan Schneider, der wissenschaftlich das Thema Wohnungslosigkeit bearbeitet und die Berliner Straßenzeitung "strassenfeger" herausgibt. "Für viele Betroffene ist es der letzte Ausweg, sie haben keine bessere Alternative." Diverse Aspekte des Verkaufs sind für Schneider wesentlich: "Da sind zunächst der materielle Nutzen für Menschen, die sonst keine Chance haben, Geld zu erhalten. Es ist eine selbstständige Arbeit, eine Alternative zum Betteln, strukturiert den Alltag und steigert das Selbstwertgefühl ein Stück weit." Die Zeitungen sollen zudem Lobbyarbeit leisten für Wohnungslose.
Als die ersten Strassenzeitungen in Deutschland Mitte der 1990er Jahre herauskamen, gingen die Menschen damit anders um, sagt Schneider: "Es war etwas Neues. Heute glaubt man, alles über Obdachlose zu wissen. Wichtig ist, dass die Leute die Zeitung auch lesen, statt nur Geld zu geben."
Caritas-Expertin Beck sieht noch eine andere Entwicklung: "Die Normalbevölkerung hat heute kaum Kontakte zu isolierten Betroffenen und Angst, selbst abzustürzen." Viele gingen deshalb auf Distanz.
Nicht alle. Wie etwa die junge Frau. Der erste Mensch, der mit mir spricht, mich sogar anspricht. Seltsam: So viel Euphorie wegen weniger Worte. Michaela heißt sie, und erklärt: "Ich frage mich oft, was Obdachlose so machen und unterhalte mich mit ihnen." Das Titelbild der Zeitung – ein Foto des Kölner Kabarettisten Jürgen Becker – hat sie angesprochen. "Das mit den Prominenten zieht", findet sie. Es ist mein erster Erlös, 90 Cent der 1,70 Euro gehen an der Verkäufer.
Bei anderen Passanten zieht Jürgen Becker nicht. Immerhin zeigen einige wenige durch ein "Nein, danke", dass sie Notiz genommen haben. Erwidere ich die Blicke, die nicht selten vom Zeitungscover zu meinem Gesicht wechseln, wenden sie sich peinlich berührt ab. Die Kleiderpuppen im Schaufenster hinter mir sind dann deutlich ansprechender.
Dass die Passanten ein Reporter-Team von RTL – auf dem Fang nach eindeutigen Aussagen zur Pius-Bruderschaft – zumindest zu Teilen ähnlich ignorieren, hellt meine Stimmung etwas auf. Und Janine aus Leipzig tut es auch. Sie kauft mir die zweite und letzte Zeitung ab – nach der zweiten Stunde. "In Leipzig kaufe ich sie regelmäßig, denn ich finde die Artikel interessant." Und: Jeden könne ein solches Schicksal ereilen.
Fragt man Rainer, Andreas und Willi, was sie von den Passanten auf der Straße erwarten, antworten sie: "Die Leute sollten Interesse zeigen, uns mal ansprechen. Vielleicht haben sie Verbesserungsvorschläge für den Verkauf." Wenn die Leute sie beobachten, ihnen zumindest etwas Respekt zeigen würden, wären sie schon zufrieden. Schneider findet: "Es gehört zur Sozialkompetenz, dass man Betroffenen nicht aus dem Weg geht." Er selbst vertraut einem Obdachlosen sein Fahrrad an, bevor er die Markthalle betritt. "Dann brauche ich kein Schloss."
Lizenz für die Straße: Einen solchen Ausweis muss jeder Verkäufer einer Obdachlosenzeitung vorzeigen können. Passanten belästigen und Alkoholkonsum sind während des Verkaufs verboten.
Jan Lindner
Unterm Strich
Angst vor dem Absturz
Weit weg vom Rest der Bevölkerung sind Wohnungslose: 46 Prozent der Deutschen begegnen ihnen gar nicht, 50 Prozent in bestimmten Stadtteilen, 4 Prozent in der Nachbarschaft und 1 Prozent im Freundes- oder Familienkreis.
Keine eigene Wohnung hatten 2006 in Deutschland 265 000 Menschen. 18 000 davon lebten ohne Unterkunft auf der Straße, so die BAG Wohnungslosenhilfe.
Angst vor Armut ist verbreitet – zwölf Prozent der Deutschen hegen die Befürchtung, abzurutschen, weitere 25 Prozent halten es für möglich. Personen mit Hauptschulabschluss rechnen seltener damit als Abiturienten.
Die Caritas-Kampagne zielt nicht nur auf Bewusstseinsveränderungen der Menschen ab, sondern erhebt auch sozialpolitische Forderungen. Weitere Informationen gibt es unter www.soziale-manieren.de .
Quelle:
Mit freundlicher Erlaubnis von Jan Lindner, entnommen aus der Rhein-Zeitung / Journal vom 21.02.2009
Hervorhebungen meines Namens nicht im Original.
Martin Staiger - Straßenzeitungen unter den Bedingungen der Marktwirtschaft
[1] Von der Gesellschaft finanzierte Leistungen für Kinder decken nur einen Bruchteil der Kosten für Kinder. Nach Peuckert: Familienformen im sozialen Wandel, Opladen 1996, S.286 erhalten z.B. Ehepaare mit 2 Kindern ca. 25% ihrer Versorgungs- und Betreuungsaufwendungen von der öffentlichen Hand.
[2] Specht: Löcher im Netz. Wie Armut in Deutschland zu überwinden ist, in: Evangelische Kommentare, März 1998, S.127-130, S.128.
[3] Da heute "die Ökonomie die zentralen Normen setzt und durchsetzt" (Reifenrath: Nachdenken übers Abräumen. Konsens, Globalisierung und Demokratie, in: Frankfurter Rundschau 27.12.1997, S. ZB 4), stehen ökonomische Minderausstattung und gesellschaftliche Ächtung in einem unauflösbaren dialektischen Verschränkungsverhältnis.
[4] Vgl. Wermelskirchen: Die neuen Unwörter sind da. Wieder hat sich die Jury nicht geschont / "Tote spenden nicht", in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.1.1998 und N.N.: Bescherung zum ersten Advent erfreut Händler nicht. Bürger ohne Kauflaune/Streik in Nordrhein-Westfalen abgewendet / Forderungen nach Einschnitten ins Sozialsystem, in: Frankfurter Rundschau, 1.12.1997, S.11. Dort wird der Präsident des Hauptverbandes des Deutschen Einzelhandels, Hermann Franzen, folgendermaßen zitiert: "In der Verfassung steht nichts von einem Sozialstaat ... Wer sich in der sozialen Hängematte festkrallt, sollte lieber Parks und Straßen fegen."
[5] Daß dies eine sehr idealistische Vorstellung von Arbeit ist und zwischen dem zu trennen ist, was Marx entfremdete und unentfremdete Arbeit (vgl. Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte von 1844) nennt, ist mir bewußt.
[6] Vgl. Stolle: Hinz & Kunzt Verkäufer-Analyse. Bedarfserhebung zum Thema Wohnen und Arbeiten, Hamburg 1995, S.8: 68,3% aller Befragten wollen in eine regelmäßige Arbeit wechseln. Davon "wünschen sich alle eine Vollzeittätigkeit."
[7] N.N.: Schaubild Arbeitsplätze in Deutschland. Anzahl der Erwerbstätigen im Jahresdurchschnitt, in: Frankfurter Rundschau, 30.4./1.5.1998, S.17.
[8] N.N.: Am Arbeitsmarkt droht ein neues Tief. Institut rechnet mit 4,46 Millionen Erwerbslosen, in: Frankfurter Rundschau, 15.4.1998, S.1.
[9] Zahlen für Westdeutschland. Vgl. Biedenkopf: Stellungnahme des sächsischen Ministerpräsidenten zu den Vorschlägen der Partei- und Regierungskommission zur Rentenreform, in: Frankfurter Rundschau, 12.2.1997, S.16.
[10] Stadlmayer: Frauen werden bei Steuern und Renten nicht gehört, in: tageszeitung, 6.3.1997, S.5.
[11] Auch die sogenannte "Scheinselbständigkeit" - das IAB spricht für 1996 von 938.000 Bundesbürgern, die in einer "Grauzone zwischen abhängiger und selbständiger Beschäftigung" arbeiten - ist, da die Betroffenen in der Regel nicht sozialversichert sind, ein Armutsrisiko (vgl. Goddar, Die Neue Selbständigkeit, in: tageszeitung, 14./15.2.1998, S.15).
[12] Vgl. Reuter: Arbeitslosigkeit bei ausbleibendem Wachstum - das Ende der Arbeitsmarktpolitik?, in: Aus Politik und Zeitgeschehen, Beilage zur Wochenzeitung "Das Parlament" vom 35/97 vom 22.8.1997, Bonn 1997.
[13] Thon: Demografische Aspekte der Arbeitsmarktentwicklung - die Alterung des Erwerbspersonenpotentials, S. 291.
[14] Vgl. N.N.: Am Arbeitsmarkt droht ein neues Tief, in: Frankfurter Rundschau, 15.4.1998, S.1.
[15] Vgl. Thon, a.a.O., S.295.
[16] Vgl. N.N.: Heer der Armen wächst weiter. 2,7 Millionen Menschen benötigten 1996 Sozialhilfe, in: Frankfurter Rundschau, 25.11.1997, S.1.
[17] Vgl. Specht: Löcher im Netz, S.128. Der Rückzug der Betroffenen wirkt sich z.B. dahingehend aus, daß, wie eine Studie in Essen zeigte, die Wahlbeteiligung in Stadtteilen mit einem hohen Anteil an SozialhilfeempfängerInnen z.T. gravierend niedriger ist als im reichen Essener Süden (vgl. Huster: Armut in Europa, Opladen 1996, S.103-110, insbes. Schaubild 34 und 35, S.108f).
[18] Vgl. N.N.: Arbeitslosigkeit. Gericht hält zehn Anträge im Monat für "zumutbar", in: Frankfurter Rundschau, 10.3.1998, S.5.
[19] § 22 Abs.3 Satz 1 und 2 BSHG: "Die Regelsätze sind so zu bemessen, daß der laufende Bedarf dadurch gedeckt werden kann. Die Regelsatzbemessung hat Stand und Entwicklung von Nettoeinkommen, Verbraucherverhalten und Lebenshaltungskosten zu berücksichtigen." Vgl. auch Breuer; Engels: Bericht und Gutachten zum Lohnabstandsgebot, Stuttgart; Berlin; Köln 1994 und zur praktischen Umsetzung des Leitbildes die Begründung der SPD-Fraktion im Sozialausschuß der Stadt Dortmund zu dem Beschluß, weniger Bekleidungsbeihilfe zu bezahlen: "Weil das zum Leben verfügbare Einkommen der unteren Lohngruppen und damit deren Ausgaben im Kleidungsbereich gesunken sind, muß die Sozialhilfe von unten angepaßt werden." (Zitiert in Lely: Sozialhilfe. Weniger Kleidung im Winter, in: BODO 11/1997, S.9).
[20] Vgl. Specht: Löcher im Netz, S.128.
[21] Vgl. N.N.: Wohnen. Zweite Miete legt kräftig zu, in: Frankfurter Rundschau, 13.1.1998, S.11
[22] Aktuell '98. Das Lexikon der Gegenwart, Dortmund 1997, S.384. Vgl. auch Vesper, "Ohne höheres Wohngeld ist Reform undenkbar", in: Frankfurter Rundschau, 21.11.1997, S.5.
[23] Vgl. Steinert: "Ein Staat, der in dieser Situation seine Wohnungen verkauft, handelt unklug", in: Frankfurter Rundschau, 27.10.1997, S.14
[24] Vgl. zu diesem Abschnitt Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V.: 930.000 Wohnungslose im Jahr 1996. BAG Wohnungslosenhilfe veröffentlicht neue Schätzung, in: wohnungslos 4/1996, S.167.
[25] Politisch wird diese Einstellung am deutlichsten von sogenannten Liberalen formuliert (vgl. z.B. N.N.: FDP: Sozialsystem jetzt überwinden, in: Stuttgarter Zeitung, 22.2.1997, S.1).
[26] Vgl. von Appen: Nackten in die Tasche greifen. Senat möchte bei Verkäufern der Obdachlosenzeitung "Hinz und Kunzt" abkassieren / Diakonie: "Projekt in Gefahr", in: taz, 17.11.1994; Lewy: Mit "fiftyfifty" begann das neue Leben. Ein Jahr Obdachlosen-Zeitung - Über 160 000 DM für die Armen, in: Neue Rhein Zeitung, abgedruckt in: Ostendorf, Hubert (V.i.S.d.P.): Die Arbeit von Asphalt im Spiegel der Düsseldorfer Presse, o.J. und Möhnle: Wieder zurück auf die Straße? Obdachlosenzeitung "Trott-war" vor dem Aus, in: Sonntag Aktuell, 18.1.1998, S.5.
[27] So nennt sich z.B. die Kölner Zeitung Bank Extra selbst "Kölns dienstälteste Obdachlosenzeitung", auch Platte (Bingen) führt die Bezeichnung "Obdachlosenzeitung" im Titel. WOHNUNGSLooser (Michelstadt) bezeichnete sich in seiner zweiten Ausgabe vom Frühjahr 1995 noch als "Obdachlosenzeitung für die Bundesrepublik Deutschland", später heißt die Zeitung dann "Selbsthilfezeitung gegen Armut und Obdachlosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland".
[28] Ich traf mehrere Verkäufer in Düsseldorf, die fiftyfifty als "Obdachlosenzeitung" anpriesen. Vgl. auch Simone: Wie ich zu motz kam, in: motz 19/97, 1.9.1997, S.13 und Marek: Nur eine Anzeige?, in: Strassenfeger Nr.7, April/Mai 1997, S.15.
[29] Schnelle: "Armut kann jeden treffen, in: BODO 10/97, S.22f.
[30] Von unge. Kölsches Blatt 12/97, S.1: "Nicht Almosen-, nicht Tränendrüsen-, nicht Zuguck-, sondern Gegenwehr-Mitmachzeitung". Vgl. auch Rosenke: "Bunte Blätter": die bundesdeutschen Straßenzeitungen haben sich etabliert. Eine Bestandsaufnahme, in: wohnungslos 4/1995, S.154-160, S.156: BISS (Bürger in sozialen Schwierigkeiten; München) "will kein reines Wohnungslosenmagazin sein, sondern ein Projekt für und unter Mitarbeit von Bürgern in sozialen Schwierigkeiten."
[31] Vgl. S.7 dieser Arbeit.
[32] Zu The Big Issue siehe Rosenke: Straßenzeitungen. Dauerbrenner oder Strohfeuer?, in: Gefährdetenhilfe 2/1994, S.73-77, S.73 und Schumacher; Winkelhorst: Alternativer Medienmarkt der Straßenzeitungen. Eine neue Bewegung im gesellschaftlichen Unten? In: Soziale Arbeit 2/97, S.54-61, S.54.
[33]Zitiert in Rosenke: Straßenzeitungen. Dauerbrenner oder Strohfeuer?, in: Gefährdetenhilfe 2/1994, S.73-77, S.73.
[34] Zahl für 1996. Im Sommer liegt die Auflage mit 100 000 etwas niedriger als im Winter, wenn 120 000 Exemplare pro Monat verkauft werden (Infobrief für den Freundeskreis Nr.1/1996).
[35] In den Sommermonaten, in denen weniger Zeitungen nachgefragt werden, erscheint von BISS München eine Doppelnummer für Juli und August.
[36] Asphalt, Hannover: Dezember 1997 50 000; Fiftyfifty, Düsseldorf incl. der Lokalausgaben in Duisburg und Mönchengladbach : 55 000 (Interview mit Hubert Ostendorf, dem leitenden Redakteur von fiftyfifty, Düsseldorf 1997, S.2); Trott-war, Stuttgart: Februar 1998: 40 000; BISS, München, Oktober 1997: 30 000.
[37] Vgl. BODO, April bis Dezember 1997, S.18.
[38] N.N.: Das Hamburger Straßenmagazin. "Hilfe zur Selbsthilfe für Hamburgs Obdachlose", o.J. (Leporello).
[39] Interview Ostendorf, S.1.
[40] BISS, Bürger in sozialen Schwierigkeiten, Kurzkonzept, o.J., S.2.
[41] TROTT-WAR. Die Straßenzeitung im Südwesten, o.J..
[42] Je nach Projekt erhalten sie zwischen 40% (Trott-war Stuttgart) und 52% (Hinz & Kunzt, Hamburg; BISS, München) des Verkaufspreises der Zeitung, d.h. der/die Verkaufende verdient pro verkaufter Zeitung zwischen 1.- und 1,30.-. Der dem Projekt verbleibende Betrag muß - mit Ausnahme von i.d.R. zehn Startexemplaren - vorfinanziert werden.
Infobrief für den Freundeskreis Nr.3/1996). Vgl. Trott-war, Stuttgart, Pressemappe S.1: ..."von professionellen Journalisten und Layoutern gemacht."
[44] Vgl. N.N.: Das Hamburger Straßenmagazin. "Hilfe zur Selbsthilfe für Hamburgs Obdachlose", o.J. (Leporello).
[46] Bei Fiftyfifty, Düsseldorf wird der Vertrieb ehrenamtlich von einem pensionierten Ingenieur gemanagt, eine explizit für den Sozialdienst zuständige sozialarbeiterische bzw. sozialpädagogische Fachkraft gibt es, da sie im Moment von dem Projekt nicht finanziert werden kann, nicht. Um die VerkäuferInnen "kümmert" sich "eine Gemeindeschwester im Ruhestand" (Interview Ostendorf, S.1 und S.4). Auch Die Straße, Solingen beschäftigt keine SozialarbeiterInnen. BODO, Bochum; Dortmund hatte aus Mitteln eines Programms des Landes Nordrhein-Westfalen, mit dem die Anstellung von SozialarbeiterInnen bei Straßenzeitungen mit mindestens 30 VerkäuferInnen für drei Jahre gefördert werden sollten (vgl. Henke: Beispielhafte Hilfen zur dauerhaften Wohnraumversorgung für Wohnungsnotfälle des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, in: wohnungslos 1/1997, S.36-42, S.41) eine Sozialarbeiterin angestellt. Die Förderung wurde jedoch kurze Zeit später wieder gestrichen, da das auf jährlich vier Millionen DM angelegte Programm für 1998 auf (!) 500 000 DM gekürzt worden war (vgl. Asche: Editorial, in: BODO 10/1997, Oktober 1997, S.3 und N.N.: BODO-Projekt. Wird Hilfe gestrichen?, in: BODO 10/1997, S.9).
[47] Interview Ostendorf, S.1f.
[48] Vgl. z.B. Tommy: Gute Zeiten, schlechte Zeiten bei BODO, in: BODO 5/1997, S.2 und Rolf: "Es wird merklich kälter!", in: BODO 12/1997, S.2.
[49] Schmid: Intro, in: Trott-war, Februar 1998, S.3.
[50] Vgl. z.B. BISS, München, September 1998, S.26: "Im Klartext kommen Bürger in sozialen Schwierigkeiten ungeschminkt und unredigiert zu Wort."; Hinz & Kunzt, Hamburg, Dezember 1997, S.14: "Hinz & Kunzt ist nicht nur eine Zeitung, mit der Wohnungslose Geld verdienen können, sondern in der sie auch selbst zu Wort kommen. Auf den Forum-Seiten steht, was Obdachlose zu sagen haben."
[51] Diese Beobachtung bestätigt auch Rosenke: "Bunte Blätter", in: wohnungslos 4/1995, S.154-160, S.155.
[52] Infobrief für den Freundeskreis Nr.3/1996, S.2.
[53] Trott-war Pressemappe, S.1.
[54] Interview Ostendorf, S.3.
[55] Vgl. BODO 5/1997; 8/1997 und 12/1997, jeweils S.6-8.
[56] So Trott-war, siehe z.B. Trott-war Februar 1998, S.18.
[57] In Hannover und Düsseldorf eher weniger, in Hamburg und Stuttgart eher mehr. In BODO (Bochum und Dortmund) füllen Veranstaltungstips fast 30% jeder Ausgabe.
[58] In der "Schreibwerkstatt" findet "betreutes Schreiben"statt (Rosenke: "Bunte Blätter", S.156).
[59] Vgl. Infobrief für den Freundeskreis Nr.1/1996, S.2.
[60] Vgl. Möhnle: Wieder zurück auf die Straße? Obdachlosenzeitung "Trott-war" vor dem Aus, in: Sonntag Aktuell 18.1.1998, S.5 und Denninger: BISS 1996 und 1997 - Worte, Zahlen, Ziele, in: BISS Juli/August 1997, S.36f.
[61] Hinz & Kunzt hatte 1996 bei einer durchschnittlichen Auflage von 110 000 Exemplaren Druckkosten von etwa 24 000.- (Infobrief für den Freundeskreis 1/1996, S.2). Die - allerdings aufwendiger hergestellte - Zeitung BISS, München wendete 1996 bei einer wesentlich geringeren Auflage pro Ausgabe durchschnittlich etwa 28 000.- an Herstellungskosten auf (Denninger: BISS 1996 und 1997, S.36f).
[62] Beispiel Trott-war, Stuttgart Februar 1998 (Ausgabe mit insgesamt 40 Seiten): 4 ganzseitige Anzeigen (Ambulante Hilfe für arme Menschen e.V.; Zweitausendeins [CD-Verlag]; Bau-Boden-Treuhand GmbH, Stuttgart; Caritasverband, Stuttgart), 8 kleinere Anzeigen (Leipziger Buchmesse; Theaterhaus Stuttgart, Programm Februar 1998; Altes Schützenhaus Stuttgart, Programm Februar 1998; Treffpunkt Rotebühlplatz Stuttgart, Kulturprogramm Februar 1998; Reisefieber [Reisebüro in Stuttgart]; Unternehmen bietet Herausforderung [Telefonnr. in Stuttgart]; Deleika [Drehorgelfirma in Dinkelsbühl, ca. 100 km von Stuttgart]; Fremdenverkehrsamt Aalen [ca. 60 km von Stuttgart]).
[63] Interview Ostendorf, S.4.
[64] Vgl. Infobrief für den Freundeskreis Nr.1/1996. Als einziges mir bekanntes Projekt hat Hinz & Kunzt eine Anzeigengeschäftsleiterin eingestellt.
[65] Unter "Erlöse Abonnements, Druckkostenübernahme [bei BISS übernimmt eine Münchener Apotheke regelmäßig die Druckkosten für eine Seite, siehe z.B. BISS, Juli/August 1997, S.21], Sonstige Erlöse" wies BISS für 1996 12 177,79 DM aus, das sind etwa 1,6% der jährlichen Ausgaben (Denninger: BISS 1996 und 1997, S.36f).
[66] Asphalt, Dezember 1997, S.3f.
[67] Infobrief für den Freundeskreis Nr.1/1996. Darüber hinaus hat der Verein Hinz & Kunzt einen Wohnungspool gegründet, dessen vier angestellte MitarbeiterInnen (drei Sozialpädagoginnen und ein ehemaliger Wohnungsloser, dessen Beruf mir unbekannt ist) zu 100 Prozent aus Spendenmitteln finanziert werden.
[68] Gemeinnützige Vereine können sich beim Landgericht registrieren lassen, um Bußgelder für z.B. Vergehen im Straßenverkehr erhalten zu können.
[69] Vgl. Denninger: BISS 1996 und 1997 - Worte, Zahlen, Ziele, in: BISS Juli/August 1997, S.36f.
[70] Vor Weihnachten z.B. wird im Regelfall mehr gespendet, wenn auf die Oderflut die Spendenflut folgt, wird sehr wenig für lokale Projekte gegeben usw.
[71] Der Hinz & Kunzt Freundeskreis (Leporello), siehe auch: Infobrief für den Freundeskreis Nr.3/1996, S.2.
[72] Vgl. Asphalt,Dezember 1997, S.26.
[73] Vgl. BISS-Kurzkonzept, S.2 und Trott-war, Februar 1998 u.ö., jeweils S.38. Eine klare Aussage, daß die Regelmäßigkeit einer Spende erwünscht ist, fehlt in der Trott-war-Anzeige.
[74] Vgl. für Hinz & Kunzt Infobrief für den Freundeskreis Nr.1/1996; für BISS Denninger: BISS 1996 und 1997 - Worte, Zahlen, Ziele, in: BISS, Juli/August 1997, S.36f, für trott-war Möhnle: Wieder zurück auf die Straße?, S.5.
[75] Lewy: Mit "fiftyfifty" begann das neue Leben. Ein Jahr Obdachlosen-Zeitung - Über 160 000 DM für die Armen, in: Neue Rhein Zeitung, abgedruckt in: Ostendorf (V.i.S.d.P.): "Die Arbeit von Asphalt im Spiegel der Düsseldorfer Presse, o.J.). Vgl. auch Werner: Seit fast drei Jahren..., in: fiftyfifty, Dezember 1997, S.1.
[76] Vgl. zu Hinz & Kunzt, Hamburg: Infobrief für den Freundeskreis Nr.1/1996; vgl. zu BISS, München Denninger: BISS 1996 und 1997, S.36f.
[77] Vgl. Denninger: BISS 1996 und 1997, S.36f; Trott-war-Pressemappe, S.8; mündliche Mitteilung eines Asphalt-Verkäufers.
[78] Vgl. Möhnle: Wieder zurück auf die Straße?, S.5.
[79] Vgl. zu Trott-war: Trott-war Pressemappe S.6 und el: Straßenzeitung Trottwar für dieses Jahr gesichert, in: Evangelisches Gemeindeblatt für Württemberg, 22.2.1998, S.18.; zu Asphalt: Höpfner, Von Loccum nach Berlin, in: Asphalt, Dezember 1997, S.22.
[80] Denninger: BISS e.V. und Zeitschrift BISS, S.2: "Alle Erlöse, die durch den Zeitungsverkauf zustande kommen, müssen an die Verkäufer in irgendeiner Form zurückfließen. Festangestellte Mitarbeiter dürfen nicht von diesem Geld bezahlt werden."
[81] Vgl. Das Hamburger Straßenmagazin. "Hilfe zur Selbsthilfe für Hamburgs Obdachlose" (Leporello) und Interview Ostendorf, S.4.
[82] Nach Schumacher; Winkelhorst: Alternativer Medienmarkt der Straßenzeitungen. Eine neue Bewegung im gesellschaftlichen Unten?, in: Soziale Arbeit 2/97, S.54-61, S.56 ist die Diskrepanz zwischen dem "Unternehmen Straßenzeitung" und dem "Sozialprojekt Straßenzeitung" der "Grundkonflikt der Straßenzeitungsprojekte allgemein".
[83] Stolle: Hinz & Kunzt Verkäufer-Analyse. Bedarfserhebung zum Thema Wohnen und Arbeiten, Hamburg 1995, S.10.
[84] Vgl. N.N.: Hinz & Kunzt-Wohnungspool, Hamburg 1996 (Leporello).
[85] Müller-Classen: Es geht ums Geld, in: Hinz & Kunzt Nr.58, Dezember 1997, S.2
[86] Vgl. Riek (verantwortlicher Redakteur): "Wege aus der Obdachlosigkeit", in: Freies Radio Stuttgart, 19.12.1996 und Möhnle: Wieder zurück auf die Straße?.
[87] Vgl. z.B. Trott-war, Februar 1998, S.4
[88] Ein Belegungsrecht für eine Einzimmerwohnung mit Wohnküche kostet etwa 32 000 DM (vgl. Denninger, BISS e.V. und Zeitschrift BISS, München 1997, S.2).
[89] Werner, Seit fast 3 Jahren ..., in: fiftyfifty, Dezember 1997, S.3.
[90] Dieser Abschnitt beruht im Wesentlichen auf zwei Gesprächen, die ich mit Von unge-Mitarbeitern in der Kölner Fußgängerzone geführt habe und der Zeitung Von unge Nr.65, 12/1997.
[91] Ein Von unge-Mitarbeiter: "Wir sagen: eigeninitiativ handeln, kollektiv denken und gemeinschaftlich, auch im kollektiven Sinne verkaufen."
[92] Von unge Nr.65, 12/1997, S.1.
[93] Zahl für Dezember 1997 (Von unge Nr.65, 12/1997, S.20).
[94] Von unge Nr.65, 12/1997, S.3.
[95] § 2 der Satzung des Vereins in der Fassung vom 8.6.1997.
[96] Schneider; Welle (für den Verein "mob" e.V.): Editorial 3/97, Berlin 1997.
[97] Vgl. die Internetseite Stefan Schneider, zosch @fub46.zedat.fu-berlin.de.
[98] Schroeder: Obdachlos und nun? Sozialarbeiterische Unterstützung beim Strassenfeger, in: Strassenfeger Nr.1, Januar 1998, S.30.
[99] Schneider; Welle (für den Verein "mob" e.V.): Editorial 3/97, Berlin 1997.
[100] Vgl. Bad: Soziales Gewissen?, in: Strassenfeger Nr.23, Dezember 1997, S.4 und Krampitz: Neuer Job mit alter Arbeit, in: Strassenfeger Nr.20, Oktober/November 1997, S.9.
[101] "Auf den folgenden Seiten kommen Menschen zu Wort, die Sie liebe Leser, bisher nur als Verkäufer wahrgenommen haben ...", in: Strassenfeger Nr.7, April/Mai 1997, S.14.
[102] Vgl. z.B. Gerald: Pennertagung?, in: Strassenfeger Nr.22, November 1997, S.21: "Bei uns ist das oberste Gebot, daß Verkäuferartikel bevorzugt behandelt werden."
[103] Vgl. Rosenke: Tagungsbericht: Erste Tagung der bundesdeutschen Straßenzeitungen, in: wohnungslos 4/1995, S.166f; dies.: Tagungsbericht: Zweite Tagung der Straßenzeitungen Berlin 25. bis 27.Oktober 1996, in: wohnungslos 4/1996, S.170f; dies.: Dritte Tagung der Straßenzeitungen Evangelische Akademie Loccum 27. bis 29.Oktober 1997, in: wohnungslos 4/1997, S.176. Daß sich eine Kooperation der beiden führenden Berliner Blätter motz und Strassenfeger als fast unmöglich erweist, erschließt sich dem Nichtberliner nicht unmittelbar. Der Grund dürfte m.E. eine unentwirrbare Mischung aus konzeptionellen und persönlichen Differenzen sein (vgl. dazu: Krampitz: Obdachlosenzeitungen. Betr.: "Schreiben und Wohnen", taz vom 21.9.96, in: Stefan Schneider, zosch @ fub46.zedat.fu-berlin.de).
[107] Vgl. z.B. Zeuner: Die Menschmaschine. Kritische Geschichte der Psychiatrie, in: Strassenfeger, Nr.2, Januar 1998, S.12f.
[108] Vgl. Becker; Schmitz, Schrei nach normalem Leben, in: Strassenfeger Nr.24, Dezember 1997, S.5: "Aus diesem Grund gibt es Projekte wie den Strassenfeger, bei denen Menschen wie wir wieder einen ersten Schritt in die Arbeitswelt gehen können und den >normalen< Bürgern zeigen, daß wir keine Sozialschmarotzer sind, sondern nur nicht die Möglichkeit haben, wie sie anderen in die Wiege gelegt sind.". Vgl. auch Schneider: Editorial, in: Strassenfeger Nr.7, April/Mai 1997, S.2: Der Verein wurde als gemeinnützig anerkannt wegen "Förderung der Volksbildung".
[109] Vgl. zum Folgenden Arlt: Von der Straße auf den Weg zur Zeitung, in: Signal, Ausgabe 1, November 1995, S.3f.
[110] Mündliche Information bei einem Besuch in Marl im Dezember 1997.
[111] Angaben aus einem mir zur Verfügung gestellten "Fragebogen zur Analyse des Obdachlosenpressemarktes."
[112] Signal, Ausgabe 1, November 1995, S.2.
[113] Vgl. Signal, Ausgabe 1, November 1995, S.15.
[114] Laut dem mir vorliegenden Fragebogen deckte der Verkauf nur 10 Prozent der Kosten.
[115] Vgl. N.N.: Editorial, in: Signal, Ausgabe 1, November 1995, S.2.
[116] Vgl. zum Folgenden Lermann: Zeitung machen, in: Looser / Strassenfeger, März/April 1998, S.20f.
[117] N.N.: Eine Mark von jeder Zeitung für den Verkäufer. Deshalb überall Lokalredaktionen gründen!, in: WOHNUNGSLooser Nr.2, März / April / Mai 1995, S.3.
[118] Looser 5/1997 u.ö., S.2.
[119] Looser 5/1997, S.14. Gabriele Lermann, die viele Artikel im Looser schreibt, ist jedoch laut Aussage von Jedermann; Streetworker, Darmstadt Journalistin und hatte für das Darmstädter Echo gearbeitet.
[120] Lermann: Zeitung machen, in: Looser / Strassenfeger, März/April 1998, S.20.
[121] Das Titelbild der 2.Ausgabe des damals noch WOHNUNGSLooser genannten Blattes faßt diese Dimension kurz und prägnant zusammen. Zu sehen ist ein Verkäufer, der gerade einer Kundin eine Zeitung verkauft. Die Schlagzeile der Ausgabe heißt "Endlich Arbeit", als Untertitel ist zu lesen: "Früher Bettler - jetzt Verkäufer. Obdachlosenzeitungen schaffen Arbeitsplätze".
[122] N.N.: Endlich Arbeit ..., in: WOHNUNGSLooser Nr.2, März / April / Mai 1995, S.2.
[123] Vgl. Selbsthilfeförderverein Arbeit und Wohnen e.V.: "Bauen mit Obdachlosen", Projektreader, Erbach 1997, S.7. Vgl. zum Folgenden den gesamten Reader und N.N.: Darmstadt - eine Chance für das Bauprogramm?, in: Looser 7/1997, S.10f.
[124] "Auch dies ist einer wichtigen Erfahrung geschuldet. Nämlich, daß jemand, der aus unserer Ellenbogenleistungsgesellschaft mit ihrer vorwiegend hierarchischen Organisation herausgefallen ist, einen sofortigen Einstieg weder will, noch kann und auch nicht soll" (Selbsthilfeförderverein Arbeit und Wohnen e.V.: "Bauen mit Obdachlosen", Projektreader, Erbach 1997, S.7).
[125] Vgl. Looser 6/1997, S.26f; 7/1997, S.14f u.ö..
[126] Vgl. die gesamte Ausgabe 7/1997.
[127] Vgl. das Impressum Looser / Strassenfeger Februar / März 1998, S.2.
[128] Lermann: Loccum - Tagung zwischen großen Ideen und Kleinkrämerei. Lobby, Straßenfeger und Looser übernehmen ideologische Vorreiterrolle, in: Looser 11/1997, S.29.
[129] Vgl. Rosenke: Tagungsbericht: Erste Tagung der bundesdeutschen Straßenzeitungen, in: wohnungslos 4/1995, S.166f.
[130] Auch in Düsseldorf ist es möglich, den Looser zu erwerben, wie mir ein Freund berichtete.
[131] Lermann: Looser-Verkäufertreffen in Essen/Steele: Künftig eine eigene Lokalredaktion, in: Looser / Strassenfeger Februar / März 1998, S.22.
[132] Die folgenden Ausführungen beruhen auf einem im April 1998 geführten Gespräch mit dem Vereinsvorsitzenden Werner H. Wilhelm, der bereits von 1984 bis 1986 zusammen mit sechs Kollegen im Ruhrgebiet eine Straßenzeitung mit dem Namen Die sieben Zwerge herausgegeben hatte.
[133] Wilhelm: "Die anderen Zeitungen sind deshalb so teuer, weil sie sich zeitlich eingrenzen und am Ende des Monats eventuell noch große Bestände übrig haben."
[134] "Trinkgelder" nicht eingerechnet.
[135] Wilhelm: "Da bin ich stolz drauf."
[136] Vgl. Jedermann Frühjahr 1998, S.6.
[137] Vgl. Jedermann Frühjahr 1998, S.11 und Streetworker, Winter/Frühjahr 1998, S.15.
[138] Zur Kritik an einer Einrichtung des Diakonischen Werks siehe z.B. Jedermann, Frühjahr 1998, S.8-10.
[139] Er sprach davon, daß Ende des Monats von der Ausgabe März 1998 bei einer Auflage von 95 000 bestimmt 50 000 Exemplare noch nicht verkauft worden seien.
[140] Siehe dazu Punkt 2.2.5., S.37-39 dieser Arbeit.
[141] Vgl. Looser; Lobby-Press-Info-Service, 11/1997, S.32.
[142] Vgl. Rosenke: Tagungsbericht: Erste Tagung der bundesdeutschen Straßenzeitungen, in: wohnungslos 4/1995, S.166f; dies.: Tagungsbericht: Zweite Tagung der Straßenzeitungen Berlin 25. bis 27.Oktober 1996, in: wohnungslos 4/1996, S.170f, dies: Dritte Tagung der Straßenzeitungen Evangelische Akademie Loccum 27. bis 29.Oktober 1997, in: wohnungslos 4/1997, S.176.
[143] Vgl. PDS-Bundestagsgruppe: Asylbewerberleistungsgesetz, in: Streetworker Winter/Frühjahr 1998, S.4-6; Knake-Werner (Bundestagsabgeordnete): Erstes SGB III-Änderungsgesetz, in: Streetworker Winter/Frühjahr 1998, S.7f, Stolzenberg (Fachhochschuldozent) : Die "neue"Arbeitslosigkeit für den Anspruch auf Arbeitslosengeld oder - wie schafft man neue Arbeitslose?, in: Streetworker Winter/Frühjahr 1998, S.11.
[144]Bei Jedermann; Streetworker und beim Looser scheint diese Zielvorgabe nicht immer erfüllt zu werden.
4 [145] Straßenkreuzer: Der STRAßENKREUZER e.V. stellt sich vor, Nürnberg o.J..
[146] Wilmer: "Ein großer Schritt vorwärts" (Interview mit Yvonne Legner), in: draußen! 6/97, S.15.
[147] Vom Straßenkreuzer erscheinen vierteljährlich 25 000 Exemplare (Straßenkreuzer: Der STRAßENKREUZER e.V. stellt sich vor, Nürnberg o.J.), draußen! erscheint alle zwei Monate mit einer Auflage von 10 000 Exemplaren (Internet).
[148] Sogar Verkäufer von monatlich erscheinenden Straßenzeitungen beobachteten einen Rückgang ihrer Einnahmen innerhalb des Erscheinungsmonats. Wenn die Ausgabe neu ist, wird wesentlich mehr verkauft als am Ende eines Monats. Bei Zeitungen, die alle zwei- oder drei Monate erscheinen, dürften die Einnahmeeinbußen am Ende eines Turnus noch gravierender ausfallen.
[149]Siehe dazu Punkt 2.2.4, S.31-36 dieser Arbeit.
[150] Straßenkreuzer: Der STRAßENKREUZER e.V. stellt sich vor, Nürnberg o.J., vgl. auch Wilmer: "Ein großer Schritt vorwärts" (Interview mit Yvonne Legner), in: draußen ! 6/97, S.15.
[151] Henke: Beispielhafte Hilfen zur dauerhaften Wohnraumversorgung für Wohnungsnotfälle des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, in: wohnungslos 1/1997, S.36-42, S.41.
[152] Vgl. Wilmer: "Ein großer Schritt vorwärts", in: draußen !, S.15. Auch die in Bochum und Dortmund erscheinende Zeitung BODO hatte eine Sozialarbeiterin eingestellt, die sich aufgrund der Einsparungen in Düsseldorf nicht mehr finanzieren ließ (vgl. S.11f, Anm.46 dieser Arbeit).
[153] Brief von Thomas Kater vom 10.11.1997.
[154] Kater: Liebe LeserInnen und Leser ..., in: Abseits !? Nr.6/1997, Dezember/Januar, S.3.
[155] Kater: Konzeption zur Erstellung einer Straßenzeitung in Osnabrück, Osnabrück 1995.
[156] Vgl. z.B. Noldin: Ein Rucksack als Zuhaus! Eine Fortsetzungsgeschichte, in: Abseits!? 6/1997, Dezember/Januar, S.19, 1/1998, Februar/März, S.23, 2/1997, April/Mai, S.22.
[157] Vgl. z.B. Riemenschneider: Zuschauer im Konsumland Deutschland. Die psychosozialen Folgen von Arbeitslosigkeit und Armut, in: Abseits!?, Nr.2/1998, April/Mai, S.14 und Umlauft: Nachdenkliches zum Vorurteil: Wer arbeiten will, der findet auch Arbeit, in: Abseits !?, Nr.2/1998, April/Mai, S.24.
[158] Vgl. z.B. Flethe: Abseits!? In der Schule. Besuch in der Agnes-Miegel Realschule und ders.: Abseits!? In der Bonnuskirche zu Osnabrück! Obdachlos = Abseits?, in: Abseits!?, Nr.2/1998, April/Mai, S.8 und Riemenschneider: Abseits!? in der Kirche. "Obdachlos = Abseits?", in: Abseits!?, Nr.6/1997, Dezember/Januar, S.14.
[159] Vgl. z.B. Thole: Wichtige Änderungen ab dem 01.Januar 1998. Arbeitslos und keine Nebenjobs, in: Abseits!?, Nr.6/1997, Dezember/Januar, S.8.
[160] Nie Wo Los wird anhand eines Gespräches mit einem in der Begegnungsstätte "Das Weiße Haus" arbeitenden Sozialarbeiter und der Ausgabe 3/1997 dargestellt.
[161] Büsselberg: statt park setzt seine Informationsarbeit fort, in: statt park. statt Park. Hilfen für Nichtseßhafte und Wohnungslose. Informationen für Bürger und Betroffene, Ausgabe 2, Juni 1996, S.1.
[162] BODO, Bochum; Dortmund, Bank Extra, Köln, Hempels Straßenmagazin, Kiel, Abseits!?, Osnabrück und Platte, Bingen.
[163] Platte, 1.Jahrgang (1993), Ausgabe 1, S.1
[164] Zitiert in Rosenke: "Bunte Blätter", S.155.
[165] Siehe z.B. Josef: Knast, in: Platte, Ausgabe 14, März bis Juni 1997, S.10: "Die Kraft, nochmal von vorne anzufangen, die habe ich nicht mehr. Mit 62 hat man auch leider nicht mehr allzu viele Perspektiven. Ich gönne es keinem, daß er mal diese Erfahrung machen muß, denn oftmals gibt es kein Zurück."; Hannes: Obdachlosigkeit - ein Teil unserer Gesellschaft, in: Platte Ausgabe 15, Juni bis September 1997, S.6f und Manfred; Blümlein: Absprung, in: Platte Ausgabe 18, März bis Juni 1998, S.8f.
[166] Platte Ausgabe 7, S.11.
[167] Dieser Abschnitt beruht im Wesentlichen auf Aussagen der Bank-Extra-Redaktion, die ich im Dezember 1997 besuchte.
[168] Zitiert in Rosenke: "Bunte Blätter", S.155.
[169] Zitiert in Schumacher; Winkelhorst: Alternativer Medienmarkt der Straßenzeitungen. Eine neue Bewegung im gesellschaftlichen Unten? In: Soziale Arbeit 2/97, S.54-61, S.56.
[170] Vgl. Heinz: Vorurteile? Vorurteile!, in: Bank Extra, Oktober/November 1997, S.14: "Als Nichttrinker, Nichtalkoholiker, Nichtsäufer stehst du in dieser Szene da wie eine Minderheit und bist verraten und verkauft, wenn du Hilfe und Unterstützung brauchst. ... Zwingende Frage: Geht es mir eventuell besser, wenn ich anfange zu trinken, werde Alkoholiker, gehe dann in die Entgiftung, dann Entziehungskur, bin dann bekehrt, werde zum Held bei Sozialarbeitern (toll, der hat's geschafft) und bekomme alles was ich brauche! Oder bleibe ich so wie ich bin, dann bin ich der Depp, der ich vorher auch schon war (denn was ich nicht hatte, kann ich auch nicht ablegen, also habe ich auch nichts geschafft)!...".
[171] Dieser Abschnitt beruht im Wesentlichen auf zwei Gesprächen, die ich im Dezember 1997 mit einem über ABM angestellten Vertriebsmitarbeiter und dem Projektleiter führte.
[172] Vgl. hierzu Tein: In eigener Sache. Hempels Straßenmagazin im Wandel der Zeit. Eine Bestandsaufnahme, in: Hempels Straßenmagazin, Nr.20, Dezember 1997, S.4-6.
[173] Vgl. dazu auch Pott: Freude, in: Hempels Straßenmagazin, Nr.20, Dezember 1997, S.7: "...Wie wird sich in Zukunft die Beziehung von >festen< Mitarbeitern und VerkäuferInnen gestalten? Spannungen sind da vorprogrammiert. ... Außerdem gibt es noch eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die, wie die meisten Mitarbeiter der Hempel's-Crew im Elend leb(t)en. Wir müssen das bleiben, was wir am Anfang waren: Sprachrohr der Sprachlosen."
[174] Bank Extra hatte gegenüber Hinz & Kunzt (und gegenüber BISS) einen ähnlichen Einwand.
[175] Tein: In eigener Sache, S.5.
[176] Rosenke: Dritte Tagung der Straßenzeitungen Evangelische Akademie Loccum, 27. bis 29.Oktober 1997, in: wohnungslos 4/1997, S.176.
[177] Vgl. die auf S.9-11 dieser Arbeit zitierten Konzeptionen.
[178] Leider ist mir nicht bekannt, welche 28 Projekte bei dem Treffen dabei waren. Von unge, Köln und Jedermann; Streetworker, Darmstadt waren z.B. mit Sicherheit nicht dort. Abseits, Osnabrück war jedoch dabei (mündliche Mitteilungen).
[179] Vgl. Grüner: Ohne das Gejammere, in: Die Zeit 24.12.1993; N.N.: "Hinz & Kunzt", in: Bild 8.11.1993; von Appen: Nackten in die Tasche greifen. Senat möchte bei Verkäufern der Obdachlosenzeitung "Hinz und Kunzt" abkassieren / Diakonie: "Projekt in Gefahr", in: taz 17.11.1994.
[180] So ist z.B. in der von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe herausgegebenen Zeitschrift "Wohnungslos", soweit ich sehe, bisher weder über die Selbsthilfeprojekte Von unge, Jedermann und Signal, noch über die von der Wohnungslosenhilfe herausgegebenen Blätter statt park, Abseits und Nie Wo Los berichtet worden. Über Hinz & Kunzt dagegen wurde bisher mindestens sechsmal geschrieben. Die gleiche Tendenz zeigt der ausführliche Artikel von Schumacher; Winkelhorst: Alternativer Medienmarkt der Straßenzeitungen. Eine neue Bewegung im gesellschaftlichen Unten?, in: Soziale Arbeit 2/97, S.54-61. Dort wird außer der Mischform Bank Extra weder ein Selbsthilfeprojekt noch eine von der Wohnungslosenhilfe initiierte Zeitung erwähnt.
[181] Rosenke: "Bunte Blätter", S.154.
[182] Vgl. S.33f dieser Arbeit.
[183] Vgl. N.N.: Steigendes Engagement Essener Bürger, in: statt park, Ausgabe 2, Juni 1996, S.10.
[184] Vgl. dazu Wallmann: Kirchengeschichte Deutschlands II, Frankfurt/Main; Berlin; Wien 1973, S.239-241. Die logische Vorordnung des auf Barmherzigkeit gegründeten Ausgleichs ungerecht verteilter Güter und Ressourcen gegenüber der Veränderung von Ungerechtigkeit schaffenden Strukturen scheint m.E. auch noch in dem gemeinsamen Wort der großen christlichen Kirchen "Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit" vom Februar 1997 auf (vgl. Rat der Evangelischen Kirchen in Deutschland; Katholische Deutsche Bischofskonferenz: Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, Hannover; Bonn 1997). Dabei wäre es durchaus möglich, aus der prophetischen Tradition eine Vorordnung der Gerechtigkeit abzuleiten.
[185] Vgl. S.23 dieser Arbeit.
[186] Nie Wo Los, Gelsenkirchen und Bank Extra, Köln bezeichneten es als großes Problem, StammverkäuferInnen zu gewinnen. Fiftyfifty, Düsseldorf hatte am Anfang, als das Projekt noch nicht sehr bekannt war, die gleichen Schwierigkeiten (Interview Ostendorf, S.1).
[187] So wird z.B. in Gelsenkirchen regelmäßig der etwa vierteljährlich in einer Auflage von 30 000 erscheinende Wohnungsloser aus dem benachbarten Essen ebenso verkauft wie das monatlich in etwa 20 000 Exemplaren gedruckte Blatt BODO aus Bochum und Dortmund (vgl. C., Michael: DANKE INTEGO; TSCHÜß SOZIALHILFE, in: Wohnungsloser, Ausgabe 9, 1997/98, S.22 und Tommy: Solider Lebenswandel, in: BODO 6/1997, S.2).
[188] Dies ist nicht selbstverständlich. Laut einer fiftyfifty-Verkäuferin wird das Düsseldorfer Blatt auch von Studierenden und abhängig Beschäftigten verkauft. Dies soll sich aber durch die Ausgabe neuer Ausweise ändern. Nach Angaben von Hempels (Kiel) können dort auch RentnerInnen verkaufen.
[189] Im Falle des Hinz & Kunzt-Verkäufers ist dies besonders bemerkenswert, da nach der Konzeption von Hinz & Kunzt aktuelle oder ehemalige Obdachlosigkeit Bedingung ist, um bei der Zeitung als Verkäuferin oder Verkäufer mitzuarbeiten (Vgl. Fragen und Antworten zu Hinz & Kunzt, S.2).
[190] Vgl. hierzu auch die Aussage eines Essener Wohnungsloser-Verkäufers: "Viele Leute erklären mich für verrückt, wenn ich sage, daß ich keine Sozialhilfe beziehen möchte. Ich wiederum möchte von diesem Staat keine Almosen haben, sondern Arbeit." (C.: DANKE INTEGO; TSCHÜß SOZIALHILFE, in: Wohnungsloser, Essen, Ausgabe 9, 1997/1998).
[191] Zum Vergleich: Laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe machen nur rund 17% aller Wohnungslosen ihren Anspruch auf Sozialhilfe auch geltend (zitiert in Jedermann, Frühjahr 1998, S.29).
[192] Trotz des nach §§ 4 BSHG bestehenden Rechtsanspruches auf Hilfe zum Lebensunterhalt gibt es immer wieder Kommunen, die einem Anspruchsberechtigten nur eine begrenzte Anzahl an Tagessätzen pro Monat (vgl. Heins, Obdachlosenreport. Warum immer mehr Menschen ins soziale Elend abrutschen, Düsseldorf 1993 und Lermann: Vom Verbrechen, Sozialhilfeempfänger zu sein, in: Looser 9/1997, S.4-6) oder einen gekürzten Satz auszahlen (vgl. Hammel: Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, Beschluß vom 10.Oktober 1997, Az: 4L 1062/97: Auch ein mittelloser "wohnungsloser Durchreisender" verfügt über einen Rechtsanspruch auf einen ungekürzten Regelsatz der Hilfe zum Lebensunterhalt, in: wohnungslos 4/1997, S.170-172).
[193]Vgl. S.2 dieser Arbeit.
[194] Zum Vergleich: Bei Hinz & Kunzt leben etwa 8,9% der bei der Verkäuferanalyse Befragten ganz vom Straßenzeitungsverkauf (Stolle: Hinz & Kunzt Verkäufer-Analyse. Bedarfserhebung zum Thema Wohnen und Arbeiten, Hamburg 1995, S.19), bei BISS in München sind es 11% (Denninger: BISS e.V. und Zeitschrift BISS, München 1997, S.2).
[195] Vgl. auch Jörg: Zwei Jahre BODO - so war's für mich, in: BODO 6/1997, S.22f, S.22: "Es gab oft auch arrogante Sprüche wie >Kann nicht lesen< oder >Geh' arbeiten< (dabei ist der Verkauf von BODO anstrengende Arbeit)". Vgl. auch Justus: Laßt die Armen in der Stadt. fiftyfifty-Verkäufer gegen Vertreibung, in: fiftyfifty, September 1997, S.4f. Justus hat fiftyfifty-Verkäufer interviewt, die zum Teil ähnliche Erfahrungen schildern. Es wird sogar von tätlichen Übergriffen berichtet (Watenphul: Editorial, in: BODO 11/1997, S.3).
[196] Vgl. S.9-11 dieser Arbeit.
[197] Außerdem läßt sich zumindest für Hinz & Kunzt auf der Basis der Mitte letzten Jahres vorgelegten Zahlen ein Durchschnittsverdienst errechnen.
[198] Er meinte zwar, er verkaufe in drei bis vier Stunden etwa 10 Zeitungen, ließ aber im Dunkeln, ob diese drei bis vier Stunden sein ganzer Arbeitstag sind.
[199] Dieses Problem haben alle Projekte (vgl. z.B. Zglinicki: Redaktionskonferenz beim "Strassenfeger". Nicht auf Mitleid hoffen, sondern Unterstützung fordern, in: Freitag 1/1998, abgedruckt in: Looser/Strassenfeger, März/April 1998, S.23-25, S.23 und Müller-Classen: Es geht ums Geld, in: Hinz & Kunzt Nr.58, Dezember 1997, S.2).
[200] Bei diesem Gespräch kamen mir Zweifel, ob es sinnvoll ist, zunächst einmal alles Gesagte zu glauben. Da der Mann aber innerhalb von weniger als 10 Minuten etwa fünf Zeitungen verkaufte und von etwa fünf weiteren Personen wie ein alter Bekannter begrüßt wurde, können seine Angaben durchaus der Wahrheit entsprechen.
[201] N.N.: Fragen und Antworten zu Hinz & Kunzt, Hamburg 1997, S.2.
[202] "Trinkgelder" nicht eingerechnet. Laut einer Hinz & Kunzt-Verkäuferanalyse von 1995 arbeiteten die 101 befragten VerkäuferInnen durchschnittlich 5,7 Tage pro Woche (vgl. Stolle: Hinz & Kunzt Verkäufer-Analyse. Bedarfserhebung zum Thema Wohnen und Arbeiten, Hamburg 1995, S.5). Leider wurde nicht nach dem Verdienst gefragt. Angenommen, die befragten VerkäuferInnen würden die als Durchschnitt errechneten 220 DM pro Monat verdienen, hätten sie pro Tag circa 10 DM. Der Tagesverdienst in der Gruppe der Befragten dürfte jedoch höher liegen, da sich wahrscheinlich tendenziell eher eng mit dem Projekt verbundene Hinz & Künztler in den Geschäftsräumen von Hinz & Kunzt zum Interview eingefunden hatten.
[203] Eine Ausnahme stellt der monatlich 5000 bis 7000.- verdienende Verkäufer dar.
[204] Vgl. S.46 dieser Arbeit.
[205] Vgl. dazu Stolle: Hinz & Kunzt Verkäufer-Analyse. Bedarfserhebung zum Thema Wohnen und Arbeiten, Hamburg 1995, S.5: 68,3% der Befragten beantworteten das Statement "Eine gute Bezahlung ist die beste Anerkennung für meine Arbeit" mit "trifft zu".
[206] Rosenke: Dritte Tagung der Straßenzeitungen Evangelische Akademie Loccum, 27. bis 29.Oktober 1997, in: wohnungslos 4/1997, S.176.
[207] Besonders deutlich formuliert dies fiftyfifty: "Fiftyfifty wird von den Wohnungslosen als ihre Zeitung angesehen" (Interview Ostendorf, S.1).
[208] "Wir haben über 400 Verkäufer von dieser Zeitung jetzt im Raum Düsseldorf ..."; bzw.: "Wir haben 1600 Verkäufer, davon sind 1570 obdachlos."
[209] Hervorhebung von mir. Auch zwei weitere Verkäufer sprachen von der Redaktion per "die".
[210] Vgl. zu Hinz & Kunzt: N.N.: Fragen und Antworten zu Hinz & Kunzt, Hamburg 1997, S.2; zu fiftyfifty Interview Ostendorf S.3. In Hannover traf ich einen seit Oktober 1997 arbeitenden Asphalt-Verkäufer, dessen Verkäuferausweis die Nummer 1131 trug.
[211] Hinz & Kunzt beispielsweise hat sogenannte Gebietsbetreuer angestellt, "das sind besonders zuverlässige Hinz & Kunzt-Verkäufer, die gegen ein Honorar kontrollieren , ob die Standplätze eingehalten werden. ... Kein anderer Hinz & Künztler darf in diesem Gebiet wildern. Wer sich nicht daran hält, kann seinen Ausweis bis zu zwei Monate lang verlieren." Es wird auch kontrolliert, ob ein Verkäufer bettelt oder z.B. Alkohol zu sich nimmt: "Wer zum Beispiel betrunken ist oder beim Zeitungsverkauf Drogen nimmt, riskiert seinen Hinz & Kunzt-Ausweis. In solchen Fällen greifen die vier Vertriebsmitarbeiter hart durch. Das gilt auch, wenn sie Hinz & Künztler beim Betteln mit dem H&K-Ausweis erwischen." (Infobrief für den Freundeskreis 2/1996, S.1). Auch Asphalt, Hannover und BISS, München haben einen rigiden Verhaltenskodex (vgl. zu Asphalt: Rosenke: "Bunte Blätter" in: wohnungslos 4/1995, S.154-160, S.156, zu BISS: Honigschnabel: Selbstdarstellung von BISS, München 1994, S.2: "Wer beispielsweise alkoholisiert verkauft, wird eine Zeitlang, im Wiederholungsfalle auf Dauer gesperrt").
[212] Vgl. Rosenke: Straßenzeitungen. Dauerbrenner oder Strohfeuer?, in: Gefährdetenhilfe 2/1994, S.73-77, S.76.
[213] Vgl. hierzu z.B. die Aussage einer Kasseler TagesSatz-Verkäuferin über die negativen Aspekte ihrer Arbeit: "Die blöden Sprüche manchmal und die eindeutigen Angebote find' ich Scheiße ..." (Schmidt: "Ich hatte eine Farm in Afrika, ..", in: TagesSatz Nr.3 (1997), S.24).
[214] Auch ein weiterer Düsseldorfer, der nicht mit mir reden wollte, monierte im Weggehen, es verkauften einfach zuviele die Zeitung.
[215] Wie z.B. Hinz & Kunzt, Hamburg und Asphalt, Hannover.
[216] Wie z.B. Trott-war, Stuttgart.
[217] Diese Terminologie benutzten sonst lediglich noch die Hannoveraner Verkäufer. Sonst war von anderen VerkäuferInnen eher nicht die Rede. Wurde von ihnen gesprochen, dann waren es "die" oder "die anderen."
[218] Diese Beobachtung machte für Hamburg auch Eulenberger: Macht matt, was satt macht?, in: Junge Kirche 3/1997, S.138-142, S.139: "Die Hinz & Kunzt-Verkäufer ... repräsentieren für gewöhnlich - gerade wie die Bettler, die auch bei Frost an den Hausmauern hocken und stumm, oft apathisch um eine Münze bitten - einen anderen Typ, den des ungeselligen Einzelgängers, der sich trotzig selbst helfen will."
[219] Vgl. Engelen-Kefer: "Behindertenfeindliche Tendenz schaukelt sich auf". Das Kölner Urteil und zynische Sprache in der Gesellschaft, in: Frankfurter Rundschau 26.1.1998, S.5.
[220] Vgl. hierzu z.B. die Aussage von M. Schmilinsky, der Unternehmen berät, wie sie ihre Krankheitsrate senken können: "Um zukunftsfähig zu bleiben, braucht eine Firma Mitarbeiter, die so fit sind wie die GSG 9" (Schmilinsky: "Mitarbeiter, die so fit sind wie die GSG 9", in: tageszeitung 24./25.1.1998, S.3).
[221] Vgl. S.9-11 dieser Arbeit.
[222] Siehe S.2 und S.4f dieser Arbeit.
[223] Vgl. hierzu Teil 1, S.2-6 dieser Arbeit.
[224] Vgl. z.B. Norbert: Früher Bettler . Jetzt Verkäufer. Jetzt lohnt es sich wieder zu träumen, in: WOHNUNGS-Looser Nr.2, März/April/Mai 1995, S.10.
Bei den seßhaften Verkäufern hatte ich dagegen zum Teil eher den Eindruck, der Schritt zum Straßenzeitungsverkauf ist ihnen schwer gefallen. Ein Hannoveraner Verkäufer meinte, um Verkäufer zu werden "muß man sich schon outen und sagen >Hier bin ich als Arbeitsloser<...".
[225] Siehe S.49, Anm. 205 dieser Arbeit.
[226] Nach der Hinz & Kunzt-Verkäufer-Analyse hatten fast die Hälfte der Befragten keinen Berufsabschluß; sogar über die Hälfte war bereits mehr als drei Jahre arbeitslos (vgl. Stolle: Hinz & Kunzt Verkäufer-Analyse, S.17f).
[227] Siehe dazu S.39f dieser Arbeit.
[228] Bernd: Dank motz keine Beschaffungskriminalität, in: motz 19/97, 1.9.1997, S.12.
[229] Hinz & Kunzt - 4 Jahre auf einen Blick, Hamburg 1997.
[230] Möhnle: Wieder zurück auf die Straße? Obdachlosenzeitung "Trott-war" vor dem Aus, in: Sonntag Aktuell, 18.1.1998, S.5.
[231] Es gibt jedoch mindestens ein Straßenzeitungsprojekt, die Brücke aus Erfurt, in dem nur Frauen mitarbeiten (Bosch: Abseits!? Unterwegs! Zu Besuch bei der Straßenzeitung "Brücke" in Erfurt!, in: Abseits !? Nr.2 April/Mai 1998, S.9f).
[232] Vgl. z.B. cvs: Hinz & Kunzt feiert Erfolge, in: Hamburger Abendblatt, 31.12.1993 und Grüner: Ohne das Gejammere, in: Die Zeit 24.12.1993.
[233] Vgl. die Homepage von Hinz & Kunzt.
[234] Vgl. S.19 und S.37 dieser Arbeit.
[235] Vgl. Lermann: Loccum - Tagung zwischen großen Ideen und Kleinkrämerei. Lobby, Straßenfeger und Looser übernehmen ideologische Vorreiterrolle, in: Looser 11/1997, S.29.
[236] Mündliche Mitteilung bei einem Besuch in Köln.
[237] Vgl. Müller-Classen: Es geht ums Geld, in: Hinz & Kunzt Nr.58, Dezember 1997, S.2.
[238] Deshalb sind sie eigentlich gewerbesteuerpflichtig. Viele Projekte haben inzwischen Post von den Finanzämtern bekommen, um die Frage der Versteuerung der Einkünfte aus dem Zeitungsverkauf zu klären. Um dieses Problem zu klären, hat sich die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe mit dem Ministerium für Finanzen in Verbindung gesetzt. Eine Antwort steht noch aus (Mündliche Information auf der Trott-war-Mitgliederversammlung am 23.4.1998 in Stuttgart).
[239] Dieser muß bei Projekten, die die Verteilung der Standorte dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen wie z.B. fiftyfifty, Düsseldorf regelrecht erkämpft werden.
[240] Vgl. S.52 dieser Arbeit.
[241] Dieses Ungleichgewicht ist nicht nur finanzieller Art. Es zeigt sich auch in einem niedrigeren Stellenwert, den einige Projekte ihren VerkäuferInnen einzuräumen scheinen. So sagt z.B. der Projektleiter von fiftyfifty über die Konzeption: "Fiftyfifty ist Magazin, das Obdachlosen hilft, sich selbst zu helfen. Vom Verkaufspreis (DM 2,20) dürfen die VerkäuferInnen die Hälfte behalten" (Interview Ostendorf, S.1, Hervorhebung von mir). BODO-Mitarbeiter Wagenfeld schreibt: "Als ich im Oktober '95 beim BODO-Team angefangen habe, wußte ich nicht, daß es eine kleine Karriere für mich sein wird. Als Verkäufer bin ich damals angefangen und habe mich langsam aber sicher nach vorne gearbeitet. Nach zweieinhalb Jahren bin ich nun vollwertiges Mitglied im Vertrieb und in der Redaktion" (Wagenfeld: Editorial, in:BODO 4/1997, S.3). Offensichtlich fühlte sich Wagenfeld als "Nur-Verkäufer" nicht vollwertig.
Das Ungleichgewicht zeigt sich auch darin, daß bei den alljährlichen Treffen der Straßenzeitungen immer nur relativ wenige "Betroffene" anwesend sind (vgl. hierzu Repp: Straßenmagazin-Treffen in Loccum , in: Hempels Straßenmagazin Dezember 1997, S.11).
[242] Dort werden alle ein bis zwei Jahre die RedakteurInnen ausgetauscht (mündliche Mitteilung).
[243] Vgl. S.12 dieser Arbeit.
[244] Vgl. Repp: Straßenmagazin-Treffen in Loccum , in: Hempels Straßenmagazin Dezember 1997, S.11.
[245] Vgl. Interview Ostendorf, S.4.
[246] Vgl. z.B. Justus: Laßt die Armen in der Stadt. fiftyfifty-Verkäufer gegen Vertreibung, in: fiftyfifty, September 1997, S.4f. Von Vertreibungen erzählte auch ein Kölner Von unge-Verkäufer. Auf der anderen Seite wurde jedoch auch, z.B. von den Solinger Die Straße-Verkäufern, von einem sehr kollegialen Umgang mit den angrenzenden Geschäften berichtet.
[247] Eppler: Kavalleriepferde beim Hornsignal. Die Krise der Politik im Spiegel der Sprache, Frankfurt am Main 1992, S.30.
[248] Vgl. Rosenke: Tagungsbericht: Erste Tagung der bundesdeutschen Straßenzeitungen, in: wohnungslos 4/1995, S.166f.
[249] N.N.: Gemeinsam gegen Armut. Drittes Arbeitstreffen bundesdeutscher Straßenzeitungen stand unter starkem Zeichen der Zusammenarbeit, in: Wohnungsloser, Ausgabe 9 (1997/1998), S.15.
[250] Höpfner: Von Loccum nach Berlin, in: Asphalt, Dezember 1997, S.22.
[251] Vgl. el: Straßenzeitung Trottwar für dieses Jahr gesichert, in: Evangelisches Gemeindeblatt für Württemberg, 22.2.1998, S.18.
[252] In welcher Kooperationsvariante auch immer (vgl. S.25f dieser Arbeit).
[253] Vgl. Repp: Hafenspitze - das 1.Hempel's-Kind!, in: Hempels Straßenmagazin Dezember 1997, S.7.
[254] Mein Gesprächspartner im Vertrieb: "Die erste Seite schreibt dort der Pastor ..., da sagt sicher auch jemand von der Kirche, wenn was nicht paßt."
[255] Vgl. S.26 dieser Arbeit.
[256] Es bliebe zu untersuchen, wie sich eine solche Konkurrenzsituation auf interessierte Käuferinnen und Käufer auswirkt.
[257] Siehe S.55f dieser Arbeit.
[258] In Hannover und Düsseldorf mit je etwas über 500 000 EinwohnerInnen z.B. werden bis zu 50 000 Stück im Monat verkauft.
[259] Mir gegenüber geäußerte Einschätzung eines Trott-war-Mitglieds. Die Einschätzung von Broder: Hilfe von Obdachlosen. Große Spendenaktion im Süden der Republik, in: Tagesspiegel, 1.12.1997, S.3 führt sicherlich zu weit. Broder schreibt u.a.: "Die Obdachlosenzeitungen, die es inzwischen in der ganzen Republik gibt, sind so überflüssig wie das Wort zum Sonntag als Mittel der Seelsorge. Niemand liest sie, gekauft werden sie nur, weil das schlechte Gewissen der Käufer für ein Ablaßangebot dankbar ist."
[260] Dies ist ein Ergebnis der Diplomarbeit von Andrea Müller über Hinz & Kunzt in Hamburg (vgl. Braun: Hinz & Kunzt - Obdachlosenhilfe zwischen Sinnstiftung und Vermarktung, in: wohnungslos 1/95, S.32-34, S.33).
[261] So Schumacher; Winkelhorst: Alternativer Medienmarkt der Straßenzeitungen, in: Soziale Arbeit 2/97, S.54-61, S.57.
[262] Mitteilung auf der Mitgliederversammlung von Trott-war am 23. April 1998. Dieser große Erfolg einer einzigen Anzeige zeigt auch, daß Straßenzeitungen nicht wie Broder meint, gekauft und weggeworfen (vgl. Anm. 261), sondern von vielen KäuferInnen gelesen werden.
[263] Vgl. Braun: Hinz & Kunzt - Obdachlosenhilfe zwischen Sinnstiftung und Vermarktung, in: wohnungslos 1/95, S.32-34, S.32.
[264] Vgl. Denninger: BISS e.V. und Zeitschrift BISS, München 1997, S.2: "Immerhin 11% [der VerkäuferInnen] leben allein vom Verkauf von BISS."
[265] Vgl. z.B. Fragen & Antworten zu Hinz & Kunzt, S.1: "Wieviele Leute arbeiten bei Hinz & Kunzt? Ungefähr 20, davon sechs ehemalige Obdachlose, zum Teil festangestellt, zum Teil auf Honorarbasis." Auch in dem Leporello "Das Hamburger Straßenmagazin. >Hilfe zur Selbsthilfe für Hamburgs Obdachlose<" werden unter der Leitfrage "Wer ist Hinz & Kunzt" die beiden Ebenen "wohnungslose Verkäufer" und "und ein professionelles Team" unterschieden. Der Terminus "Mitarbeiter" wird lediglich im Teil "und ein professionelles Team" verwendet. Vgl. auch Pressemappe Trott-war, Stuttgart o.J., S.6: "Mit Spendengeldern sollen weitere Mitarbeiter und Verkäufer eingestellt ...werden."
[266] Vgl. Interview Ostendorf, S.1: "Fiftyfifty ist Magazin, das Obdachlosen hilft, sich selbst zu helfen. Vom Verkaufspreis (DM 2,20) dürfen die VerkäuferInnen die Hälfte behalten".
[267] Vgl. Hinz & Kunzt: Infobrief für den Freundeskreis 2/1996, S.1: "Kein anderer Hinz & Künztler darf in diesem Gebiet wildern. Wer sich nicht daran hält, kann seinen Ausweis bis zu zwei Monate lang verlieren. ... Wer zum Beispiel betrunken ist oder beim Zeitungsverkauf Drogen nimmt, riskiert seinen Hinz & Kunzt-Ausweis. In solchen Fällen greifen die vier Vertriebsmitarbeiter hart durch. Das gilt auch, wenn sie Hinz & Künztler beim Betteln mit dem H&K-Ausweis erwischen." (Hervorhebungen von mir).
[268] Diesen Eindruck hatte ich auf der Trott-war-Mitgliederversammlung am 23.4.1998 in Stuttgart.
[269] Vgl. Rosenke: Bürgerschaftliches Engagement in der sozialen Arbeit. Konkurrenz oder Kooperation, in: wohnungslos 3/1997, S.93-97, S.96f.
[270] Rosenke, a.a.O., S.96.
[271] Zu klein darf die Auflage jedoch nicht werden, sonst werden die Fix- und Druckkosten anteilsmäßig zu hoch (vgl. Signal-Anker, Marl und Bank Extra, Köln).
[272] Mit dem Begriff "MitarbeiterInnen" meine ich auch sämtliche Personen, die "nur" im Verkauf tätig sind.
[273] Vgl. Zglinicki: Redaktionskonferenz beim "Strassenfeger". Nicht auf Mitleid hoffen, sondern Unterstützung fordern, in: Freitag 1/1998, abgedruckt in: Looser/Strassenfeger, März/April 1998, S.23-25, S.25.
[274] Vgl. Lange: Einführung, in: Freire: Pädagogik der Unterdrückten, 3.Aufl. Stuttgart 1973 (1.Aufl. 1970), S.7-28, S.9.
[275] Lange, a.a.O., S.13.
[276] Freire: Pädagogik der Unterdrückten, 3.Aufl. Stuttgart 1973 (1.Aufl. 1970), S.45.
[277] Vgl. Lutz: Zur Pädagogik der Wohnungslosen, in: neue praxis 3/96, S.217-228, S.218, dessen Anliegen es ist, Freires Ansatz für die Arbeit mit Wohnungslosen fruchtbar zu machen.
[278] Vgl. z.B. die Situation in Ludwigshafen, wo ein, manchmal zwei Verkäufer einen Absatzmarkt von rund 160 000 EinwohnerInnen haben.
[279] Selbst der Strassenfeger hat trotz einer (bisher) vierzehntägig erscheinenden Auflage von 30000 und auch angesichts der Konkurrenz durch motz & Co im Verhältnis zu der Einwohnerzahl von Berlin eine vergleichsweise bescheidene Auflage.
[280] Sidler: Am Rande leben, abweichen, arm sein. Konzepte und Theorien zu sozialen Problemen, Freiburg 1989, S.154.
[281] Vgl. dazu a.a.O. S.145-169.
[282] Allerdings hat auch der Straßenkreuzer, Nürnberg bereits 270 Verkaufsausweise ausgegeben (Straßenkreuzer: Der STRAßENKREUZER e.V. stellt sich vor, Nürnberg o.J.).
[283] Zur Bedeutung der durch den Straßenzeitungsverkauf entstehenden Kontakte bei nach dem Profi-Konzept arbeitenden Projekten siehe die Konzeptionen von Hinz & Kunzt, Hamburg, fiftyfifty, Düsseldorf und BISS, München (Punkt 2.2.1. dieser Arbeit, S.9f).
[284] Vgl. dazu Rosenke: Straßenzeitungen. Dauerbrenner oder Strohfeuer?, in: Gefährdetenhilfe 2/1994, S.73-77, S.77.
[285] Vgl. Straßenkreuzer: Der STRAßENKREUZER e.V. stellt sich vor, Nürnberg o.J.
[286] Eine Ausnahme ist hier Platte, Bingen.
[287] Vgl. S.45 dieser Arbeit.
[288] Rosenke: Bürgerschaftliches Engagement in der sozialen Arbeit. Konkurrenz oder Kooperation, in: wohnungslos 3/1997, S.93-97, S.97.
[289] Vgl. S.3 Anm.3 dieser Arbeit.
[290] Thomas Kater von Abseits, Osnabrück: "Für viele ehemalige Wohnungslose, die bei unserer Zeitung mitmachen, ist dies eine Möglichkeit, ihr Selbstvertrauen zu stärken. ... Vielen bietet die Mitarbeit auch die Möglichkeit, sich nach langer Zeit wieder an eine feste, geregelte Tagesstruktur zu gewöhnen. Eine sehr wichtige Sache, wie wir finden."
[291] Vgl. Rosenke: Bürgerschaftliches Engagement in der sozialen Arbeit. Konkurrenz oder Kooperation, in: wohnungslos 3/1997, S.93-97, S.96f.
[292] Der Begriff "Klient" kommt aus dem Lateinischen und heißt "der Hörige" (vgl. Mathies: Die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements für Wohnungslose, in: wohnungslos 3/1997, S.98f, S.98).
[293] Selbstverantwortlichkeit in diesem Sinne darf jedoch nicht mit der neoliberalen Forderung nach Eigenverantwortung verwechselt werden, die unmittelbar zu einer Entsolidarisierung mit denjenigen führt, die diese Eigenverantwortung nicht (mehr) aufzubringen vermögen.
[294] Bezogen auf die Einwohnerzahl werden inzwischen in Kiel fast soviele Zeitungen abgesetzt wie z.B. in Düsseldorf.
[295]Vgl. hierzu die Aussage eines seit acht Jahren in Kiel auf Platte lebenden Obdachlosen über Hempels Straßenmagazin: "Das sind für mich Idioten. Die waren obdachlos, haben das ganze mal ein paar Jahre mitgemacht, schreiben jetzt über uns. ... Die machen aus ner Distel ne Rose."
[296] Gäbe es die Zielvorgabe, Sprungbrett zu sein, nicht, wäre die Zahl von sieben (Trott-war) bzw. 60 (Hinz & Kunzt) Personen, die die Straßenzeitung als Durchgang in den ersten Arbeitsmarkt genutzt haben, ein respektables Ergebnis.
[300] Auch wenn Straßenzeitungen nicht nur von Wohnungslosen verkauft werden, werden die allermeisten Projekte von der Bevölkerung meiner Beobachtung nach als "Obdachlosenzeitungen" wahrgenommen.
[301] Interview Ostendorf, S.1.
[302] Die gleiche Beobachtung machte der Arbeitskreis Wohnraumversorgung aus Hamburg aufgrund des Erfolges von Hinz & Kunzt: "Der Obdachlose war für viele Bürger Hamburgs seitdem nicht mehr der >Penner< an der Straßenecke, sondern der freundliche >Hinz & Kunzt<-Verkäufer in der Einkaufszone" (Arbeitskreis Wohnraumversorgung: Diskussionsgrundlage zur Almosenverteilung in Hamburg, in: wohnungslos 1/1996, S.21-24, S.21). Im Gegensatz zu Ostendorf sieht der Arbeitskreis Wohnraumversorgung diese Entwicklung jedoch kritisch.
[303] Hinz & Kunzt, Hamburg hat etwa 1600, Stuttgart hatte im Januar 1998 348 "derzeit registrierte" Trott-war-VerkäuferInnen, fiftyfifty spricht von 500 ausgestellten Verkäuferausweisen. Asphalt, Hannover hat über 1100 Ausweise ausgegeben. Diese vier Zeitungen erstellen zusammen knapp die Hälfte der monatlich über 500 000 Exemplare (vgl. Hinz & Kunzt, Infobrief für den Freundeskreis Nr.1/1996; Möhnle: Wieder zurück auf die Straße? Obdachlosenzeitung "Trott-war" vor dem Aus, in: Sonntag Aktuell 18.1.1998, S.5 und Interview Ostendorf S.3).
[304] Laut einer Mainzer Studie zum Gesundheitsverhalten von Wohnungslosen sind 17,5% von ihnen chronische Alkoholiker (vgl. Grohall: Zwischen den Stühlen! Über die Inkompatibilität von Hilfe- und Lebenssystem, in: wohnungslos 3/1996, S.98-103, S.102, Anm.9).
[305] Vgl. dazu Pott: Freude, in: Hempels Straßenmagazin, Nr.20, Dezember 1997, S.7: "...Wie wird sich in Zukunft die Beziehung von >festen< Mitarbeitern und VerkäuferInnen gestalten? Spannungen sind da vorprogrammiert. ... Außerdem gibt es noch eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die, wie die meisten Mitarbeiter der Hempel's-Crew im Elend leb(t)en. Wir müssen das bleiben, was wir am Anfang waren: Sprachrohr der Sprachlosen."
[306] Waldherr: Selbsthilfe der Armen. Hilfe für den Einzelnen oder gesellschaftliche Strategie?, in: Looser 8/1997, S.16.
[307] Vgl. Teil 1, S.2-6 dieser Arbeit.
Martin Staiger
Straßenzeitungen unter den Bedingungen der Marktwirtschaft
Anspruch und Wirklichkeit von Arbeitslosenprojekten
Diplomarbeit an der EFH in Ludwigshafen im Fachbereich Sozialarbeit, Ludwigshafen 1998
Erstkorrektor: Herr Hanspeter Damian
Zweitkorrektor: Herr Hans-Ulrich Dallmann
- 0. Einführung
- 1. Strukturelle Armutsursachen in der Bundesrepublik Deutschland
- 2. Straßenzeitungen in der Bundesrepublik Deutschland
- 3. Die Verkäuferinnen und Verkäufer
- 4. Probleme von Straßenzeitungen und ihre Auswirkungen
- 5. Straßenzeitungen in der Bundesrepublik Deutschland - Chancen und Grenzen
- 6. Fazit
- 7. Literaturverzeichnis
- 8. Adressen
- Fußnoten
- Vollständiges Inhaltsverzeichnis
0. Einführung
Von wohnungs- und arbeitslosen Menschen auf der Straße verkaufte Zeitungen gehören seit einigen Jahren zum Stadtbild in vielen bundesdeutschen Städten. Insgesamt etwa 40 solcher Straßenzeitungsprojekte sind in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Die vorliegende Arbeit versucht einen Überblick über die verschiedenen zur Zeit bestehenden Projekte zu geben und zu ergründen, wo ihre Chancen und Grenzen liegen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage, was sich die (ex)- wohnungs- und arbeitslosen MitarbeiterInnen von den Projekten erwarten.
Im ersten Teil wird dargestellt, wie sich die Erwerbsarbeit als das bestimmende Leitbild der bundesdeutschen Gesellschaft auf die aus dem Arbeitsmarkt Ausgegrenzten auswirkt. Der zweite Teil zeigt auf, mit welchen Konzeptionen Straßenzeitungen diesen Auswirkungen begegnen. Der dritte Teil befaßt sich mit den wohnungs- und arbeitslosen MitarbeiterInnen, die meistens als VerkäuferInnen tätig sind. Auf der Grundlage von 17 Gesprächen gehe ich der Frage nach, aus welchen Gründen es für sie interessant ist, bei Straßenzeitungen mitzuarbeiten.
Der Boom der Straßenzeitungen ist inzwischen vorbei, die Phase der Konsolidierung ist eingeleitet. Der vierteTeil fragt deshalb danach, welche Schwierigkeiten sich für die verschiedenen Projekte aus dieser Tatsache ergeben. Im fünftenTeil werden die in Teil 2 behandelten Konzeptionen mit der in Teil 3 und Teil 4 behandelten Realität verglichen, um Chancen und Grenzen der verschiedenen Konzeptionen auszuloten. Im sechsten und letzten Teil ziehe ich ein Fazit meiner Überlegungen.
Von den zur Zeit etwa 40 in der Bundesrepublik Deutschland vorhandenen Projekte kann ich etwa die Hälfte überblicken. Außer über das aus Berlin stammende Blatt Strassenfeger habe ich so gut wie keine Informationen über die in der Ex-DDR erscheinenden Straßenzeitungen. An der ehemaligen innerdeutschen Demarkationslinie findet die Arbeit somit ihre Grenze.
1. Strukturelle Armutsursachen in der Bundesrepublik Deutschland
Das zentrale Element gesellschaftlicher Organisation der bundesdeutschen Gesellschaft ist die Erwerbsarbeit. Die ökonomische Ausstattung des einzelnen und eventuell mitzuversorgender Familienangehöriger[1] ergibt sich fast ausschließlich aus dem durch Erwerbsarbeit erzielten Verdienst. Die Höhe von Lohnersatzleistungen wie Krankengeld, Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe hängen linear mit dem zuletzt erzielten Erwerbseinkommen aus abhängiger Beschäftigung zusammen (§47 SGB V, §§111;136 AFG). Die Länge des Bezuges von Arbeitslosengeld ist von der Dauer der arbeitslosenversicherten Beschäftigung abhängig (§106 AFG). Die Rente bemißt sich nach einer Kombination aus Länge der abhängigen Beschäftigung und Höhe des erzielten Arbeitsverdienstes (§ 64 SGB VI). Lediglich die Höhe der Sozialhilfe hängt nicht mit erbrachten Vorleistungen in Form von Erwerbsarbeit zusammen.
Erwerbslosigkeit führt unmittelbar zu ökonomischer Minderausstattung. Die Höhe des Arbeitslosengeldes beträgt für Arbeitslose mit mindestens einem Kind 67%, für Kinderlose 60% des im Bemessungszeitraum erzielten Durchschnittsverdienstes (§§ 111 Abs.1, §112 Abs.1 AFG). Die Höhe der Arbeitslosenhilfe, die nach Ablauf des Arbeitslosengeldanspruches (§ 106 Abs.1 AFG) einsetzt, liegt bei 57% für Arbeitslose mit und bei 53% für Arbeitslose ohne Kinder (§ 136 AFG). Legt man "die Armutsdefinition der EU-Kommission, die auch in der Wissenschaft vielfach gebraucht wird, wonach die Armutsgrenze bei fünfzig Prozent des durchschnittlich verfügbaren (gewichteten) Einkommens innerhalb eines Staates festgelegt ist"[2], als Maßstab zugrunde, so befindet sich ein Arbeitslosenhilfebezieher, der durchschnittlich verdient hat, bereits nahe an der Armutsschwelle. Da in der Regel schlecht bezahlte Arbeitsstellen gestrichen werden, dürfte eine große Zahl der betroffenen Arbeitslosen nach dieser Definition als arm gelten.
Eine weitere Folge von Erwerbslosigkeit ist gesellschaftliche Ächtung.[3] Die Ansicht, ein Arbeitsloser sei selber schuld, ist nach wie vor in allen Schichten weit verbreitet. Worte wie "soziale Hängematte" oder "Wohlstandsmüll", womit der Präsident des Verwaltungsrates der Nestlè Aktiengesellschaft, Helmut Maucher, kranke, arbeitsunfähige und arbeitsunwillige Menschen bezeichnete, werden zwar eher in Arbeitgeberkreisen gebraucht[4], Sprüche der ganz normalen Bevölkerung wie "du lebst von meinen Steuern" oder "wer arbeiten will, der findet auch was" zeugen jedoch von einer im Grundsatz gleichen Einstellung.
Unabhängig von der moralischen Bewertung arbeitsloser Menschen, die natürlich auch deren Selbstbewertung beeinflußt, ist Arbeit eine zentrale anthropologische Kategorie. In der Arbeit verhält sich der Mensch zur Welt, er gestaltet sie nach seinen Vorstellungen mithilfe seiner Kraft und seiner Phantasie.[5] Zu arbeiten ist also ein anzustrebendes menschliches Ziel. Fatalerweise wird Arbeit nach wie vor mit Erwerbsarbeit, der Wert der Arbeit mit dem erhaltenen Lohn oder Gehalt gleichgesetzt.
Auf diesem Hintergrund ist es verständlich, daß eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ein, wenn möglich erwerbslebenslanges, Vollzeitarbeitsverhältnis anstrebt, um ökonomisch, gesellschaftlich und sozial am Leben der Gesellschaft teilnehmen zu können. Dies gilt auch für Menschen, die selbst kürzer oder länger arbeitslos (gewesen) sind.[6]
Die Zahl der Erwerbsarbeitsplätze geht jedoch seit Jahren zurück. 1991 waren 36,6 Millionen, 1997 noch 34,0 Millionen Menschen erwerbstätig[7]. Die Arbeitslosigkeit steigt seit Jahren an. Für 1998 rechnet das der Bundesanstalt für Arbeit angegliederte Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung mit einer weiteren Erhöhung der Arbeitslosigkeit auf jahresdurchschnittlich 4,46 Millionen Erwerbslose.[8] Der Anteil unbefristeter Vollzeitarbeitsverhältnisse an allen Arbeitsverhältnissen sank von 1970 bis 1995 von 85% auf 68%.[9] Sechs Millionen aller Arbeitsplätze sind inzwischen "geringfügige", sozialversicherungsfreie Beschäftigungsverhältnisse.[10] Tendenz steigend.[11]
Da sich selbst ein wirtschaftliches Wachstum von über 2 Prozent nicht förderlich auf den Arbeitsmarkt auswirkt[12] und sich das Erwerbspersonenpotential, das sind "alle Personen ..., die bei guter Arbeitsmarktlage ihre Arbeitskraft anbieten"[13], trotz einer momentanen Entspannung[14] bis etwa 2010 erhöhen wird[15], wird der Druck auf den Arbeitsmarkt noch weiter steigen.
Aus diesen Gründen ist eine wachsende Zahl von Menschen in der Bundesrepublik Deutschland nicht in der Lage, sich durch eigene Erwerbsarbeit, durch Erwerbsarbeit von Angehörigen oder durch Lohnersatzleistungen zu ernähren. Diese Personen erhalten auf Antrag Sozialhilfe. 1996 waren das 2 730 000 Menschen, das sind 20 Prozent mehr als Anfang der 90er Jahre.[16] Die Sozialhilfe soll "dem Empfänger der Hilfe die Führung eines Lebens ... ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht" (§1 BSHG). Obwohl der Regelsatz die EmpfängerInnen gemessen an der Armutsdefinition der EU-Kommission verarmen läßt und das sozio-kulturelle Existenzminimum nicht sichert, was mit Stigmatisierungen oder verschämtem Rückzug der Betroffenen einhergeht[17], kommt es häufig auch noch zu Sozialhilfekürzungen. Dies ist z.B. der Fall, wenn ein Leistungsempfänger nicht genügend Nachweise über Arbeitsbemühungen erbringen kann.[18] Da inzwischen in der Interpretation des § 22 Abs. 3 BSHG das Prinzip "Lohnabstandsgebot" gegenüber dem Prinzip "Warenkorb" als Leitbild für die Höhe der Sozialhilfe weitgehend durchgesetzt wurde[19], kann damit gerechnet werden, daß das in §1 BSHG formulierte Ziel in Zukunft immer weniger erreicht werden wird. Nach Schätzungen des Diakonischen Werks gibt es in der Bundesrepublik Deutschland zusätzlich zu den 2,7 Millionen Sozialhilfeempfängern noch etwa zwei Millionen "verdeckte Arme", die ihren gesetzlich garantierten Sozialhilfeanspruch - aus welchen Gründen auch immer - nicht geltend machen.[20]
Die Entwicklung der Mietpreise stellt ein weiteres Risiko zu verarmen dar. Seit 1992 stiegen die Mieten in den alten Bundesländern bei einer allgemeinen Teuerungsrate von 11,5% um 21,5%, im Osten um 105,6%. Die Nebenkosten erhöhten sich im gleichen Zeitraum sogar wesentlich schneller.[21] Das Wohngeld für Sozialhilfebezieher wurde zum 1.1.1997 von bisher pauschal 50% der Miete auf 47% gesenkt.[22] Der soziale Wohnungsbau wird weiter zurückgefahren, Privatisierungen von Wohnungen aus dem Besitz der öffentlichen Hand sind im Gespräch.[23]
Die Wahrscheinlichkeit, wegen Zahlungsunfähigkeit oder Verschuldung wohnungslos zu werden wird damit höher. Die schon heute geringen Chancen unterprivilegierter Gruppen, die bereits wohnungslos sind oder aufgrund einer Kündigung von Wohnungslosigkeit bedroht sind, eine bezahlbare Wohnung zu erhalten, werden weiter sinken.
1996 waren nach einer Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 930.000 Menschen wohnungslos.[24] Davon stammen 397.000 Personen aus Mehrpersonenhaushalten, die in der Regel in Notquartieren untergebracht werden, 336.000 sind wohnungslose AussiedlerInnen in Aussiedlerunterkünften. Die restlichen 197.000 sind wohnungslose Einpersonenhaushalte. Dieser Personenkreis wird "nach wie vor zum großen Teil auf die Übernachtungsasyle oder sozialen Einrichtungen verwiesen, sich selbst überlassen oder gar abgeschoben." 35.000 Menschen leben ohne jede Unterkunft auf der Straße. Diese werden als "obdachlos" bezeichnet.
Es gibt also viele Gründe, warum immer mehr Menschen in der reichen Bundesrepublik arm sind, arm werden und arm bleiben. Die wichtigsten sind der angespannte Arbeitsmarkt, das einseitig von geleisteter Erwerbsarbeit abhängige Sozialversicherungssystem, stark steigende Mieten und ein grassierendes Bewußtsein, daß Arbeitslosigkeit und daraus folgende Verarmung individuelle Gründe hat und daß die davon Betroffenen gefälligst "mehr Eigenverantwortung"[25] zu übernehmen haben.
2. Straßenzeitungen in der Bundesrepublik Deutschland
2.1. Begriffsklärung
Der Begriff "Straßenzeitung" gilt als Oberbegriff für von (ehemaligen) Wohnungs- und von Arbeitslosen auf der Straße verkaufte oder verteilte Zeitungen, an deren Herstellung sie zum Teil mit beteiligt sind. Der in der Tagespresse[26] und bei Bürgerinnen und Bürgern geläufigere, von manchen Straßenzeitungen[27] und zum Teil auch von Verkäuferinnen und Verkäufern selbst verwendete Terminus "Obdachlosenzeitung"[28] trifft nicht die Wirklichkeit aller Projekte. In Hannover (Asphalt) sprach ich mit drei, in Hamburg (Hinz & Kunzt) mit einem Verkäufer, die niemals obdachlos waren. Auch BODO (Bochum; Dortmund) hat VerkäuferInnen, die noch nie auf der Straße lebten.[29]
Die Kölner Straßenzeitung Von unge bezeichnet sich dezidiert als "Mitmachzeitung".[30] Ein Kölner Von unge -Verkäufer, der selbst die Zeitung mit herausgibt: "Wir sind eine kollektive Selbsthilfe; wir sind kein Obdachlosenblatt." Der Ausdruck "Obdachlosenzeitung" hat dennoch eine gewisse Berechtigung, da die Zielgruppe der allermeisten Straßenzeitungen ursprünglich wohnungs- und obdachlose Menschen waren, sei es, daß diese selbst die Zeitung herausgaben, sei es, daß sie gemeinsam mit seßhaften Menschen eine Zeitung machten oder daß seßhafte Menschen eine Zeitung erstellten, die dann von Wohnungslosen verkauft wurde. Außerdem beschäftigen sich die meisten Zeitungen schwerpunktmäßig mit Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Auch der überwiegende Teil der Verkaufenden ist oder war kurze oder längere Zeit wohnungs- bzw. obdachlos. In der Regel stammen diese aus dem Personenkreis der etwa 200 000 wohnungslosen Einpersonenhaushalte.[31]
2.2. Versuch einer Systematisierung
Die in der Bundesrepublik Deutschland bestehenden Straßenzeitungen sind sehr unterschiedlich. Manche erscheinen sehr unregelmäßig, andere monatlich oder alle vierzehn Tage. Die einen haben eine Auflage von wenigen hundert oder tausend, während andere zigtausendfach produziert werden. Manche werden von professionellen JournalistInnen gestaltet, andere entstehen in Eigenverantwortung von (Ex)-Wohnungslosen, wieder andere sind aus Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe erwachsen. Außerdem gibt es von Ehrenamtlichen verantwortete Projekte und Mischformen, von denen mir die von (Ex)-Wohnungslosen und SozialarbeiterInnen gemeinsam erstellten Zeitungen besonders interessant erscheinen.
2.2.1. Von JournalistInnen verantwortete Projekte, oder: Das Profi-Konzept
Das im Moment auflagenstärkste und auch bekannteste Straßenzeitungsprojekt in der Bundesrepublik Deutschland ist die seit 1993 erscheinende Zeitung Hinz & Kunzt aus Hamburg. Konzeptionelles Vorbild von Hinz & Kunzt ist das englische Projekt The Big Issue.[32] The Big Issue wird wöchentlich mit einer Auflage von 100 000 Exemplaren von wohnungslosen Menschen in mehreren Städten Großbritanniens verkauft. 70% der Einnahmen werden durch den Verkauf erwirtschaftet, der Rest aus Werbung und Spenden, sowie von Sponsoren. Anspruch des Herausgebers ist es, VerkäuferInnen in einem Beruf des Zeitungsmetiers auszubilden, zumindest zu qualifizieren und Verantwortungsbewußtsein für das eigene Leben zu wecken, damit sie über kurz oder lang unabhängig von dem Zeitungsprojekt in Selbständigkeit leben können. The Big Issue hat eine "bunte Themenmischung mit leicht sozialem Touch" zum Inhalt. Der Herausgeber John Bird: "Keine moralisierende Botschaft! Almosen halten Menschen nur in Unselbständigkeit."[33]
Hinz & Kunzt mit einer Auflage von durchschnittlich 110 000 Exemplaren[34] war Vorbild für Asphalt, Hannover, Fiftyfifty, Düsseldorf, Trott-war, Stuttgart und BISS, München, die sich alle in einer Größenordnung von zwischen 30 000 und 55 000 monatlich[35] gedruckten Exemplaren[36] bewegen. Ferner gehören BODO (Bochum; Dortmund) mit einer monatlichen Auflage von durchschnittlich etwas über 20 000[37] und Die Straße aus Solingen mit 10 000 Exemplaren pro Monat zu dieser Gruppe.
Anhand einiger Selbstdarstellungen soll die deutsche Version des Big-Issue- Konzepts verdeutlicht werden:
Hinz & Kunzt, Hamburg: "Was will Hinz & Kunzt: obdachlose verdienen geld. Hilfe zur Selbsthilfe für Hamburgs Obdachlose ist der Grundsatz des Projekts. Durch den Zeitungsverkauf verdienen die Hinz & Künztler Geld. Das bedeutet eine materielle Verbesserung ihrer Lebenssituation und die Erfahrung, daß ihre Arbeitskraft noch einen Wert hat.
... gewinnen selbstvertrauen... Durch den Verkauf auf der Straße kommen die obdachlosen Hinz & Küntzler in Kontakt mit Menschen, die vorher auf sie herabgesehen oder sie überhaupt nicht wahrgenommen haben. Hier begegnen sich Menschen, die bisher zwar in derselben Stadt, aber in getrennten Welten lebten. Das ist ein wichtiger Schritt aus der sozialen Isolation und hilft, ein neues Selbstwertgefühl zu entwickeln. ... und können weitere Schritte machen ... Aus den positiven Erfahrungen kann mehr erwachsen. Viele Obdachlose, die sich selbst schon aufgegeben hatten, fassen durch Hinz & Kunzt wieder Mut und gehen ihre Probleme an: Das Projekt beschäftigt einen Sozialarbeiter, arbeitet mit Rechtsanwälten und Suchtberatern zusammen und vermittelt an andere soziale Einrichtungen der Stadt, beispielsweise an Schuldnerberatungsstellen."[38]
Fiftyfifty, Düsseldorf: "Fiftyfifty ist Magazin, das Obdachlosen hilft, sich selbst zu helfen. Vom Verkaufspreis (DM 2,20) dürfen die VerkäuferInnen die Hälfte behalten; der Name des Blattes ist also Programm. Gleichzeitig ist fiftyfifty ein Sprachrohr für Wohnungslose. Viele Artikel und Fotos stammen von Menschen auf der Straße. Das macht fiftyfifty authentisch. Nicht zuletzt vermittelt fiftyfifty Kommunikation zwischen Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten und trägt somit dazu bei, daß die Armut offensichtlich und nicht mehr versteckt wird."[39]
BISS, München: "Zweck des Vereins / Ziele von BISS: Die Zeitschrift BISS, die der Verein herausgibt, soll Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Beim Verkauf des Blattes, der ausschließlich auf der Straße und durch die Betroffenen selbst erfolgt, wird sowohl die Möglichkeit zu sozialen Kontakten geboten als auch die Chance, einer regelmäßigen Tätigkeit nachzugehen und dabei eigenes Geld zu verdienen. Kontakte zu »normalen Bürgern« waren den Betroffenen vorher oftmals überhaupt nicht möglich.
Durch eine kontinuierliche Betreuung soll das Selbstwertgefühl vieler Verkäufer wieder gestärkt werden, ihnen somit ein schrittweiser Austritt aus ihrer Isolation, Armut und Ausgrenzung ermöglicht werden.
Einrichtung von festen Arbeitsplätzen für ehemalige Wohnungs- und Obdachlose.
1996 hat BISS mit unentgeltlichen Fortbildungsangeboten (Schreibwerkstätten, EDV-Kurse, etc.) für Bürger in sozialen Schwierigkeiten begonnen. Die Kurse finden regen Anklang.
Durch Öffentlichkeitsarbeit wie Diskussionsrunden, Hearings, Podiumsgespräche und Vorträge in Schulen möchte der Verein die Öffentlichkeit aufklären und für Menschen in sozialen Notlagen sensibilisieren."[40]
Trott-war, Stuttgart: " Ziel von Trott-war ist es, Wohnungs- und Langzeitarbeitslosen zu helfen. Viele Wohnungs- und Langzeitarbeitslose haben ihre Selbstachtung verloren, fühlen sich häufig nicht mehr gebraucht und ertränken nicht selten ihre Verzweiflung im Alkohol. Die Straßenzeitung Trott-war gibt ihnen Arbeit als Verkäufer/innen: Pro verkaufter Zeitung verdient der/die Verkäufer/in eine Mark. Nach meist langer Zeit wieder durch Arbeit Geld zu verdienen, motiviert die Betroffenen, macht sie unabhängig und selbständig und verhilft ihnen zu neuem Selbstvertrauen.
Außerdem unterstützt Trott-war die Verkäufer bei der Schuldenregulierung, bei der Suche nach einer Wohnung, beim Kampf gegen Alkohol- und Drogensucht, bei Gerichtsprozessen, bei der Wohnungseinrichtung und anderen Anforderungen des Alltags."[41]
Die Konzeptionen der nach dem Profi-Konzept arbeitenden Projekte lassen sich -mit geringen Abweichungen- etwa folgendermaßen zusammenfassen:
1. Der Verkauf steht im Mittelpunkt der "Hilfe zur Selbsthilfe".
2. Durch den Zeitungsverkauf verdienen Wohnungs- und Arbeitslose Geld, werden unabhängig und kommen in Kontakt zur "normalen" Bevölkerung.
3. Das Selbstvertrauen der Verkaufenden wächst ebenso wie das Verständnis der Bevölkerung.
4. Aufgrund ihres neu erwachten Selbstvertrauens können die Verkaufenden - unterstützt durch Fachkräfte - ihre Probleme angehen und ihre Ausgrenzung schrittweise aktiv beenden.
Um über die Herstellung eines guten Produktes eine stabile Auflage und damit eine verläßliche Einnahmequelle für die VerkäuferInnen[42] zu garantieren, wird mit professionellem Personal gearbeitet.[43] Ein oder mehrere fest angestellte JournalistInnen sind redaktionell verantwortlich und schreiben einen Großteil der Texte. Das Layout machen - i.d.R. freie - LayouterInnen. Im Vertrieb, der zum Teil völlig von der Redaktion losgelöst ist, arbeiten meist ein oder mehrere - in Hamburg z.B. sind es fünf[44] - "Betroffene"[45]. Für Sozialdienstaufgaben ist bei manchen Projekten wie bei Hinz & Kunzt oder trott-war ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin zuständig.[46] Die allermeisten Wohnungs- und Arbeitslosen betätigen sich ausschließlich im Verkauf.
Die journalistische Mitarbeit von "Betroffenen" ist konzeptionell ausdrücklich vorgesehen. Fiftyfifty, Düsseldorf: "Fiftyfifty wird von den Wohnungslosen als ihre Zeitung angesehen. Dies nicht zu unrecht. Schließlich schreiben sie viele Artikel, ein Tagebuch, Reportagen, machen Fotos ... Da wir marktübliche Honorare dafür zahlen (Obdachlose und Profis kriegen natürlich gleich viel), ist der Anreiz zur Mitarbeit besonders groß ... Profis und Betroffene arbeiten Hand und Hand. Wer von den Obdachlosen mitarbeiten will, kann dies in jedem Fall tun. Wir unterstützen bei der Recherche und redigieren die Texte in Absprache."[47] In BODO, Bochum; Dortmund erscheint auf der ersten Textseite regelmäßig ein Tagebuch eines BODO-Verkäufers.[48]
Bei Trott-war, Hinz & Kunzt und BISS gibt es in jeder Ausgabe eine Rubrik von ein bis drei Seiten, in der "Betroffene" zu Wort kommen. Bei Trott-war ist diese überschrieben mit "»Spitze Feder«, die unseren Verkäufern Raum gibt, sich journalistisch zu äußern."[49] Bei BISS heißt die entsprechende Rubrik "Klartext", bei Hinz & Kunzt "Forum".[50]
Inhaltlich haben einige Projekte das "Big-Issue-Konzept" etwas modifiziert. In den meisten Zeitungen ist zwar auch eine bunte Mischung anzutreffen, sie haben jedoch z.T. mehr als einen "leichten" sozialen Touch. Hinz & Kunzt, Hamburg und Asphalt, Hannover kommen The Big Issue am nächsten. Dort werden meinem Eindruck nach - im Vergleich zu den anderen nach dem Profi-Konzept arbeitenden Straßenzeitungen - wenig soziale und sozialpolitische Themen behandelt werden.[51] Hinz & Kunzt: "Unser Ziel ist es, soziale und bunte Themen Monat für Monat spannend zu mischen, aus einem Blickwinkel, den andere Zeitungen nicht haben."[52] Trott-war, Stuttgart, fiftyfifty, Düsseldorf, BODO, Bochum; Dortmund) und Die Straße, Solingen legen den Schwerpunkt mehr auf "soziale" Themen, klären eher über das Leben ganz unten auf und leisten mehr Lobbyarbeit. Trott-war: "Typische Trott-war Themen sind Obdachlosigkeit, Armut, Kriminalität, Prostitution, Sozialhilfe, soziale Einrichtungen und Institutionen".[53] Fiftyfifty, Düsseldorf schreibt "natürlich über Armut, Obdachlosigkeit und soziale Themen. Wir bringen aber auch viel Kultur und stellen interessante Initiativen vor."[54] Bei BODO, Bochum; Dortmund gibt es die regelmäßige Rubrik "Sozialreport". Themen sind z.B. Spielsucht, Bewährungshilfe oder Notunterkünfte.[55]
Kulturtips, "subjektiv und einladend statt vollständig und nichtssagend"[56] spielen in fast allen Projekten eine Rolle. Etwa 10 Prozent einer Ausgabe bestehen aus Tips für kulturelle Veranstaltungen in der Region.[57] Als meines Wissens einzige nach dem Profi-Konzept arbeitende Straßenzeitung veröffentlicht BODO regelmäßig ein nach Rubriken wie Arbeitslosenberatung, Frauen oder Selbsthilfe geordnetes Adressenverzeichnis.
BISS, München hat ein eigenes inhaltliches Konzept. In jeder Ausgabe wird schwerpunktmäßig über ein Thema berichtet. In der Nummer Juli/August 1997 ging es z.B. um Prostitution, in der Septemberausgabe um Adoption, die Oktobernummer thematisierte die Pflegeversicherung. Kulturtips sucht man vergebens. Auch die Artikel von "Bürgern in sozialen Schwierigkeiten", die sich in den Rubriken "Klartext" und Schreibwerkstatt äußern[58], sind auf das Gesamtthema des Heftes zugeschnitten.
Die Finanzierung der Projekte erfolgt im Wesentlichen durch fünf, von Projekt zu Projekt unterschiedlich wichtige, Einnahmeposten:
1. Straßenverkauf: Die Kosten der Projekte lassen sich über den Straßenverkauf der Zeitungen, bei dem der Verkäufer bzw. die Verkäuferin rund die Hälfte des Verkaufspreises erhält, nur zum Teil einspielen. Die beste Bilanz weist hier Hinz & Kunzt aus. Die Hamburger erwirtschaften etwa 73,3% des Finanzbedarfs durch den Verkauf.[59] Bei Trott-war, Stuttgart deckt der Verkauf meiner Rechnung nach 57,6%, bei BISS, München 35,4% der Ausgaben.[60] Der relativ gute Deckungsgrad von Hinz & Kunzt dürfte mit der vergleichsweise hohen Auflage zusammenhängen, wodurch sich mehr verdienen läßt und die Herstellungskosten pro Exemplar geringer werden.[61]
2. Anzeigen: Alle größeren Straßenzeitungen enthalten - in der Mehrzahl kleinformatige - Anzeigen. Anzeigenkunden sind hauptsächlich in der Stadt und der Region ansässige Firmen, soziale Organisationen und Kulturbetriebe.[62] Laut fiftyfifty, Düsseldorf "läuft der Anzeigenverkauf nicht gut. »Unsere Kunden sind nicht obdachlos«, heißt es immer wieder. Daß die meisten LeserInnen von fiftyfifty (bei einer Auflage von über 40 000) jedoch auch nicht obdachlos sind, ist schwer vermittelbar."[63] Hinz & Kunzt, Hamburg, das etwas mehr Werbung als fiftyfifty, und etwa gleichviel wie Trott-war, Stuttgart, enthält, nimmt pro Monat rund 8000 DM durch Anzeigen ein.[64] Dies ist ein Drittel der Druckkosten bzw. rund 6,7 Prozent der monatlich insgesamt benötigten 120 000 DM. Bei BISS, München scheint der Erlös aus Anzeigen 1996 so gering gewesen zu sein, daß in der Jahresbilanz nicht einmal ein Posten "Anzeigenerlöse" aufgeführt ist.[65] In Asphalt, Hannover, das meinem Eindruck nach relativ viel Werbung enthält, "pflastern" Firmen, die das Projekt mit mindestens 300.- pro Monat für mindestens ein Jahr unterstützen, den unteren Seitenrand mit einer "Straße in die Zukunft". Allein durch diese Aktion, die erst im Entstehen zu sein scheint, erhält Asphalt bei fünf Firmen, die in der Dezemberausgabe 1997 werben, monatlich mindestens 1500.-.[66] Auch bei BODO, Bochum; Dortmund scheint der Anzeigenverkauf vergleichsweise erfolgreich zu sein. In der Novemberausgabe finden sich beispielsweise auf 32 Seiten 22, meist kleinformatige gewerbliche Anzeigen und sieben private Kleinanzeigen. Die Dezemberausgabe von Die Straße, Solingen enthält dagegen außer vier privaten Kleinanzeigen gar keine Werbung.
3. Spenden: Ein wesentlich größerer Anteil der Einnahmen stammt aus Spendengeldern. Hinz & Kunzt, Hamburg z.B. bestreitet 20 Prozent der monatlich für die Herstellung der Zeitung notwendigen 120 000.- aus Spenden.[67] BISS, München erwirtschaftet aus Spenden, Fördermitgliedsbeiträgen, Stiftungsgeldern und Geldbußen[68] fast 39 Prozent der benötigten Mittel.[69]
Um nicht zu sehr von saisonalen Schwankungen oder unvorhergesehenen Ereignissen, die Spenden abziehen, betroffen zu sein[70], haben die meisten Projekte Freundeskreise und Fördermitgliedschaften eingerichtet. Bei Hinz & Kunzt, Hamburg kostet die Mitgliedschaft im Freundeskreis monatlich mindestens 100.- (ermäßigt: 60.-)[71]. Asphalt, Hannover wirbt um Patenschaften für das Projekt, stellt aber die Höhe des monatlichen Förderbetrages frei.[72] Auch Trott-war, Stuttgart und BISS, München legen die Beitragshöhe für Förder- und Freundeskreismitgliedschaften nicht fest.[73]
4. Sponsoren: Für Sponsoren scheinen die meisten Straßenzeitungsprojekte nicht attraktiv zu sein. Weder Hinz & Kunzt, Hamburg noch BISS, München erwähnen in ihren Bilanzen Sponsoren. Auch aus Stuttgart wird berichtet, daß Gespräche mit der Wirtschaft angesichts einer gegenwärtig finanziell schwierigen Situation von trott-war "erfolglos verliefen".[74] Fiftyfifty, Düsseldorf arbeitet dagegen sehr erfolgreich mit namhaften Künstlern zusammen. Alleine der Verkauf von Uhren des Grafikers Jörg Immendorff brachte dem Projekt 60 000.- ein. Darüber hinaus wurden die Erlöse mehrerer Kunstausstellungen an fiftyfifty überwiesen.[75]
5. Förderungen des Arbeitsamts bzw. der Kommune: Der Löwenanteil der Kosten entfällt auf die Bezahlung des angestellten Personals.[76] BISS, München, Trott-war, Stuttgart, Asphalt, Hannover und Die Straße, Solingen arbeiten deshalb mit nach §§91ff AFG vom Arbeitsamt und nach §19 BSHG von der Kommune als Träger der Sozialhilfe geförderten Personen.[77] Die Höhe der übernommenen Kosten ist zum Teil erheblich. BISS z.B. erhielt 1996 bei Ausgaben von knapp 750 000.- über 300 000.- Lohnkostenzuschüsse vom Arbeitsamt und vom Sozialamt München, Trott-war, Stuttgart bekam 40% der jährlich benötigten 1 000 000.- vom Arbeitsamt.[78]
Da ABM- bzw. BSHG-Berechtigte nur auf Zeit gefördert werden (§3, Abs.4 ABM-Anordnung; §19 Abs.1 Satz 3 BSHG), ergeben sich erhebliche Probleme, wenn diese Stellen auslaufen. Vor diesem Problem stehen aktuell Trott-war, Stuttgart und Asphalt, Hannover. Deshalb versuchen beide Projekte, durch eine höhere Auflage mehr Geld einzunehmen und für Werbekunden und Sponsoren interessanter zu werden. Beide Projekte setzen auf Expansion und streben eine volle Eigenfinanzierung durch Verkauf, Anzeigen, Spenden und Sponsoren an.[79]
BISS, München und Die Straße, Solingen setzen nicht auf Eigenfinanzierung, sondern weiter auf geförderte Arbeitsplätze.[80] Bei Die Straße, Solingen wird die Angewiesenheit auf ABM-Stellen als Problem empfunden, da die ständigen Personalwechsel eine kontinuierliche redaktionelle Arbeit erschweren.
Hinz & Kunzt, Hamburg und fiftyfifty, Düsseldorf kommen ohne über ABM bzw. BSHG finanzierte Arbeitsplätze aus.[81] Bei Hinz & Kunzt liegt dies im Wesentlichen an dem guten Einnahmeergebnis durch den Straßenverkauf, bei fiftyfifty an der im Verhältnis zu anderen Straßenzeitungen geringen Zahl an hauptamtlichen MitarbeiterInnen.
Bei den nach dem Profi-Konzept arbeitenden Projekten steht die Herstellung einer Zeitung und ihr Verkauf im Mittelpunkt. Darüber hinaus ist eine Straßenzeitung jedoch nicht nur ein Unternehmen, sondern auch ein Sozialprojekt.[82] Die wichtigste sozialdienstliche Aufgabe ist die Beschaffung von Wohnraum. Wie eine von Hinz & Kunzt durchgeführte Analyse zeigt, wünschen sich fast alle VerkäuferInnen eine eigene Wohnung.[83] Dafür hat das Hamburger Projekt einen ausschließlich aus Spenden finanzierten Wohnungspool gegründet. Unter dem Motto "Ab in die eigene Wohnung - Hinz & Kunzt-Verkäufer werden Mieter wie Du und ich" beschaffen drei Sozialpädagoginnen und ein ehemaliger Wohnungsloser Wohnungen von öffentlichen und privaten VermieterInnen, helfen bei der Wohnungssuche, vermitteln zwischen VermieterInnen und Wohnungslosen und betreuen bei Bedarf die zum Teil jahrelang wohnungslos gewesenen MieterInnen.[84] 240 Hintz & Künztler haben inzwischen wieder "ein Dach über dem Kopf".[85] Auch für Trott-war, Stuttgart ist es ein zentrales Ziel, für wohnungslose VerkäuferInnen eine Bleibe zu finden. Allen VerkäuferInnen wird innerhalb weniger Wochen eine Trott-war-Wohnung vermittelt.[86] Das Projekt hat Zugang zu einer Notfallkartei. Auch Anzeigen, in denen unter Angabe der Verkäufernummer Wohnungen gesucht werden, scheinen sich bewährt zu haben.[87] BISS, München will über den Kauf von Belegungsrechten VerkäuferInnen zu Wohnraum verhelfen.[88] Fiftyfifty, Düsseldorf renoviert zusammen mit wohnungslosen Menschen Häuser und richtet diese ein. Für 41 Personen konnten so drei Unterkünfte geschaffen werden, ein weiteres Haus für 20 Personen wurde mit diesen zusammen Ende 1997 in Angriff genommen. Außerdem werden die LeserInnen in der Zeitung aufgefordert, nach geeigneten Objekten Ausschau zu halten.[89]
Die nach dem Profi-Konzept arbeitenden Projekte bieten durch die professionelle Herstellung einer regelmäßig erscheinenden Zeitung einer großen Zahl von wohnungs- und arbeitslosen Menschen die Möglichkeit ein regelmäßiges kalkulierbares Einkommen zu erzielen. Durch den Verkauf der Zeitung und sozialdienstliche Unterstützung soll bei den VerkäuferInnen die Verantwortung für das eigene Leben schrittweise (wieder) aufgebaut werden, bis sie im Idealfall unabhängig von den Projekten leben können. Durch die hohe Auflage haben die Zeitungen eine wichtige Aufklärungsfunktion der BürgerInnen und besitzen im sozialpolitischen Diskurs vor Ort großes Gewicht
2.2.2. Selbsthilfeinitiativen
Die Selbsthilfeinitiativen zerfallen in zwei Gruppen. Es gibt in Selbsthilfe herausgegebene Zeitungen, die nur in einer Stadt erscheinen, es gibt jedoch auch bundesweit agierende Projekte.
1. Regional agierende Projekte
Von unge, Köln
Die seit 1992 in Köln monatlich erscheinende Zeitung Von unge ist aus einer Gefangeneninitiative entstanden.[90] Zum Preis von 1,40 DM pro Stück ist sie die billigste bundesdeutsche Straßenzeitung. Von unge grenzt sich eindeutig von anderen "Obdachlosenzeitungen" ab. Ein Mitarbeiter: Wir sind eine kollektive Selbsthilfe. Wir sind kein Obdachlosenblatt." Der individuelle Verdienst der einzelnen VerkäuferInnen steht demnach auch nicht wie bei den in Punkt 2.2.1. beschriebenen Blättern im Mittelpunkt der Arbeit.[91] Die -ehrenamtlich arbeitenden- Redakteure sind alle auch Verkäufer. Pro verkauftem Exemplar behalten sie 60 Pf, weitere 60 Pf gehen in die Herstellung der nächsten Zeitung, Miete, Telefon- und Stromkosten usw. Die restlichen 20 Pf werden für Übernachtungs- und Wohnmöglichkeiten für Wohnungslose verwendet. Zusätzlich zu den verkaufenden RedakteurInnen gibt es noch sogenannte HandverkäuferInnen, die die Zeitungen für 80 Pfennig pro Stück erwerben und sie dann weiterverkaufen.
Von unge hat einen politischen Anspruch: "In unserer Zeitschrift wird linkspolitisch reagiert. Jeder Druck von oben wird von unten abgewehrt. Darum heißt die Zeitung »Von unge«. Wir kommen von unten und wehren uns." Das Blatt selbst bezeichnet sich als "Nicht Almosen-, nicht Tränendrüsen-, nicht Zuguck-, sondern GEGENWEHR-Mitmachzeitung":
"Von unge ist eine Mitmachzeitung. Sie versteht sich als »Meckerecke« und Ermutigung von Menschen, die nicht das dicke Geld haben, die großen Medien für sich einzusetzen, nicht die Macht, Menschen zu dirigieren.
Von unge ist das kleine Medium für die kleinen Leute, die nicht noch weiter nach unten treten. Betroffene und Aktive haben selbst das Wort zu Alltag und Besonderem. Sie müssen sich einfach melden. Wer was Kritisches zu sagen hat, ohne »das große Sagen« zu haben, ist eingeladen, bei der Zeitung und Bewegung von unge nicht mehr so viele weiße Flecken." mitzumachen. Wenn viele mitmachen, hat das Bild »Kölle und Umgebung von unten betrachtet«[92]
Thematisch beschäftigt sich von unge mit lokalen Mißständen wie der Willkür Kölner Behörden oder der Vertreibungspolitik, die z.B. zur Räumung der Klagemauer am Dom geführt hatte, jedoch auch mit bundespolitischen Themen wie dem Eurofighter, den Castortransporten, Theo Waigels Haushaltsloch oder dem sogenannten Kombi-Lohn.
Da von unge keine Personalkosten aufzubringen hat, ist das Blatt nicht auf Anzeigen oder Werbung angewiesen. Die seit der Räumung der Klagemauer, wo von unge von Initiator Walter Hermann mit großem Erfolg verkauft wurde, zurückgehende Auflage von zwischenzeitlich 28 000 auf 15 000 pro Monat[93] macht den HerausgeberInnen jedoch große Sorgen, da die Kosten für den Druck mit sinkender Auflage nicht sehr stark zurückgehen und Miete und andere Fixkosten prozentual stärker zu Buche schlagen. Deshalb ist das Überleben von von unge keineswegs gesichert. Das Blatt wirbt in seinen Ausgaben um neue MitarbeiterInnen, vor allem um HandverkäuferInnen, um auf dem relativ großen Absatzmarkt in Köln eine höhere Auflage unter die Leute bringen zu können.[94]
Strassenfeger, Berlin
Der Strassenfeger erscheint 14tägig und wird auf den Straßen und in den S- und U-Bahnen Berlins für 2 DM verkauft. 1 DM erhält der/die VerkäuferIn, 1 DM fließt in das Projekt. Herausgeber der Zeitung ist der als gemeinnützig anerkannte Verein "mob - obdachlose machen mobil e.V", der sich "die Verbesserung der Lebensumstände von gesellschaftlich Benachteiligten und Ausgegrenzten, insbesondere Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen"[95] zum Ziel gesetzt hat. Die "Grundüberzeugung" des Vereins lautet: "Obdachlose können sich selbst helfen."[96] Deshalb will der Verein Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Die Arbeit hat zwei Schwerpunkte. Zum einen wird die Zeitung Strassenfeger erstellt, vertrieben und verkauft, zum anderen gibt es eine selbstorganisierte Notübernachtungsstelle für wohnungslose VerkäuferInnen, die sich aus dem Erlös des Zeitungsverkaufes finanziert.[97] Seit Anfang des Jahres ist eine Sozialarbeiterin für Sozialdienstaufgaben wie Beratung, Hilfe beim Umgang mit Behörden oder bei der Wohnraumbeschaffung angestellt.[98]
Der Strassenfeger versteht sich als Organ, das "entschieden Partei für Arme, Ausgegrenzte und Obdachlose [nimmt]"[99] und wird im Wesentlichen von wohnungslosen und anderen ausgegrenzten Menschen selbst gestaltet. Verantwortlich im Sinne des Presserechtes zeichnet der seßhafte Stefan Schneider. Alle AutorInnen erhalten Zeilengeld. Es gibt keine angestellten JournalistInnen, so daß der Verkaufserlös unmittelbar dem Projekt zugute kommt. Um den Verkaufenden Versicherungsschutz zu bieten, wurde ihnen ein knapp über der Geringfügigkeitsgrenze liegender Arbeitsvertrag angeboten. Bisher drei Personen kommen in den Genuß des vom Sozialamt nach §19 BSHG finanzierten Programms "Hilfe zur Arbeit".[100]
Der Strassenfeger erscheint meistens mit einem Schwerpunktthema. Nr.21 vom November 1997 z.B. heißt "Kummer, Kunst und Kompromisse", Nr.2 vom Januar 1998 behandelt das Thema "Psychiatrie", in Nr.4 vom Februar 1998 wird über "Bahnhöfe" geschrieben. Im Großteil der Artikel berichten die meist wohnungslosen MitarbeiterInnen von ihren Erfahrungen. Zeitweise gab es eine Rubrik "Autoren zum Anfassen"[101]. Diese ist inzwischen abgeschafft, da eine solche Rubrik immer eine gewisse Trennung zwischen "Nur-Verkaufenden" und AutorInnen impliziert, die beim Strassenfeger nicht gewollt ist.[102]
Der Strassenfeger ist eine der wenigen mir bekannten Zeitungsprojekte, die mit dem auf allen bisherigen Straßenzeitungstreffen bekundeten Willen zur Kooperation zwischen den verschiedenen Projekten ernst zu machen versucht.[103] So entstand z.B. eine gemeinsame Ausgabe mit dem ebenfalls in Berlin erscheinenden Projekt Zeitdruck, einem von obdachlosen Jugendlichen erstellten Blatt, und eine Kooperationsnummer mit dem in Michelstadt herausgegebenen Looser.[104] Seit März 1998 wird mit dem Looser zusammen eine gemeinsame Zeitung herausgegeben.[105] Auch werden immer wieder aus anderen Straßenzeitungen entnommene Artikel abgedruckt.[106] Außerdem gelingt es dem Blatt, die oft beklagte Zersplitterung alternativer Gruppen ansatzweise zu überwinden. Immer wieder schreiben "Jungdemokratinnen / Junge Linke" von der Universität Berlin im Strassenfeger.[107]
Wohnungs- und Obdachlose helfen sich nach dem Konzept des Strassenfegers also in im wesentlichen drei aufeinander bezogenen Dimensionen selbst: Durch das Schreiben von Artikeln, den Verkauf der Zeitungen und dem Angebot einer selbstverwalteten Notübernachtung sichern sie für sich und andere das Überleben. Durch die Aufklärung der "normalen" BürgerInnen schaffen sie eine Lobby für Ausgegrenzte. Durch die gemeinsame selbstverantwortliche Arbeit im Projekt erlangen sie Bildung im Sinne einer Befreiung des Menschen zu sich selbst.[108]
Signal, Marl
In der etwa 95 000 Einwohner zählenden Stadt Marl am nördlichen Rand des Ruhrgebiets gründeten Obdachlose 1994 den Verein "Signal. Solidargemeinschaft von und für Obdachlose e.V."[109] Inspiriert durch einen Fernsehbericht über Hinz & Kunzt ging es zunächst darum, "auch irgend etwas in dieser Richtung [zu] machen." Da die Initiatoren weder Geld noch Aussicht auf ein Konto hatten, stellte der Caritasverband ein Unterkonto, der Weihbischof von Münster Startkapital, die katholischen Kirchen Büromöbel und die evangelischen Kirchen Geld für einen PC zur Verfügung. Ein bis heute mietfreies Büro im Rathaus erhielt die Initiative von der Stadt Marl.[110]
Als wichtigstes Ziel des Projektes wird "Öffentlichkeitsarbeit" genannt: "Bei Veranstaltungen mitzumachen, mit den Medien in Verbindung treten, bei Zeitungen und Sendern im Lokalteil aufzutreten, Vorträge in Schulen und Arbeitskreisen zu halten." Zur bundesweiten Aktion "Wohnen ist ein Menschenrecht" im September 1994 beispielsweise trat das Projekt in Marl mit einer Aktion an die Öffentlichkeit.
Die Herstellung einer Zeitung trat durch diese Aktivitäten erst einmal in den Hintergrund. Am schwierigsten erwies sich die (Vor)finanzierung. Diese wurde, nachdem das Projekt im Rahmen eines Gespräches mit verschiedenen Selbsthilfegruppen vorgestellt worden war, von der Stadt Marl übernommen.
Die erste Ausgabe des Straßenmagazins Signal erschien im November 1995 mit einer Auflage von 2000 Stück, wovon 1000 verkauft werden konnten.[111] Die offizielle Form des Vertriebs ist eine Spendensammlung mit Genehmigung des Ordnungsamtes. Eine Mark erhält der oder die Verkaufende, eine Mark fließt in das Projekt. Als Ziel der Zeitung wird im Editorial angegeben: "Dieses Straßenmagazin soll einerseits in der Öffentlichkeit über die soziale Situation Obdachloser und von Obdachlosigkeit Bedrohten informieren und andererseits den Obdachlosen eine Verdienstmöglichkeit eröffnen."[112]
Inhaltlich bringt die Erstausgabe neben einer Selbstdarstellung des Projekts, dem Lebensbericht eines Ex-Wohnungslosen, einem Comic und einem Gedicht in der Hauptsache Berichte über weitere Projekte in Marl, die die Ausgrenzung durch Wohnungslosigkeit und Armut ein Stückweit zu beseitigen suchen.
Ursprünglich war geplant, Signal vierteljährlich herauszugeben.[113] Seit der Erstausgabe ist jedoch keine weitere Nummer erschienen. Dies dürfte mit der niedrigen Kostendeckung zusammenhängen[114], jedoch auch mit der Prioritätensetzung des Vereins. Wichtigstes Ziel des Vereins ist Öffentlichkeitsarbeit, um eine Lobby für Obdachlose und andere Ausgegrenzte zu schaffen. Anscheinend ist dieses Ziel für die zur Zeit 13 zumeist (ex)-obdachlosen Vereinsmitglieder im direkten Gespräch in Schulen, Kirchengemeinden und bei Aktionen besser zu erreichen als über die Herstellung und den Vertrieb einer Straßenzeitung. Die breite Unterstützung, die der Verein von der Kommune, den Parteien, den Wohlfahrtsverbänden und den Kirchengemeinden vor Ort erhält[115], scheint das Vorgehen zu bestätigen. Diese Unterstützung sieht im Großen und Ganzen nicht so aus, daß diese Institutionen für den Verein handeln, sondern den Selbsthilfeansatz unterstützen, auch wenn nicht alle drei Monate ein verkaufbares Produkt dabei herauskommt.
2. Bundesweit agierende Projekte
Looser, Michelstadt
Seit Ende 1994 erscheint die Zeitung Looser, die von dem in Michelstadt im Odenwald ansässigen "Selbsthilfeförderverein Arbeit und Wohnen" herausgegeben wird.[116] Als eines der wenigen mir bekannten Projekte hat der Looser den Anspruch, bundesweit zu erscheinen, denn, so die Initiatoren, "unter 20 000 verkauften Exemplaren rechnet sich die Sache nicht."[117] In kurzer Zeit wurde ein nahezu republikweites Vertriebsnetz aufgebaut. Inzwischen wird der Looser in über 30 Städten mit einer monatlichen Auflage von 40 000 Exemplaren verkauft. Dazu gehören die größeren Städte im Umkreis von Michelstadt Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen und Darmstadt, jedoch auch weiter entfernte Regionen wie das Ruhrgebiet oder Bremen.
Die wichtigsten Positionen des Vereins, in den inzwischen auch Personen, die niemals obdachlos waren, aufgenommen wurden, besetzen ehemalige Obdachlose. Werner Picker als Vereinsvorsitzender und Vertriebsleiter und Hans Klunkelfuß, der bereits den Berberbrief, eine Zeitung von und für Obdachlose, mitinitiiert hatte als Chefredakteur wurden zwischenzeitlich für zwei Jahre aus dem Programm "Arbeit statt Sozialhilfe" bezahlt. Klunkelfuß stieg im Sommer 1997 vorübergehend aus der Arbeit aus, nachdem es Spannungen mit dem "bürgerlichen Lager" gegeben hatte. Dieses hatte, so Gabriele Lermann, unter dem Motto "Weg mit den Pennern in der Spitze des Vereins" die Macht übernehmen wollen. Als dies nicht gelang, zog es sich aus der Vereinsarbeit zurück Seitdem heißt der Chefredakteur wieder Hans Klunkelfuß.
Der Looser setzt sich bewußt vom Profi-Konzept ab. Im Impressum heißt es: "Mitgearbeitet an dieser Ausgabe haben viele, vor allem Menschen, welche von Obdachlosigkeit oder Arbeitslosigkeit betroffen sind oder waren. Natürlich auch Sozialarbeiter. Aber: Garantiert keine Zeitungsprofis."[118] An anderer Stelle heißt es: "Im »Looser« darf sich keine abgehobene »schreibende Zunft« festsetzen."[119]
Das Selbsthilfekonzept des Looser umfaßt mehrere Dimensionen. Für die Schreibenden, oft Experten in Sachen Obdach- und Arbeitslosigkeit, ist der Looser "politisches und aufklärendes Sprachrohr"[120]. Für die Verkaufenden, die, anders als beim Strassenfeger in Berlin, mit den Schreibenden meist nicht identisch und mit ihnen aufgrund der Entfernung von den Verkaufsorten zu der Redaktion meist auch nicht bekannt sind, will der Looser eine Verdienstmöglichkeit durch eigene Arbeit schaffen, wodurch auch das Selbstvertrauen der Verkaufenden gestärkt werden soll.[121] In diesem Punkt besteht eine große konzeptionelle Nähe zum Profi-Konzept.
Ein weiteres wichtiges Anliegen ist es, Wohnraum zu schaffen. "Zusammen locker 100 Jahre Straßenleben"[122] führten bei den Initiatoren des Vereins zu der Überzeugung, daß Menschen, die längere Zeit obdachlos waren nicht mehr in der Lage sind, die konventionelle gesellschaftliche Form des Wohnens zu beherrschen.[123] Deshalb wurde das Projekt "Bauen mit Obdachlosen" entwickelt. Ein Treuhandkonto wurde eingerichtet, auf dem sich innerhalb von zwei Jahren Überschüsse aus dem Zeitungsverkauf und Spenden in Höhe von 250 000.- ansammelten. Mit der Unterstützung von Holztechnikern aus dem Odenwaldkreis und ArchitektInnen und Studierenden der Architektur der Technischen Universität Darmstadt wurden Pläne für ein aus sechs bis acht Wohnhäusern und einem Gemeinschaftshaus bestehendes Dorf entwickelt. Mit Hilfe von Baufachleuten wollen Wohnungslose ihre Häuser aus einheimischen Hölzern selbst bauen und in dem entstehenden Dorf nach dem Genossenschaftsmodell wohnen. In einer Holzwerkstatt und einem Trödellager soll gearbeitet werden können, um zum eigenen Lebensunterhalt beizutragen.[124]
Etwa seit Mitte 1997 stehen genügend Mittel zur Verfügung, um mit dem Bauen zu beginnen. Seitdem stehen Berichte über die schwierige Suche nach einem geeigneten Grundstück im Mittelpunkt des Looser. Regelmäßig werden der an bisher mehr als 200 BürgermeisterInnen verschickte Brief und die in Standardformeln abgefaßten Absagen dokumentiert.[125] Zugespitzt könnte man sagen: Der Looser ist die Straßenzeitung in der Bundesrepublik Deutschland, die sich den Einsatz für neue Wohnformen auf ihre Fahnen geschrieben hat.[126]
Ein weiteres Ziel des Looser ist es, mit anderen Straßenzeitungen zu kooperieren. Die Zusammenarbeit mit Lobby-press-Info-Service aus Frankfurt am Main, die nach einer Reihe von Kooperationsnummern zu der gemeinsamen Zeitung Lobster geführt hatte, wurde nach der zweiten Ausgabe wieder beendet. Seit März 1998 gibt der Looser zusammen mit dem Berliner Strassenfeger eine gemeinsame Zeitung heraus. Die erste Gemeinschaftsnummer erschien für die beiden Monate Februar und März 1998 mit einer Auflage von 60 000 und kostet in Berlin und Brandenburg 2 DM, im übrigen Bundesgebiet 2,50 DM. 1 DM (Berlin und Brandenburg) bzw. 1,10 DM (restliches Bundesgebiet) erhält der oder die Verkaufende. Die neue Gemeinschaftszeitung wirbt um weitere Partner.[127] Dahinter steckt das Ziel, die Kräfte zu bündeln: "Welch eine Macht stünde hinter einem Sprachrohr, das bundesweit sozial-politisch von unten agiert mit einer Auflage von mehreren Hunderttausend? An dem endlich keine Stadt mehr vorbei kann? Wieviel politische Aktionen könnte man parallel mit diesem endlich unüberhörbaren Sprachrohr verknüpfen?"[128]
Der Looser ist wegen seines bundesweiten Engagements alles andere als unumstritten. 1996 wurde er aus dem "Loccumer Abkommen" von 1995 ausgeschlossen, in dem sich 21 Straßenzeitungen verpflichtet hatten, in einem schon von einem anderen Projekt besetzten Markt keine Zeitungen zu verkaufen und auf in Gründung befindliche Projekte Rücksicht zu nehmen.[129] Insbesondere im Ruhrgebiet, wo die großen Städte längst aufgeteilt sind, hatte es wegen des Verkaufs des Looser Probleme gegeben.[130] Zwar saß der Looser bei der letzten Tagung der Straßenzeitungen im Oktober 1997 wieder mit am Tisch, neuer Ärger zeichnet sich jedoch ab. In Essen, wo bereits die Zeitung Wohnungsloser verkauft wird, wurde im Februar 1998 eine Lokalredaktion des Looser gegründet.[131]
Jedermann; Streetworker, Darmstadt
Keine 50 Kilometer von Michelstadt entfernt haben ehemalige und aktuell Wohnungslose 1996 den eingetragenen Verein "Jedermann. Kunst von der Straße. Selbsthilfe e.V." in Darmstadt gegründet.[132] Diese Initiative gibt inzwischen zwei zum überregionalen Verkauf bestimmte Zeitungen heraus. Das Blatt Jedermann, Kunst von der Straße geht inzwischen mit einer Auflage von 13 000 ins dritte Jahr, seit Anfang 1998 erscheint außerdem Streetworker mit einer Stückzahl von 12 000. Beide Blätter erscheinen in einem Intervall von ca. sechs bis sieben Wochen, je nachdem, wie lange es dauert, bis die alte Auflage an die VerkäuferInnen verkauft ist.[133] Eine dritte Zeitung, die in deutsch, englisch und französisch gedruckt werden soll, ist in Vorbereitung.
Den Großteil der Arbeit macht Werner H. Wilhelm, ein Künstler, der selbst insgesamt neun Jahre wohnungslos war und inzwischen Rentner ist.
Das Projekt hat zwei Schwerpunkte. Zum einen geht es darum, den VerkäuferInnen eine Zeitung zur Verfügung zu stellen, von deren Preis sie einen Großteil behalten. Je nachdem, wieviele Zeitungen die Verkaufenden bei Jedermann e.V. oder bei einem der ZwischenhändlerInnen in Darmstadt erwerben, können sie mit einem verkauften Exemplar zwischen 1,80 DM und 2,15 DM verdienen.[134] Dies ist möglich, da Jedermann e.V. "der billigste Verlag in Deutschland" ist[135] und gleichzeitig -zusammen mit dem Kasseler Tagesatz- mit 2,80 DM- den höchsten Verkaufspreis verlangt. Wilhelm macht bei Jedermann das Satzlayout selbst[136] und kann damit die Druckkosten pro Exemplar auf 18 Pfennig begrenzen. Der Druck des etwas aufwendiger hergestellten Streetworker kostet 25 Pfennig pro Stück. Die Verkaufenden kommen laut Wilhelm aus ganz Deutschland angereist und erwerben bis zu 1000 Zeitungen auf einmal, die sie dort, wo sie es für richtig halten, weiterverkaufen. Da viele auf den Zeitungsverkauf angewiesen sind, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, empfindet Wilhelm eine "große Verantwortung für die Verkäufer. Ich kann niemals keine Zeitung herausgeben."
Der zweite Schwerpunkt ist die Arbeit vor Ort in Darmstadt. Der Verein betreibt z.B. eine Wärmestube, die an Wochenenden und Feiertagen, wenn viele Einrichtungen in kommunaler oder kirchlicher Trägerschaft eingeschränkt arbeiten oder geschlossen haben, Armen und Wohnungslosen eine warme Mahlzeit anbietet. Soziale Dienste wie das Vermitteln von Wohnungen und Therapieplätzen oder Hilfe beim Stellen von Anträgen werden ebenfalls angeboten. Als neuestes Projekt wurde ein alter Zirkuswagen gekauft, der als rollendes Hotel bis zu vier Personen Platz zum Schlafen bietet. Außerdem ist geplant, ein Fachwerkhaus zu erwerben und ein Grundstück in Erbpacht zu gewinnen, auf dem Wohnungslose zusammen mit KünstlerInnen ein Haus bauen können.[137] Alternativ zu den "etablierten" Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe will Jedermann e.V. für die Wohnungslosen "wie eine Familie" sein. Wilhelm: "Man kann die Verkäufer nicht einspannen wie ein Pferd. Man muß die Verkäufer behandeln wie Söhne und Töchter."[138]
Über andere Straßenzeitungen äußerte sich Wilhelm, ähnlich wie Von unge, Köln mit großer Skepsis. Ein Besuch bei den "unfreundlichen" HerausgeberInnen des Hamburger Blattes Hinz & Kunzt führte ihn zu der Erkenntnis, viele Zeitungen würden dort gar nicht verkauft[139], beim Tagessatz in Kassel werden die Leute seiner Einschätzung nach "bevormundet", Hempels Straßenmagazin[140], Kiel wird seines Erachtens "zensiert von der Kirche." Besonders große Spannungen bestehen zu den nächsten Nachbarn Looser, Michelstadt und Lobby-Press, Frankfurt (Main). Beide Projekte hätten schon mehrfach versucht, VerkäuferInnen von Jedermann abzuwerben. Auch das Produkt Streetworker ist aus dieser Konkurrenz erwachsen. Als Looser und Lobby-Press einen Leserwettbewerb ausschrieb, um einen Namen für die gemeinsame Zeitung zu finden[141], warf Wilhelm den Streetworker auf den Markt. "Damit habe ich denen in Hessen den Sand abgegraben."
Auch an den jährlich stattfindenden Treffen der Straßenzeitungen[142] nimmt Jedermann; Streetworker - auch dies ist eine Gemeinsamkeit mit Von unge - nicht teil. Wilhelm: "Das ist mir zu blöd, da wird keine Praxis diskutiert, sondern Theorie."
Die Artikel in Jedermann und Streetworker stammen von verschiedensten Leuten, die alle das gleiche Zeilengeld erhalten. Wichtig für Wilhelm ist jedoch, daß die AutorInnen von "unten" kommen: "Ich möchte keine elitäre Schreibe haben, sondern Leute, die von der Straße kommen." Dieser Anspruch wird jedoch bei weitem nicht eingelöst: In Streetworker Winter/Frühjahr 1998 z.B. stammt mindestens die Hälfte aller Artikel von seßhaften Personen.[143]
Die aus Selbsthilfeinitiativen hervorgegangenen Projekte weisen bei weitem nicht die konzeptionelle Homogenität der nach dem Profi-Konzept erstellten Blätter auf. Während Von unge beispielsweise die politische Auseinandersetzung sucht, setzt Signal eher auf eine gemeinschaftliche Bekämpfung der Wohnungslosigkeit in der überschaubaren Stadt Marl. Für beide ist der Verdienst ihrer MitarbeiterInnen eher nebensächlich im Unterschied zu Strassenfeger und zu den bundesweit verkauften Blättern Looser und Jedermann; Streetworker, wo ähnlich wie beim Profi-Konzept Schreibende und Verkaufende in der Regel nicht identisch sind.
Allen Selbsthilfeinitiativen gemeinsam ist, daß "Betroffene" über die Belange des Projektes weitgehend selbst entscheiden und die Inhalte meistens[144] selbst verantworten. Auffällig ist das Mißtrauen gegenüber anderen Projekten bei Von unge, Looser und Jedermann; Streetworker.
2.2.3. Von Ehrenamtlichen getragene Projekte
Einige Zeitungsprojekte werden von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen herausgegeben. Zu dieser Gruppe gehören z.B. der Straßenkreuzer aus Nürnberg und draußen! aus Münster und Hamm. Ähnlich wie beim Profi-Konzept ist es das wichtigste Ziel von Straßenkreuzer und draußen!, für die meist wohnungslosen Verkäuferinnen und Verkäufer eine Verdienstmöglichkeit zu schaffen.
"Der STRAßENKREUZER hilft Menschen in sozialer Not. Die Hilfe besteht darin, daß der Verein eine Zeitschrift herausgibt, die von Obdachlosen und Armen auf der Straße verkauft wird. Der STRAßENKREUZER e.V. ist als mildtätig anerkannt ... Die Obdachlosen erhalten von dem Preis, der pro Heft 2,50 Mark beträgt, 1,50 Mark. Damit haben sie die Chance, eigenes Geld zu verdienen. Der STRAßENKREUZER ist eine Alternative zum Betteln. Durch die Tätigkeit als Verkäufer können die Obdachlosen Vertrauen zurückgewinnen. Für viele bedeutet das Hilfe in der Not."[145]
Yvonne Legner von draußen!: "Die Verkäufer - Obdachlose, Sozialhilfeempfänger und Langzeitarbeitslose - können sich durch den Verkauf des Magazins ein Zubrot verdienen. Mehr zu leisten, sitzt für die ehrenamtliche Redaktion nicht drin - kein Geld, keine Leute, keine Zeit. So können wir bislang nur eine kurzfristige Hilfe, einen vorübergehenden Halt anbieten. Danach stehen die Menschen mit ihren Problemen wieder alleine da."[146]
Da keine Gehälter für hauptamtlich angestellte Journalisten zu bezahlen sind, sind die von Ehrenamtlichen initiierten Projekte nicht so stark von den Einnahmen abhängig. So verdienen die Verkaufenden beim Straßenkreuzer z.B. an einer Zeitung 1,50 DM und damit wesentlich mehr als bei den meisten nach dem Profi-Konzept arbeitenden Projekten. Da jedoch ehrenamtlich arbeitende Initiativen nicht monatlich eine Zeitung herausbringen können[147], dürfte es für VerkäuferInnen schwierig sein, eine einigermaßen regelmäßige Einnahme zu erzielen.[148]
Wie auch das Profi-Konzept betonen ehrenamtliche Initiativen die durch den Verkauf neu erworbenen Fähigkeiten und ein wachsendes Selbstbewußtsein als wichtige Ziele. Draußen!: "Nun sollte draußen! den Berbern ihr Selbstvertrauen wieder zurückgeben." Über die Chancen, in die "Normalität" zurückzukehren, wird jedoch, ähnlich wie bei den von der Wohnungslosenhilfe geprägten Blättern[149], wesentlich nüchterner geurteilt. Straßenkreuzer: "Ihre Chancen, wieder einen dauerhaften Arbeitsplatz zu ergattern, sind gering."[150]
Beide Projekte weisen in ihrer Entwicklung eine gewisse Professionalisierung auf, die bei draußen! jedoch nur vorübergehender Art war. Der Verein Straßenkreuzer e.V. beschäftigt seit März 1996 einen hauptamtlichen Geschäftsführer, bei draußen! wurde Ende letzten Jahres aus dem Programm "Beispielhafte Hilfen zur dauerhaften Wohnraumversorgung für Wohnungsnotfälle" des Landes Nordrhein-Westfalen eine Sozialarbeiterin eingestellt. Da "eine qualifizierte Beratung der Verkäuferinnen und Verkäufer dazu beiträgt, diesen Personenkreis wieder in Wohnung und Arbeit zu vermitteln"[151], sollten regelmäßig erscheinenden Straßenzeitungsprojekten mit mindestens 30 VerkäuferInnen 80 Prozent einer Sozialarbeiterstelle für drei Jahre aus Landesmitteln finanziert werden. Noch 1997 wurde jedoch das auf vier Millionen DM angesetzte Programm auf 500 000 DM gekürzt, so daß draußen! seine Sozialarbeiterin nach zwei Monaten wieder entlassen mußte.[152]
2.2.4. Von der Wohnungslosenhilfe geprägte Zeitungen
Bei den von Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe herausgegebenen Zeitungen lassen sich zwei verschiedene Typen unterscheiden. Zum einen gibt es Zeitungen, die auf der Straße verkauft werden, es gibt jedoch auch Blätter, die kostenlos verteilt oder ausgelegt werden.
1. Auf der Straße verkaufte Blätter
Beispiele für den ersten Typ sind die in Osnabrück erscheinende Zeitung Abseits!? und das aus Gelsenkirchen stammende Blatt Nie Wo Los. Abseits!? ist ein Projekt des "Sozialdienstes Katholischer Männer e.V." und erscheint alle zwei Monate in einer Auflage von 10 000 Exemplaren zum Preis von 1,80 DM. In Redaktion und Verkauf arbeiten überwiegend ehemalige Wohnungslose mit. Pro verkaufter Zeitung erhalten die 20 bis 30 VerkäuferInnen eine Mark. Ansonsten ist die Mitarbeit ehrenamtlich.[153] Unterstützt werden sie von zwei Sozialarbeitern und mehreren ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die für das Layout verantwortlich sind. Seit 1.11.1997 hat der Sozialdienst katholischer Männer einen ehemaligen Wohnungslosen eingestellt, der zu 75 Prozent vom Arbeitsamt, zu 25 Prozent vom Projekt selbst bezahlt wird. Um den Eigenanteil finanzieren zu können, wurde der Preis der Zeitung von vorher 1,50 DM um 30 Pfennige auf 1,80 DM erhöht.[154]
Als Ziele des Zeitungsprojekts werden zwei Ebenen unterschieden:
"Auf der einen Seite kann die Zeitung als Mittel zur Information der Öffentlichkeit dienen, um auf das Problem Wohnungslosigkeit aufmerksam zu machen sowie in einem weiteren Schritt für diese Problematik zu sensibilisieren. In diesem Sinne kann sie als »Sprachrohr« für die Wohnungslosen dienen und den Platz zur Äußerung zur Verfügung zu stellen, der ihnen sonst vorenthalten wird.
Auf der anderen Seite besteht für die Betroffenen die Möglichkeit, mit einer eigenständigen Tätigkeit, wie z.B. dem Schreiben von Artikeln eigene Kompetenzen und Stärken zu erfahren. Die Arbeit für die Zeitung kann zur Eigeninitiative motivieren sowie Selbstwertgefühl und Selbstachtung bei den Betroffenen stärken.
Durch den Verkauf der Zeitung, der zu einem bestimmten Anteil den Verkäufern zugute kommen soll, kann ein Beitrag zur Normalisierung der Lebenslage angestrebt werden: durch den eigenen Verdienst, das Nachgehen einer Arbeit sowie durch die Kontaktaufnahme mit den Käufern."[155]
Verantwortlich im Sinne des Presserechts zeichnet der beim Sozialdienst Katholischer Männer angestellte Sozialarbeiter Thomas Kater. Die meisten Artikel stammen jedoch von (Ex)-Wohnungslosen selbst. Im Vordergrund stehen Berichte über das eigene Leben auf Platte oder anderswo[156], Gedanken zur politischen Situation und ihre Auswirkungen auf Wohnungs- und Arbeitslose und andere ausgegrenzte Menschen[157], sowie Schilderungen der Aktivitäten von "Abseits!?" mit dem Schwerpunkt auf Öffentlichkeitsarbeit im Sinne des Zugehens auf verschiedene gesellschaftliche Gruppen.[158] Die Arbeitslosenselbsthilfeinitiative schreibt regelmäßig.[159] Außerdem wird in jedem Heft die Rubrik "Sozialer Leitfaden / Adressenliste" veröffentlicht.
Ähnliche Ziele wie Abseits!? gibt auch das etwa vierteljährlich in einer Auflage von 500 bis 600 Stück erscheinende Blatt Nie Wo Los an.[160] Nie Wo Los wird von der von Diakonie und Caritas gemeinsam getragenen Begegnungsstätte "Das weiße Haus" in Gelsenkirchen-Buer herausgegeben. Trotz konzeptionell gewünschter Mitarbeit "Betroffener" werden viele Beiträge von den in der Beratung und der Begegnungsstätte tätigen MitarbeiterInnen geschrieben. Laut Auskunft eines dort tätigen Sozialarbeiters ist es sehr schwierig, Wohnungslose zum Schreiben zu motivieren. Die Zahl der Verkäufer wird mit drei bis fünf angegeben. Der Sozialarbeiter: "Die Leute scheinen das Geld nicht zu brauchen."
In der mir vorliegenden Ausgabe Nr.3/1997 ist viel von der Arbeit der Wohnungslosenhilfe die Rede, darunter ein fünfseitiger Jahresrückblick der "Hilfen für alleinstehende, wohnungslose Personen mit sozialen Schwierigkeiten, bedingt durch die besonderen Lebensverhältnisse". Auf der anderen Seite berichten durchaus auch (ehemalige) Wohnungslose über ihr Abrutschen in und ihr Wiederauftauchen aus der Obdachlosigkeit, über ihren Straßenverkauf und ihre Erfahrungen mit der Arbeit des Weißen Hauses.
2. Kostenlose Blätter
Statt Park, Essen und die meines Wissens einzige Zeitung aus Rheinland-Pfalz, die Platte aus Bingen, werden kostenlos verteilt. Statt Park wird von verschiedenen Beratungsstellen, stationären Einrichtungen und dem Sozialamt der Stadt Essen gemeinsam getragen und redaktionell verantwortet und erscheint unregelmäßig in einer Auflage von 10 000 Exemplaren. Bisher wurden drei Ausgaben (Dezember 1995, Juni 1996, Mai 1997) fertiggestellt. Platte erscheint vierteljährlich und wird vom rheinland-pfälzischen Sozialministerium finanziert.
Wichtigstes Ziel beider Projekte ist die Information. Statt Park wendet sich an wohnungslose und seßhafte BürgerInnen gleichermaßen:
"Betroffene wohnungslose Menschen sollen über das bestehende Hilfsangebot besser informiert werden und auch erkennen, daß die verschiedenen Angebote der Einrichtungen und Heime gemeinsam mit Betroffenen einen Weg zur Überwindung der Wohnungslosigkeit finden können. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Essen, soziale Dienste, Institutionen und Einrichtungen in der Stadt Essen werden ebenfalls über das Hilfsangebot informiert. Gleichzeitig wird um Verständnis, Solidarität und Mithilfe für Wohnungslose und Nichtseßhafte geworben. Auch wenn in Essen ein breites und differenziertes Hilfsangebot besteht, darf nicht übersehen werden, daß angesichts steigender sozialer Not, Arbeitslosigkeit und Wohnungsknappheit mehr Hilfe erforderlich ist."[161]
Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung verschiedener Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. MitarbeiterInnen beschreiben die Konzeptionen der verschiedenen Stellen und berichten aus ihrer Arbeit. Beiträge von Wohnungslosen sind selten. Die Rubrik "Kontakte, Beratung und Hilfsangebote für Wohnungslose und Nichtseßhafte" gibt einen Überblick über alle für Wohnungslose und Nichtseßhafte in Essen relevante Adressen. Eine solche auch in anderen Zeitungen zu findende[162] Adressenliste ist für ortsfremde Obdachlose sehr wichtig. Ein seit 10 Jahren obdachloser Mann, den ich in Hamm traf, berichtete mir, er würde sich auch ab und zu eine Straßenzeitung besorgen, um in Erfahrung zu bringen, wo er sich hinwenden kann.
Die Platte ist in umgekehrter Richtung konzipiert. Sie wendet sich an Behörden und Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, will aber auch seßhafte Bürger ansprechen:
"WIR STELLEN UNS! Wir, obdachlose Frauen und Männer, möchten mit der Zeitung »Platte« raus aus der Anonymität. Durch unsere Erfahrungs- bzw. Situationsberichte möchten wir unsere wirklichen Lebensumstände auf der Straße den bestehenden Obdachloseneinrichtungen, aber auch den Behörden näher bringen.
Die Obdachlosen-Zeitung »Platte« versteht sich als Forum und Sprachrohr der obdachlosen Frauen und Männer, um bestehende Vorurteile und Hemmschwellen in der Gesellschaft durch Öffentlichkeitsarbeit abzubauen.
Die Redaktion."[163]
Als redaktionell Verantwortlicher firmiert der seßhafte Ralf Blümlein. Trotzdem ist es, so Blümlein, "die Zeitung der Betroffenen."[164] Tatsächlich sind viele Beiträge von aktuell oder ehemals Wohnungslosen selbst verfaßt. Der Großteil dieser Artikel handelt über die Entstehung und manchmal über die Beendigung der Obdachlosigkeit der VerfasserInnen. Dabei überwiegen in den älteren Ausgaben die Berichte über erfolgreich beendete Obdachlosigkeit. Dieses Ungleichgewicht hat sich jedoch in den letzten Ausgaben zugunsten der aktuell Platte machenden Menschen geändert.[165] Ab und zu erscheinen Berichte über Erfahrungen in Einrichtungen der Obdachlosenhilfe. Regelmäßige Rubriken sind "Tips und Infos für Obdachlose" und "Informationen für den Umgang mit Sozialämtern". In einem Leserbrief heißt es dazu: "Es sind für uns sehr wichtige Tips."[166] Auch Suchmeldungen von obdachlosen Menschen, die FreundInnen oder KollegInnen ausfindig machen wollen, werden immer wieder veröffentlicht. Darüber hinaus informiert die Obdachloseninitiative "Platte" über ihre Arbeit.
Allen von Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe herausgegebenen Blättern gemeinsam ist die ausschließliche Fokussierung auf Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Während dieses Problem in Abseits!? und Platte schwerpunktmäßig von "Betroffenen" thematisiert wird, schreiben in Nie Wo Los und statt park hauptsächlich SozialarbeiterInnen. Meist wird aus der Perspektive des oder der einzelnen "Betroffenen" berichtet. Strukturelle Entstehungsbedingungen für Wohnungslosigkeit und Armut werden mit Ausnahme von Abseits!? eher selten reflektiert. Großen Raum nehmen Berichte über die Arbeit der Wohnungslosenhilfe ein.
Der Aspekt des Verdienstes durch den Verkauf der Zeitung spielt nur bei Abseits!? eine gewisse Rolle, ist aber auch dort den Zielen der Information der Öffentlichkeit und der Kompetenzstärkung der (ex)-wohnungslosen MitarbeiterInnen untergeordnet.
2.2.5. Von "Betroffenen" und der Wohnungslosenhilfe gemeinsam initiierte Projekte
Die Einteilung in bisher vier Gruppen geschah unter dem Gesichtspunkt, welche Personen- oder Berufsgruppe die verschiedenen Straßenzeitungsprojekte prägt. Eine Aussage über eine Ausschließlichkeit der prägenden Gruppe ist damit nicht impliziert. So betätigen sich z.B. bei nach dem Profi-Konzept arbeitenden Projekten durchaus auch hauptamtlich angestellte "Betroffene", in Selbsthilfeprojekten gibt es z.T. ehrenamtlich Mitarbeitende, von der Wohnungslosenhilfe geprägte Zeitungen werden auch von Wohnungslosen mitgestaltet.
Über die bisher dargestellten vier Gruppen hinaus gibt es jedoch auch Projekte, die von "Betroffenen" und der Wohnungslosenhilfe gemeinsam initiiert wurden. Anhand von Bank Extra, Köln und Hempels Straßenmagazin, Kiel wird diese Mischform dargestellt.
Bank Extra[167] gehört zu den ältesten der bestehenden Projekte in der Bundesrepublik Deutschland. Mehr als ein Jahr vor Hinz & Kunzt und BISS erschien im Juni 1992 die erste Ausgabe als Initiative von (ehemaligen) Wohnungslosen und Sozialarbeitern. Die Frage des Verdienstes der Verkaufenden stellte sich damals nicht. Bank Extra will wohnungslosen Menschen die Möglichkeit geben, "sich mal so richtig auszukotzen."[168] Es geht darum, die Lebensrealität wohnungsloser Frauen und Männer aus ihrer eigenen Sicht darzustellen. "Es wird nichts zensiert, gar nichts. Es wird so reingesetzt, wie es kommt."[169] "Betroffene" erhalten für eine Veröffentlichung einen kleinen Betrag, vorausgesetzt, sie arbeiten nicht in der Redaktion mit. In Bank Extra ist vieles aus dem Leben wohnungsloser Menschen und der Obdachlosenszene zu erfahren, was auch gut recherchierende interessierte Seßhafte nicht ohne weiteres zu ermitteln vermögen. In der Ausgabe Oktober/November 1997 z.B. schreibt ein Wohnungsloser über mangelnde sozialarbeiterische Unterstützung, die er als Nichttrinker erfährt.[170]
Die zweimonatlich erscheinende Zeitung konnte zwischenzeitlich ihre Auflage auf 10 000 steigern, erscheint jedoch derzeit wieder mit 3000 Exemplaren. Bank Extra trägt sich finanziell nicht selbst, der Verein muß pro Ausgabe 2000.- zuschießen. Bei der geringen Auflage sind die Druckkosten pro Exemplar sehr hoch, Werbekunden lassen sich kaum gewinnen.
Das Hauptproblem ist, so die inzwischen aus (ehemaligen) Obdachlosen, Angestellten der Benedikt-Labre-Hilfe und in anderen Berufen tätigen seßhaften BürgerInnen bestehende Redaktion, genügend kontinuierlich mitarbeitende VerkäuferInnen zu finden. Das Projekt scheint jedoch die Basis verloren zu haben. Im Dezember 1997 hatte Bank Extra vier, zum Teil unregelmäßig arbeitende Verkäufer, von denen sich einer auch in der Redaktion betätigte. Um einen kontinuierlichen Verkäuferstamm aufzubauen, wurde ein über ABM finanzierter Mitarbeiter (§§91ff AFG) angestellt, der selbst früher wohnungslos war. Ziel ist es, bis spätestens zum Herbst 1998 mit einem "radikalen Selbsthilfeansatz" wieder eine Auflage von 10 000 zu erreichen. Sollte dies nicht gelingen, will die Redaktion die Produktion der Zeitung einstellen.
Goldgräberstimmung herrscht dagegen bei Hempels Straßenmagazin[171] in Kiel. Hempels wurde im Januar 1996 von Obdachlosen zusammen mit einem Sozialarbeiter gegründet. Die erste Auflage von 5000 Stück wurde von damals drei Verkäufern in sechs Wochen verkauft. Bis vor kurzem war die ganze Arbeit ehrenamtlich organisiert, zwei Sozialarbeiter arbeiteten stundenweise auf Honorarbasis mit. Seit 1.11.1997 sind acht SozialhilfeempfängerInnen über §19 BSHG und drei Langzeitarbeitslose über ABM sozialversicherungspflichtig für ein Jahr angestellt, die von der Redaktion über den Druck bis hin zum Vertrieb Hempels Straßenmagazin erstellen. Sie erhalten ca. 2500.- brutto im Monat. Der aus EU-Mitteln bezahlte Sozialarbeiter und Projektleiter Tein erläutert: "Eine Stabilisierung und Entwicklung in den Bereichen Druck, Produktion, Layout, Redaktion, Fotoredaktion, Verkäuferbetreuung, Anzeigen-akquisition, Sponsoring, Buchhaltung, Vertrieb und Büro kann so unmittelbar vorangetrieben werden."[172] Die Auflage von Hempels Straßenmagazin verdoppelte sich gegenüber Oktober im Dezember 1997 auf 20 000 und war am 19.12. so gut wie ausverkauft. Inzwischen gibt es das Blatt auch inklusive einer eigenen Lokalredaktion in Flensburg. Verhandlungen über Kooperationen mit der in Lübeck erscheinenden Zeitung Bessere Zeiten und dem Blatt Jerusalämmer aus Neumünster waren aus der Sicht von Hempels bisher nicht erfolgreich. Ziel ist es, Hempels Schleswig-Holstein-weit zu verkaufen.
Inzwischen wurden 135 Verkäuferausweise ausgestellt. Einer meiner Gesprächspartner, der für Verkäuferbetreuung, Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, sieht das nicht nur positiv: "Jeden einzelnen kennst du ja nicht mehr. ... Wir müssen aufpassen, daß es keine Zwei-Klassen-Gesellschaft gibt, die einen machen das Ding, die anderen verkaufen."[173] Die Auflage zu steigern und "einfach ein gutes Blatt machen", um einen Teil der Lohnkosten selbst zu tragen, hält er für die wichtigste Aufgabe der nächsten Zeit. Eine Entwicklung wie in Hamburg - "dort hat der Obdachlose zu wenig Platz"[174] - soll vermieden werden.
Der Projektleiter sieht es als seine vordringliche Aufgabe an, Hempels finanziell auf sichere Beine zu stellen. Wichtigste Elemente sind die angestrebte Vermehrung des Spendenaufkommens von ca. 10 000 DM im letzten Jahr, Gewinnung von Werbe-kunden und Sponsoren, die Eintragung in ein Register beim Landgericht um Bußgelder zu erhalten, sowie Überzeugungsarbeit bei der Kommune und bei der Arbeitsverwaltung. Es geht darum, "der Stadt und dem Arbeitsamt klarzumachen, daß die auch was haben von Hempels." Wie es jedoch in ein oder zwei Jahren weitergeht, weiß auch der Projektleiter nicht. Der im Vertrieb beschäftigte Mitarbeiter ist überzeugt, daß das Projekt im Falle einer Streichung der bezuschußten Stellen wie vorher auf ehrenamtlicher Basis weiterlaufen wird.
Auch eine Qualifizierung der Mitarbeiter wird aus EU-Mitteln bezahlt. "Konkret heißt das, daß alle Vollzeitbeschäftigten, aber auch andere Vereinsaktive und Verkäufer, während eines Drittels ihrer Arbeitszeit praxisorientierte Fortbildungsveranstaltungen bei der Fa. Mikro Partner besuchen können. Thematisch reichen die Angebote von zertifierbaren Schreibmaschinenkursen über EDV, Journalismus, Marketing und Buchhaltungskurse bis hin zu Persönlichkeits- und Bewerbungsschulungen."[175] Dadurch sollen die Chancen der Teilnehmenden auf dem ersten Arbeitsmarkt verbessert werden.
Inhaltlich beschäftigt sich Hempels fast ausschließlich mit den Themen Obdachlosigkeit und Armut, was auch im Untertitel "Armut ... Jeder kann der nächste sein" zum Ausdruck kommt. Ein wichtiges Thema ist z.B. die Vertreibungspolitik von nicht angepaßt aussehenden Menschen aus der Kieler Innenstadt. Regelmäßig werden Hempels-Leute vorgestellt. Auch die Rubrik "Wichtige Anlaufstellen in Kiel", unterteilt in verschiedene Themenbereiche wie "Arbeitslose", "Mädchen und Frauen", "Suchthilfe", "Armut und Unterversorgung" etc., wird regelmäßig veröffentlicht.
Auch die von SozialarbeiterInnen und "Betroffenen" gemeinsam initiierten Projekte stellen also ähnlich wie die Selbsthilfeprojekte und die von der Wohnungslosenhilfe herausgegebenen Zeitungen Wohnungslosigkeit, Armut und verwandte Themen in den Mittelpunkt. Die bei den von der Wohnungslosenhilfe geprägten Zeitungen beobachtete individualisierende Betrachtung dieser Probleme scheint mir weniger ausgeprägt. Inhaltlich werden die Blätter von "Betroffenen" geprägt. Der Aspekt des Verdienstes scheint nicht zentral zu sein.
2.3. Gibt es gemeinsame Ziele aller Straßenzeitungen? Eine Zwischenbilanz
Trotz der zum Teil sehr unterschiedlichen Konzeptionen der zur Zeit etwa 40 verschiedenen Projekte stellt sich die Frage, ob es einen gemeinsamen Nenner gibt, auf den sich alle Straßenzeitungsprojekte bringen lassen. Immerhin 28 Straßenzeitungen mit einer Gesamtauflage von 500.000 Stück pro Monat haben im Oktober 1997 in einer Presseerklärung gemeinsam formuliert: Straßenzeitungen "wollen ... zu einem Faktor in der öffentlichen Meinungsbildung werden, ohne das gemeinsame Ziel aus den Augen zu verlieren: Straßenzeitungen dienen als Sprungbrett in die vom Verkäufer gewünschte Lebens- und Wohnform."[176]
An dieser Presseerklärung fällt folgendes auf:
1. Man "will" ein Faktor in der öffentlichen Meinungsbildung "werden", ist dies nach eigener Einschätzung also noch nicht.
2. Diese Absicht steht anscheinend in einem Spannungsverhältnis zu dem gemeinsamen Ziel.
3. Dieses Ziel ("Straßenzeitungen dienen als Sprungbrett in die vom Verkäufer gewünschte Lebens- und Wohnform") droht in den Hintergrund zu geraten.
4. Sprungbrett zu sein scheint jedoch wichtiger zu sein als die Absicht der öffentlichen Meinungsbildung. Dies zeigt die Bezeichnung "Ziel".
5. Obwohl das Ziel in den Hintergrund zu geraten droht, ist es anscheinend gar keine Frage, daß es erreicht wird. Dies läßt sich an dem im Indikativ formulierten Schlußsatz ablesen.
In der Presseerklärung haben sich die auflagenstarken nach dem Profi-Konzept arbeitenden Straßenzeitungen auf der ganzen Linie durchgesetzt.[177] Abseits, Osnabrück oder Straßenkreuzer, Nürnberg z.B. dürften der Sprungbrett-These wohl kaum zustimmen können. Auch für Platte, Bingen, Von unge, Köln oder Signal-Anker, Marl gelten andere Prinzipien.[178] In der interessierten Öffentlichkeit muß durch eine solche Erklärung natürlich der Eindruck entstehen, das Genre "Straßenzeitung" sei mit den auflagenstarken nach dem Profi-Konzept arbeitenden Zeitungen identisch. Diesen Eindruck vermitteln auch überregionale Tages- und Wochenzeitungen, in denen Berichte über die nach dem Profi-Konzept arbeitenden Projekte, allen voran die auflagenstärkste bundesdeutsche Zeitung Hinz & Kunzt, im Verhältnis zu ihrer Zahl bei weitem überrepräsentiert sind.[179] Auch in Fachzeitschriften der Sozialen Arbeit ist immer wieder von denselben Blättern die Rede. Insbesondere Selbsthilfeprojekte und von der Wohnungslosenhilfe herausgegebene Zeitungen finden kaum Erwähnung.[180]
Auf der Suche nach einem gemeinsamen Nenner aller Straßenzeitungen, der alle Straßenzeitungstypen umfaßt, geht Werena Rosenke von der BAG Wohnungslosenhilfe wesentlich weiter als die Presseerklärung der 28 Straßenzeitungen. Sie nennt als gemeinsame Ziele aller Straßenzeitungen:
"- Hilfe zur Selbsthilfe leisten
- nicht Mitleid, sondern Interesse wecken
- Beteiligung von Betroffenen
- Kommunikation zwischen wohnungsloser und wohnender Bevölkerung erleichtern, um Vorurteile abzubauen."[181]
Dieser Formulierung könnte sich die überwiegende Mehrheit der bundesdeutschen Straßenzeitungsprojekte bestimmt anschließen. Allenfalls die kostenlos verteilte, von Einrichtungen der Essener Wohnungslosenhilfe herausgegebene Zeitung statt park, die es sich zum Ziel gesetzt hat, wohnungslose und seßhafte BürgerInnen über die bestehenden Hilfsangebote zu informieren[182], wird von der Analyse Rosenkes nicht erfaßt. Statt park ist jedoch eine Ausnahme und sich dieser Stellung durchaus bewußt. Die Zeitung äußert sich auch schon einmal dem gesamten Genre "Straßenzeitung" gegenüber grundsätzlich mißtrauisch.[183]
Das zweite von Rosenke genannte Prinzip sollte m.E. ergänzt werden und "nicht primär Mitleid, sondern vor allem Interesse wecken" genannt werden. Soweit ich sehe, lehnen Straßenzeitungen Mitleid mit Armen und Wohnungslosen nicht pauschal ab. In einer Zeit, in der sich die Gnadenlosigkeit gegenüber den Ausgegrenzten immer mehr durchsetzt, wäre es auch fatal, Interesse und Mitleid gegeneinander auszuspielen. Aus Mitleid kann ebenso Interesse erwachsen, wie ich umgekehrt mit einem Menschen, der mich interessiert, Mitleid empfinde, wenn es ihm oder ihr schlecht geht. Rosenke ist aber insoweit zuzustimmen, daß Straßenzeitungen ein Gegengewicht zu einem in der Tradition der "christlichen Liebestätigkeit"[184] stehenden primär auf Mitleid und Almosenverteilung basierenden Umgang mit armen und wohnungslosen Menschen bilden wollen.
3. Die Verkäuferinnen und Verkäufer
Aus welchen Gründen ist es für wohnungs- bzw. arbeitslose Menschen interessant, bei Straßenzeitungen mitzuarbeiten? Um eine Antwort auf diese Frage zu erhalten, habe ich Gespräche mit insgesamt 16 Verkäufern und einer Verkäuferin von Straßenzeitungen geführt.
Mich interessierten dabei fünf Fragenkomplexe:
- Wie ist die wohnliche und finanzielle Situation meiner GesprächspartnerInnen?
- Aus welchen Motiven werden Straßenzeitungen verkauft?
- Wie hoch ist der Verdienst?
- Seit wann arbeiten die VerkäuferInnen bei der jeweiligen Straßenzeitung?
- Wie groß ist die Identifikation mit dem Projekt?
3.1. Ein methodisches Problem und sein Erkenntniswert
Meinen ursprünglichen Plan, Verkäuferstimmen von allen fünf in Punkt 2 dieser Arbeit vorgestellten Zeitungstypen zu erhalten, mußte ich wieder aufgeben, da ich in einigen von mir besuchten Städten, z.B. in Hamm (draußen!) und in Gelsenkirchen (Nie Wo Los) keine VerkäuferInnen antraf. In Köln, wo ich mit zwei Von unge-Mitarbeitern sprach, hielt ich vergeblich nach Bank Extra-VerkäuferInnen Ausschau. Daß ich in Marl (Signal-Anker) niemanden antraf, versteht sich von selbst.[185]
Dieser für die Konzeption meiner Arbeit problematische Sachverhalt hat dennoch Erkenntniswert: Anscheinend gelingt es kleineren Zeitungsprojekten oft nicht, kontinuierlich in "ihrer" Stadt präsent zu sein. Dadurch ist die Straßenzeitung wenig bekannt, was den Aufbau einer Stammleserschaft ebenso erschwert wie die Gewinnung kontinuierlich mitarbeitender Verkäuferinnen und Verkäufer.[186] Gerade in dichtbesiedelten Gebieten wie dem Ballungsraum Köln/Düsseldorf/Ruhrgebiet scheinen am Straßenzeitungsverkauf Interessierte eher zu den auflagenstärkeren Zeitungen zu gehen. Ein Grund dürfte auch hier der höhere Bekanntheitsgrad sein. Da die großen Blätter außerdem meist häufiger erscheinen als die kleinen, bieten sie auch eher die Chance eines regelmäßigen Verdienstes. Ferner muß keine unter Umständen aufreibende Pionierarbeit geleistet werden.
Kleine Zeitungen befinden sich damit in einem Teufelskreis. Durch mangelnde Präsenz in ihrer Stadt üben sie keine oder nur eine geringe Anziehungskraft auf potentielle MitarbeiterInnen aus und bleiben damit weiterhin relativ unbekannt. Professioneller gestaltete Blätter aus anderen Städten dringen teilweise in den Markt ein[187] und erscheinen der interessierten Leserschaft unter dem Aspekt des Preis-Leistungs-Verhältnisses attraktiver.
Die meisten der Gespräche führte ich demzufolge mit VerkäuferInnen der nach dem Profi-Konzept arbeitenden Zeitungen. Die folgenden Abschnitte beruhen auf Gesprächen, die ich mit zwei Looser-Verkäufern in Ludwigshafen und Mannheim, zwei Von unge-Verkäufern in Köln, zwei fiftyfifty-Verkäufern und einer fiftyfifty-Verkäuferin in Düsseldorf, einem weiteren fiftyfifty-Verkäufer in Düsseldorf, der darüber hinaus noch den Wohnungsloser aus Essen und das Gelsenkirchener Blatt Nie Wo Los im Angebot hatte, zwei Die Straße-Verkäufern in Solingen, drei Asphalt-Verkäufern in Hannover, zwei Hinz & Kunzt-Verkäufern in Hamburg und zwei Hempels-Verkäufern in Kiel führte.
Außer den beiden Von unge-Verkäufern in Köln arbeiteten alle meine Gesprächspartner und meine Gesprächspartnerin ausschließlich im Verkauf.
In mehreren Fällen wurde meine Bitte um ein Gespräch abgelehnt. Die Erfahrungen mit Begegnungen mit zwei Fiftyfifty-Verkäufern in Düsseldorf, einem Die Straße-Verkäufer in Hilden sowie einer Asphalt (Hannover)- und einer Hempels (Kiel)-Verkäuferin gehen ebenfalls in die folgenden Ausführungen ein.
3.2. Ergebnisse der VerkäuferInnenbefragung
3.2.1. Wohnliche und finanzielle Situation
Alle siebzehn VerkäuferInnen, mit denen ich sprach, waren arbeitslos.[188] Fünf Verkäufer waren aktuell obdachlos, weitere fünf Verkäufer und eine Verkäuferin waren obdachlos gewesen. Von diesen war ein in einem Männerwohnheim der Caritas untergebrachter Mann nach wie vor wohnungslos, drei Verkäufer und eine Verkäuferin wohnten in einem eigenen Zimmer oder in einer eigenen Wohnung. Ein erst vor kurzem aus Polen gekommener Mann wohnte bei einem "Kollegen". Drei Hannoveraner Asphalt- und ein Hamburger Hinz & Kunzt-Verkäufer waren niemals wohnungslos gewesen.[189] Ein Verkäufer machte über seine Wohnsituation keine Angaben.
Sieben Verkäufer bezogen Arbeitslosenhilfe. Mindestens drei davon hatten Anspruch auf aufstockende Sozialhilfe. Ein Asphalt-Verkäufer machte diesen Anspruch geltend, die beiden Kölner Von unge-Mitarbeiter nicht. Einer der beiden begründete dies so: "Niemand kann uns sagen, du lebst hier auf meine Kosten."[190]
Acht Personen hatten keine Lohnersatzansprüche. Der polnische Verkäufer besaß keine Arbeitserlaubnis und hatte keine Sozialhilfeansprüche. Von den restlichen sieben machten fünf ihren Anspruch auf Sozialhilfe geltend.[191] Einer gab an, lediglich 35 DM pro Woche[192] zu erhalten. Der Sozialhilfesatz für den in einem Männerwohnheim wohnenden Verkäufer geht auf den Kostenträger über. Er selbst verfügte über 30 DM Taschengeld pro Monat. Ein Sozialhilfeberechtigter gab an, seinen Anspruch nicht geltend zu machen. Ein Verkäufer machte keine Angaben über seine finanzielle Situation.
Die Mehrzahl der Verkaufenden mit denen ich sprach, waren also nicht obdachlos. Gemessen an der Armutsdefinition der EU-Kommission[193] waren jedoch fast alle arm.
3.2.2. Motive für den Zeitungsverkauf
Die Aussicht, Geld zu verdienen, war für 12 meiner 17 GesprächspartnerInnen das wichtigste Motiv für den Straßenzeitungsverkaufs. Ein Düsseldorfer fiftyfifty-Verkäufer: "Ich muß für zwei sorgen. Ich versorge meinen Hund, er bewacht mich, damit ich schlafen kann. So bilden wir eine Symbiose." Ein Düsseldorfer Kollege, der neben fiftyfifty noch den Wohnungsloser aus Essen und Nie Wo Los aus Gelsenkirchen im Angebot hatte, begründete sein Engagement so: "Ich verkaufe diese Zeitung, um meinen Lebensstandard ein Stück aufzubessern. Ich lebe im Caritas- Heim ..., trinke trotzdem noch gern mein Bier und rauche auch meine Zigarette und das kann ich mit 30 Mark Taschengeld in der Woche nicht bestreiten und deswegen bin ich dazu verpflichtet oder muß mir die Mühe eben machen, auch wenn es teilweise ein Betteln ist, diese Zeitungen zu verkaufen." Die einzige Frau, mit der ich mich ebenfalls in Düsseldorf unterhielt, bezahlt mit den Einnahmen aus dem Verkauf die Miete ihres Zimmers, die ihr vom Sozialamt nach ihren Angaben nicht bezahlt wird, solange sie nicht wenigstens ein halbes Jahr in einer Notunterkunft für obdachlose Frauen gewohnt hat. Ein Mannheimer Looser-Verkäufer verkauft, um nicht betteln oder klauen zu müssen.
Zwei Hannoveraner Asphalt-Verkäufer wollen ihre Arbeitslosenhilfe aufstocken, ein Kollege von ihnen erklärte mit Verweis auf seinen Wintermantel, er verkaufe, "daß ich mir ein paar Extras leisten kann." Ein Hamburger verkauft schlicht deshalb, um zu überleben, da er nach einem Konflikt mit dem Sozialamt nicht mehr dorthin gehen will, um seine "Stütze" abzuholen. Auch der arbeitserlaubnislose Mann aus Polen lebt zu 100 Prozent vom Straßenverkauf.[194]
Der Aspekt Arbeit scheint auf den ersten Blick unwichtiger zu sein. Lediglich ein Solinger Die Straße-Verkäufer, der "froh" war wieder "Arbeit zu haben" und ein Düsseldorfer gaben das Motiv, Arbeit zu haben, als wichtigen Grund für ihr Engagement an. Der Solinger grenzte sich dabei deutlich von nicht Zeitung verkaufenden Obdachlosen ab: "Wir sind Leute von der Straße, das ist klar, aber wir sind keine Penner. Wir arbeiten für unser Geld."
Das Thema Arbeit scheint unter einem anderen Aspekt wichtig. Dies läßt sich aus Aussagen wie "Die Leute erkennen nicht, daß das auch Arbeit ist" oder "Wir arbeiten für unser Geld" erkennen. Fünf Verkäufer machten solche oder ähnliche Aussagen. Sie berichteten von Kommentaren "normaler" Leute wie "Geh' arbeiten" oder, noch beleidigender, "Du alte Sau, geh' doch arbeiten", die an der Tagesordnung zu sein scheinen.[195] Sie sehen das Thema Arbeit vorwiegend unter dem Aspekt der Legitimation gegenüber der abhängig beschäftigten Bevölkerung. Deshalb taugt es für die Verkaufenden auch nur begrenzt zur positiven Begründung des Straßenzeitungsverkaufs.
Öffentlichkeitsarbeit über die eigene Situation zu betreiben, wurde von drei Personen als Grund für den Zeitungsverkauf genannt. Den beiden Kölner Von unge-Mitarbeitern war dies wichtig, "weil es um die Wahrheit geht", so einer der beiden. Der oben genannte Solinger, der froh ist, Arbeit zu haben, will das Thema Obdachlosigkeit publik machen: "Ich möchte den Leuten richtig helfen." Auf der anderen Seite stehen zwei nivellierende Aussagen "Das ist eine Arbeit wie jede andere" (Düsseldorf) und "Egal, ob Büro oder Zeitung verkaufen" (Kiel).
Hauptmotiv für den Straßenzeitungsverkauf ist also die mangelhafte finanzielle Ausstattung der VerkäuferInnen. Bei dem Selbsthilfeprojekt Von unge steht dagegen eher die Verbreitung des selbst mitgestalteten Blattes im Vordergrund.
3.2.3. Verdienst
Nach dem Profi-Konzept soll die Beschäftigung als StraßenzeitungsverkäuferIn zunächst dazu dienen, die eigene materielle Situation zu verbessern.[196] Mich interessierte, wieviel die VerkäuferInnen verdienen und wie lange sie dafür arbeiten müssen. Es kam mir weniger darauf an, einen Durchschnittswert zu ermitteln, was auf einer Basis von 17 Gesprächen methodisch unsinnig wäre[197], als vielmehr darauf, die Bandbreite einschätzen zu können. Wahrscheinlich habe ich tendenziell eher mit "Besserverdienenden" gesprochen, da die Wahrscheinlichkeit, einen Verkäufer oder eine Verkäuferin anzutreffen, mit der Dauer der Arbeitszeit wächst.
12 Verkäufer und eine Verkäuferin machten Angaben über ihren Verdienst. Zwei Personen gaben an, zwischen vier und fünf Stunden täglich zu verkaufen, weitere acht Personen nutzten den ganzen Tag. Ein Verkäufer wollte sich über die Länge seiner täglichen Arbeitszeit nicht äußern.[198] Eine Person arbeitet jeden Tag so lange, bis 25 Stück verkauft sind, "wenn ich dann noch Lust habe, hole ich noch ein paar mehr, ansonsten eben nicht."
Am Anfang eines Erscheinungszeitraums, der meist mit dem Anfang eines Monats zusammenfällt, können, das bestätigten mir mehrere VerkäuferInnen, wesentlich mehr Zeitungen an den Mann oder die Frau gebracht werden als am Ende. Die Sommermonate sind ebenso schlecht fürs Geschäft[199] wie kaltes oder nasses Wetter. Idealbedingungen herrschen am 1.Dezember, wenn die neue Ausgabe gerade herausgekommen ist und die Sonne bei 18 Grad Celsius vom Himmel lacht.
Die Angaben der VerkäuferInnen über die Höhe ihres Verdienstes unterscheiden sich beträchtlich. Über die Hälfte scheint jedoch, bezogen auf den Stundenlohn, eine ähnliche Größenordnung einzunehmen. Dies sind drei Personen, die in einem Zeitraum von drei bis vier Stunden 10 bis 15 DM verdienen und weitere vier die für 20 bis 30 DM den ganzen Tag benötigen. Ein Verkäufer, der täglich zehn bis zwanzig, am Monatsanfang bis zu dreißig Zeitungen zu einem Verdienst von 1,20 DM pro Stück absetzt, kann auch noch zu dieser Gruppe gezählt werden.
Zwei ganztägig arbeitende Verkäufer äußerten sich recht unbestimmt. Beide gaben an, zwischen 10 und 50 Zeitungen pro Tag abzusetzen. Eine Person verdient rund 60 DM pro Tag, ein recht genau buchführender Verkäufer kam bisher auf 350 bis 1400 DM pro Monat. Ein Verkäufer äußerte sich über seinen Verdienst erst, nachdem er mich zum wiederholten Mal aufgefordert hatte, meinen Rekorder auszuschalten. Bei sechs Verkaufstagen pro Woche nimmt er seiner Aussage nach 5000 bis 7000 DM pro Monat ein.[200]
Acht der VerkäuferInnen bekommen also einen Stundenlohn in der Größenordung von 2,50 DM bis 3,75 DM. Für die ganztägig Verkaufenden ergibt dies unter der Annahme von 20 Verkaufstagen etwa 400 bis 600.- pro Monat, für die halbtags Tätigen entsprechend die Hälfte. Für zwei Personen läßt sich kein Stundenlohn und auch kein monatlicher Durchschnittsverdienst errechnen. Drei der Befragten liegen z.T. erheblich über einem Stundenlohn von 3,75 DM.
Daß die Monatsverdienste der von mir befragten VerkäuferInnen eher überdurchschnittlich sind, zeigt ein Blick in eine von Hinz & Kunzt im Juni 1997 vorgelegte Bilanz. Von den 1570 Personen, an die ein Verkaufsausweis ausgegeben wurde, waren "rund 500 Verkäuferinnen und Verkäufer ... aktiv."[201] Da bei Hinz & Kunzt 1997 eine Mark pro verkaufter Zeitung an den Verkäufer bzw. die Verkäuferin ging, ergibt dies bei einer Auflage von 110 000 einen durchschnittlichen Verdienst von 220 DM pro Verkaufenden und Monat.[202]
Reich wird also durch den Straßenzeitungsverkauf in der Regel niemand[203]. Ein großer Teil der VerkäuferInnen dürfte pro Stunde zwei bis vier DM verdienen. Wer sich, ohne Lohnersatzleistungen, Sozialhilfe und/oder Wohngeld zu beziehen bzw. beziehen zu wollen, allein durch den Straßenverkauf finanziert, ist fast gezwungen, Platte zu machen.
Der sehr niedrige Verdienst dürfte darüber hinaus die Neigung der Verkaufenden, sich über ihre Arbeit positiv zu definieren[204], weiter abschwächen.[205]
3.2.4. Dauer der Mitarbeit
Das Profi-Konzept und die Presseerklärung der 28 Straßenzeitungen vom Oktober 1997 sieht den Straßenzeitungsverkauf als eine Stufe bzw. ein Sprungbrett " in die vom Verkäufer gewünschte Lebens- und Wohnform."[206] Mich interessierte, wie lange meine GesprächspartnerInnen bereits als StraßenzeitungsverkäuferInnen tätig waren.
12 Personen äußerten sich über die bisherige Dauer ihrer Verkaufstätigkeit. Die beiden Kölner Von unge-Mitarbeiter und ein Hamburger waren seit vier, ein Solinger und ein Hannoveraner seit drei und drei weitere Personen seit zwei Jahren dabei. Eine weitere Person verkaufte seit einem Jahr, drei erst seit ein paar Monaten.
Immerhin drei Personen, ein Hamburger, ein Hannoveraner und ein Solinger, verkaufen die Zeitung seit der ersten Ausgabe. Der Hamburger, der gerade eine Ehrenurkunde für vierjährige Verkaufstätigkeit erhalten hatte, äußerte große Frustration über die Länge seiner bisherigen Verkaufstätigkeit und sah auch keine andere Perspektive.
Der überwiegende Teil meiner GesprächspartnerInnen war also bereits länger als ein Jahr als StraßenzeitungsverkäuferIn tätig.
3.2.5. Identifikation mit dem Projekt
Arbeits- und Wohnungslose sollen durch den Verkauf einer Zeitung nicht nur Geld verdienen. Nach dem mehr oder weniger deutlich formulierten Selbstverständnis der meisten Projekte ist es "ihre" Zeitung, die sie an den Mann und an die Frau bringen.[207] Mich interessierte, inwieweit sich die Verkaufenden mit dem jeweiligen Projekt identifizierten. Mir ist dabei bewußt, daß dies eine sehr schwer meßbare Größe ist und daß sich aus der begrenzten Zahl der Gespräche keine allgemeingültige Aussage ableiten läßt.
Am stärksten erschien mir die Identifikation mit dem Projekt bei den beiden Kölner Von unge-Leuten, was sich durch ihre eigenverantwortliche Mitarbeit bei der Erstellung der Zeitung erklären läßt, und den beiden Verkäufern des Solinger Blattes Die Straße. Einer der beiden meinte zu mir: "Es ist die Zeitung von Leuten, die wohnen auf der Straße, so wie ich."
Sprachlich auffällig erschien mir, daß lediglich ein Hamburger und eine Düsseldorferin, beide im Zusammenhang mit der Zahl der Verkäufer, vom jeweiligen Projekt in der ersten Person Plural sprachen.[208] Bei diesen Personen scheint eine relativ starke Identifikation vorhanden, die sich im Falle der Düsseldorferin jedoch im Fortgang des Gespräches relativierte: "Ne, da hab' ich keinen Einfluß drauf, also, was da drin steht, ... ich les' mir die auch jedesmal durch, wenn ich die kriege, ich find'die selber eigentlich schon ganz interessant, ich würde gern auch mal irgendwie mit schreiben oder an 'nem Projekt mitmachen, aber es ist halt schwierig da ranzukommen, die[209] machen schon mal so Fotomontage und keine Ahnung irgendwelchen Krempel, aber bisher ist da bei mir nichts angekommen, es gab da schonmal paar Leute, die da irgendwie mitgemacht haben, aber eher Einzelfälle."
Außer den beiden Kölnern äußerten alle meine Gesprächspartner, noch nie etwas für die von ihnen verkaufte Zeitung geschrieben zu haben. Ein Düsseldorfer fiftyfifty-Verkäufer: "Da gibt's genug, die dafür schreiben." Ein Hannoveraner war sich gar nicht so sicher, wer die Zeitung nun eigentlich schreibt, sein Kollege aus Düsseldorf, der gleich drei verschiedene Zeitungen im Angebot führte, wußte nicht genau, welche Zeitung nun eigentlich woher stammt. Er behauptete z.B., die Gelsenkirchener Zeitung Nie Wo Los käme aus Solingen. Auch der Mannheimer Looser-Verkäufer schien mit dem Projekt nicht identifiziert. Seine Aussage "Unter Hitler wäre so etwas wie Obdachlosigkeit nicht möglich gewesen", widerspricht den Zielen des Looser. Sein Ludwigshafener Kollege, der ab und zu auch in Heidelberg verkauft und dort mit Verkäufern anderer Straßenzeitungen gelegentlich einige Exemplare austauscht, um das eigene Angebot zu erweitern, scheint sich mit jeder neue Kooperationsvariante die der Selbsthilfeförderverein Wohnen und Arbeiten eingeht, weiter von den Herausgebern zu distanzieren. Er fühlt sich von "denen" etwas verschaukelt, da er den KäuferInnen immer wieder erklären muß, warum die Zeitung jetzt schon wieder anders heißt.
Gelesen wird die Zeitung jedoch von den meisten VerkäuferInnen. Sieben Personen äußerten explizit, den Inhalt der Zeitungen zur Kenntnis zu nehmen und an dem meisten auch Gefallen zu finden, ein Kieler meinte, das allermeiste der Zeitung nicht zu lesen.
Bei den "großen" Zeitungen scheint die Identifikation mit dem Projekt geringer zu sein scheint als bei den "kleineren". Bei einer Zahl von etwa 500 Verkäuferausweisen in Düsseldorf, über 1100 in Hannover oder gar 1500 in Hamburg[210] und z.T. rigorosen Kontrollvorschriften[211] ist dies auch nicht verwunderlich. Bei Hempels Straßenmagazin, Kiel wurden inzwischen auch bereits 135 Verkäuferausweise ausgestellt, die ehemals familiäre Atmosphäre ist damit einer größeren Anonymität und Vereinzelung der in der Stadt stehenden VerkäuferInnen gewichen. Die Distanziertheit der Looser-Verkäufer von ihrem Projekt dürfte auch mit der rein geographischen Entfernung zum Erscheinungsort Michelstadt im Odenwald zusammenhängen.
3.2.6. Weitere Beobachtungen
Außer den in Punkt 3.2.1. bis 3.2.5. geschilderten Punkten, auf die es mir in meinen Gesprächen primär ankam, fielen mir einige weitere Aspekte auf.
Am auffälligsten war die geringe Zahl der als Verkäuferinnen arbeitenden Frauen. Dieses Problem scheinen die meisten Straßenzeitungen von Anfang an zu haben.[212] Von den insgesamt drei Frauen, die ich ansprach, wollten zwei nicht mit mir reden. Eine Frau verwies auf einen neben ihr verkaufenden Kollegen, während eine andere sehr verängstigt abwehrte. Die geringe Frauenquote läßt sich auch nicht aus der geringeren Zahl wohnungsloser Frauen erklären. Ein Grund dürfte sein, daß viele Männer auf der Straße stehende Frauen als Prostituierte betrachten, die man nach dieser Logik wie Freiwild behandeln kann.[213]
Einige Personen schienen unter starkem Druck zu stehen. Zwei Düsseldorfer fiftyfifty-Verkäufer und ein Hildener Mann von Die Straße lehnten meine Bitte um ein Gespräch ab, um keine Verkaufszeit zu verlieren. "Ich bin sehr unter Druck", meinte einer von ihnen, "ich muß unbedingt meine Zeitungen noch loswerden. Ich habe keinen Pfennig in der Tasche." Die beiden Hamburger baten mich, das Gespräch möglichst kurz zu halten, um bald weiterverkaufen zu können. Besonders einer der beiden, der sich allein durch den Zeitungsverkauf über Wasser hält, meinte, es sei sehr schwer über die Runden zu kommen, auch wenn er sich Anfang des Monats die eine oder andere Mark zurücklegen könne.
Insbesondere in Düsseldorf fiel mir eine sehr starke Konkurrenz zwischen den Verkaufenden auf. "Es sind eigentlich viel zu viele", meinte eine Verkäuferin. "Wenn die Zeitung rauskommt", so sagte einer ihrer Kollegen, "dann stehen die alle fünf Meter gestaffelt, da mußt du durch dann, das find' ich nicht gut, die sind dann aufdringlich, das find ich nicht gut." Mit "die" meinte er "Punks und so, ich muß das jetzt doch sagen, die holen sich das Zeug nur, damit sie abends hier ... , weißt du, was ich meine, also spritzen." In diesem Gespräch zeigten sich Probleme, die sich aus der Ausdifferenzierung der Obdachlosen in sehr verschiedene Gruppen ergeben. Mein Gesprächspartner, eher ein "klassischer" einzelgängerischer Obdachloser, äußerte tiefes Mißtrauen gegenüber jüngeren KollegInnen aus der Punk- und der Junkieszene.[214] Ein Kieler Mann von Hempels Straßenmagazin berichtete von Rivalitäten mit anderen Verkäufern um die Standplätze. Diese Probleme haben Projekte, die die Standplätze zuteilen[215] oder auslosen[216] nicht. Dort ergibt sich jedoch ein anderes Problem. Ob man in einer Straße in einem abgelegenen Teil der Innenstadt einer von mehreren VerkäuferInnen ist oder allein z.B. in einem akademisch geprägten Vorort steht, wirkt sich erheblich auf den Verdienst aus. Dieses Problem äußerte einer der Hamburger Verkäufer. Seiner Ansicht nach gibt es zwei entscheidende Kriterien, nach denen die Käufer "ihren" Verkäufer bzw. "ihre" Verkäuferin auswählen. Es ist eine "Sympathiefrage und eine Frage des Standorts".
In Solingen wurde ich Zeuge eines sehr kooperativen Verkaufs. Drei Personen hatten eine Einkaufspassage unter sich aufgeteilt und verkauften die Zeitungen, die sie zusammen in einer Tasche lagerten, gemeinschaftlich. Sprachen sie von anderen Verkäufern, redeten sie immer von "Kollegen".[217] Auch der Mannheimer Looser-Verkäufer arbeitete mit einem anderen Verkäufer zusammen. Hier war ebensowenig eine Konkurrenz zu spüren wie bei ihrem Kollegen auf der anderen Rheinseite. Dies dürfte daran liegen, daß in Mannheim lediglich drei oder vier, in Ludwigshafen sogar nur ein, manchmal zwei, Straßenzeitungsverkäufer tätig sind. Beim Gros der Verkaufenden herrschte meinem Eindruck nach jedoch eine Einzelkämpfermentalität vor.[218] "Mit Kollegen gebe ich mich nicht ab. Ich verkaufe meine Zeitung. Das wars dann", meinte z.B. ein Hannoveraner.
Auffällig viele Verkäufer waren schwerbehindert. Ohne daß ich dieses Thema angesprochen hätte, gaben vier Verkäufer an schwerbehindert zu sein. Ein weiterer, der im Sitzen verkaufte und nur ganz schwer gehen konnte, dürfte auch zu dieser Personengruppe gehören. Schwerbehinderte sind eine der am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffenen Gruppen. Obwohl die gesetzlich vorgeschriebene Beschäftigungsquote für Schwerbehinderte bei sechs Prozent liegt, sind faktisch lediglich 3,9% aller ArbeitnehmerInnen schwerbehindert. Die Arbeitslosigkeit dieser Gruppe liegt mit 18% etwa 50% über dem Durchschnitt.[219] Ihre Chance, Arbeit zu bekommen, ist also noch geringer als die nicht behinderter Arbeitsloser.[220] Ein 39jähriger Verkäufer brachte seine Problematik auf den Punkt: "ABS ist abgelehnt vom Arbeitsamt, ich bin zu alt, 35 haben sie mir gesagt ist Feierabend, vorbei, seitdem bin ich hier nur am Zeitungen verkaufen, ein bißchen Beschäftigung muß ja sein, ich kann ja nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen und mir die Decke auf den Kopf fallen lassen."
3.3. Zwischenbilanz
Meinem Eindruck nach entspricht der Ansatz des Profi-Konzepts, den Verkauf in den Mittelpunkt der Hilfe zur Selbsthilfe zu stellen[221], dem Bedürfnis der meisten Verkaufenden, die nach der Definition der EU-Kommission in ihrer Mehrzahl unter der Armutsgrenze[222] leben. Das für die meisten bitter nötige Geld ist jedoch bei einem sehr schlechten Stundenlohn hart verdient.
Die meisten StraßenzeitungsverkäuferInnen sind von dem Leitbild der Erwerbsarbeit[223] geprägt, obwohl sie aufgrund dieses Leitbildes zu den Geächteten gehörten und zum Teil nach wie vor gehören. Der i.d.R. durch den Straßenzeitungsverkauf erzielte geringe Lohn dürfte also bei vielen eher zu einer Geringschätzung der eigenen Arbeit führen. Demgegenüber ist unbestritten, daß der Schritt hin zur Verkaufstätigkeit für Menschen, die vorher bettelten, in der Regel mit einem Gewinn an Selbstbewußtsein einhergeht.[224] Unter der Prämisse, daß eine gute Bezahlung die beste Anerkennung für die geleistete Arbeit ist[225], und unter dem Eindruck von Pöbeleien bis hin zu tätlichen Übergriffen stellt sich jedoch die Frage, ob dieses neu gewonnene Selbstvertrauen im Laufe der z.T. schon Jahre andauernden Tätigkeit weiter wächst oder ob nicht auf Dauer die Frustration überwiegt.
Die meist langzeitarbeitslosen und im Verhältnis zur restlichen Bevölkerung im Durchschnitt schlechter ausgebildeten Verkäuferinnen und Verkäufer haben auf dem ersten Arbeitsmarkt nur geringe Chancen[226]. Aufgrund eines wachsenden Bewußtseins, Krankheit oder Behinderung sei in der Eigenverantwortung des einzelnen begründet und nicht mehr durch die -ursprünglich positiv begründete, inzwischen von vielen als Zwang erlebte - Solidargemeinschaft mitzutragen, gilt dies auch für die schwerbehinderten VerkäuferInnen. Ein "Sprungbrett in die vom Verkäufer gewünschte Lebens- und Wohnform"[227] kann der Straßenzeitungsverkauf also nur für die wenigsten sein.
Meinem Eindruck nach schätzt dies die Mehrzahl der Verkaufenden auch durchaus realistisch ein. Der Berliner motz-Verkäufer Bernd spricht sicher einigen aus dem Herzen, wenn er schreibt: "Ich habs mir nicht ausgesucht, ich muß den Job machen, um zu überleben."[228] Auch die Projekte selbst bestätigen, daß der Übergang vom Zeitungsverkauf in den ersten Arbeitsmarkt die große Ausnahme darstellt. Bei Hinz & Kunzt beispielsweise haben von den etwa 1600 InhaberInnen eines Verkaufsausweises lediglich 59 wieder einen festen Arbeitsplatz gefunden[229], über Trott-war, Stuttgart mit "derzeit 348 registrierten Verkäufern" wurden sieben Langzeitarbeitslose in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt.[230]
Ein Problem der allermeisten Straßenzeitungen bleibt die geringe Beschäftigungsquote von Frauen.[231] Sie werden sich der Frage stellen müssen, ob es neben der sicherlich berechtigten Furcht vor über die "üblichen" Pöbeleien hinausgehenden frauenspezifischen Diskriminierungen auch konzeptionelle Schwachstellen gibt, die Frauen den Zugang zum Straßenzeitungsverkauf unmöglich machen oder zumindest erschweren.
4. Probleme von Straßenzeitungen und ihre Auswirkungen
4.1. Probleme von Straßenzeitungen
Straßenzeitungen müssen sich wie jedes andere Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland auch am Markt behaupten, um existieren zu können. Mit Ausnahme von Platte, Bingen und statt park, Essen müssen die Kosten für die Erstellung, den Druck und den Vertrieb wieder eingenommen werden, um weiterarbeiten zu können.
Nachdem, inspiriert durch den großen Erfolg von Hinz & Kunzt in Hamburg, in den Jahren 1994 und 1995 Straßenzeitungsprojekte wie Pilze aus dem Boden schossen, ist die Phase der Euphorie vorbei. Man hat sich an das neue, am Anfang überschwänglich gefeierte Produkt "Straßenzeitung"[232] gewöhnt. Von steigenden Auflagezahlen wird nur noch vereinzelt wie z.B. bei Hempels Straßenmagazin in Kiel oder beim Michelstädter Looser berichtet. Bei einigen Projekten ging der Absatz sogar zurück. Hinz & Kunzt beispielsweise hat zeitweise 180 000 Zeitungen pro Monat verkauft[233] und hatte sich 1997 auf einem Monatschnitt von 110 000 Exemplaren eingependelt. Auch die Kölner Blätter Bank Extra und Von unge waren schon einmal wesentlich erfolgreicher.[234] Die Zeitung Asphalt aus Hannover, die zeitweise, bezogen auf die Einwohnerzahl, die meisten Exemplare verkaufen konnte, hat im Oktober 1997 nach Aussage von Hempels Straßenmagazin "sozusagen ihre Pleite erklärt", weil die verkaufte Auflage "dramatisch zurückgegangen" sei. Außerdem sind dort die nach AFG geförderten Stellen, ebenso wie bei Trott-war in Stuttgart, nach und nach ausgelaufen.
So oder so ähnlich geht es vielen Straßenzeitungsprojekten. Die meisten haben inzwischen finanzielle Sorgen.[235] Die beiden wichtigsten Gründe sind folgende:
- Sobald vom Projekt selbst zu bezahlende MitarbeiterInnen angestellt sind, besteht der Druck, eine hohe Auflage zu verkaufen. Geht die Auflage zurück, ist das Projekt in Gefahr. Ist die Förderungszeit einer nach AFG oder nach BSHG bezahlten Person, die das Projekt gerne übernehmen würde, abgelaufen, muß die Auflage in der Regel gesteigert werden.
Solche Probleme haben die meisten nach dem Profi-Konzept arbeitenden Straßenzeitungen. Auch der von Ehrenamtlichen erstellte Straßenkreuzer aus Nürnberg oder das Berliner Selbsthilfeprojekt Strassenfeger, die beide je eine(n) Hauptamtliche(n) angestellt haben, können sich einen Einbruch der Auflage nicht erlauben. - Projekte mit sehr geringer Auflage haben dagegen das Problem hoher Druckkosten. Bank Extra, Köln z.B. mußte für den Druck des in einer Auflage von 3000 produzierten Heftes Oktober/November 1997 3400.- bezahlen. Damit waren schon die Druckkosten höher als der aus dem Verkauf an das Projekt zurückfließende Betrag.[236] Auch Signal aus Marl konnte die Druckkosten seiner 2000 Stück zählenden Erstausgabe nicht durch den Straßenverkauf erwirtschaften.
Projekte, die ohne selbst zu bezahlende MitarbeiterInnen eine Auflage von etwa 10 000 Exemplaren oder mehr verkaufen, wie z.B. Abseits, Osnabrück, Looser, Michelstadt oder Jedermann; Streetworker, Darmstadt, scheinen keine finanziellen Probleme zu haben. Eine Ausnahme stellt hier die Zeitung Von unge aus Köln dar, die viele tausend Mark Schulden hat. Dies dürfte an dem im Verhältnis zu allen anderen Straßenzeitungen sehr niedrigen Verkaufspreis von 1,40 Mark liegen.
Im folgenden wird dargestellt, wie sich die finanziellen Probleme der meisten Projekte auf
- die einzelnen Projekte (mit Schwerpunkt auf den Verkaufenden)
- das Verhältnis der Projekte untereinander
auswirken.
4.2. Auswirkungen
4.2.1. Auswirkungen auf die einzelnen Projekte
Die Auswirkungen finanzieller Schwierigkeiten auf die einzelnen Projekte lassen sich analog zu ihren Gründen ebenfalls in zwei Gruppen einordnen:
1. Die nach dem Profi-Konzept arbeitenden Straßenzeitungen mit hauptamtlich angestellten MitarbeiterInnen ziehen relativ viele VerkäuferInnen an. Da der Druck, eine möglichst große Auflage zu verkaufen, hoch ist, wird kräftig geworben, um Verkaufende zu gewinnen. Hinz & Kunzt z.B. hat einen kleinen Werbeprospekt mit dem Titel "Wir brauchen Verkäufer" erstellt. Obwohl das Projekt finanziell im Verhältnis zu anderen recht gut dasteht, wächst im Sommer, wenn weniger Zeitungen abgesetzt werden können, regelmäßig die Sorge, ob sich der Einbruch in Grenzen hält und sich die Auflage im Herbst wieder erholt. Um dies zu verhindern müssen "alle Vertriebsplätze ausgenutzt" werden.[237] Auf dem gesamten potentiellen Absatzmarkt müssen möglichst flächendeckend und ganztägig VerkäuferInnen präsent sein, damit das Produkt bekannt bleibt und möglichst bequem zu erwerben ist. Für neu zu dem Projekt stoßende VerkäuferInnen ergibt sich jedoch die Schwierigkeit, daß die Top-Plätze längst vergeben sind. Wer Pech hat und einen unattraktiven Standort erwischt, kann dort zwar zum Nutzen des Projekts einige Zeitungen absetzen, wird jedoch einen noch geringeren Lohn als die KollegInnen erhalten.
Die Folgen eines Rückgangs der Auflage spüren am unmittelbarsten die VerkäuferInnen. Als z.B. die Auflage bei Hinz & Kunzt von 180 000 auf 110 000 pro Monat sank, bedeutete dies, eine konstante Verkäuferzahl und den Verkauf der gesamten Auflage vorausgesetzt, einen durchschnittlichen Einnahmerückgang von über 60 Prozent pro Person. Die Verkaufenden sind faktisch freie ein Kleingewerbe betreibende UnternehmerInnen, man könnte auch kritischer sagen, sie sind scheinselbständig.[238] Ihr Verdienst hängt nicht nur von der Zeit ab, die in den Verkauf investiert wird, sondern auch von anderen Faktoren wie z.B. der Attraktivität des Standorts[239], der Erscheinung des Verkäufers bzw. der Verkäuferin sowie der Zahl der KollegInnen, die objektiv und für viele auch subjektiv[240] KonkurrentInnen sind.
Die "festangestellten" JournalistInnen, SozialarbeiterInnen und "Betroffenen" spüren die Folgen eines Auflagenrückgangs vom finanziellen Gesichtspunkt her betrachtet nur mittelbar. Das Ungleichgewicht zwischen ihnen und den Verkaufenden wächst dadurch noch mehr.[241] ABM- bzw. BSHG-Beschäftigte sind jedoch ebenfalls unter Druck. Nach Ende der maximal drei Jahre dauernden Förderungszeit müssen sich diese Stellen selbst tragen. Ist dies nicht der Fall, muß die betreffende Mitarbeiterin bzw. der betreffende Mitarbeiter entlassen werden. "Geförderte" MitarbeiterInnen sind also existentiell von einem Wachstum des Projekts abhängig. Eine solche Abhängigkeit steht jedoch in Spannung zu der ursprünglichen Aufgabe vieler Straßenzeitungen, die die "betroffenen" VerkäuferInnen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt hatten. Vom Standpunkt eines Journalisten oder einer Journalistin mit der Angst um den eigenen Arbeitsplatz im Nacken müssen möglichst viele VerkäuferInnen möglichst lange in der Stadt stehen, um Mark für Mark ihr bzw. sein Gehalt zu sichern. Ist der Arbeitsplatz des Journalisten / der Journalistin nicht vom Projekt selbst finanzierbar, wie dies z.B. bei Die Straße in Solingen der Fall ist242] , stehen die betreffenden Personen unter dem Druck, die "geförderte" Zeit zu nutzen, um für den ersten Arbeitsmarkt interessant zu werden. Vom Standpunkt eines Journalisten bzw. einer Journalistin bedeutet dies, gut recherchierte Artikel zu schreiben, unter denen der eigene Name steht, um dadurch einen der begehrten und knappen Arbeitsplätze bei den (Print)- Medien zu erhalten. Ob auf diesem Hintergrund Zeit bleibt, mit "Betroffenen" zusammen zu recherchieren, und diese beim Schreiben zu unterstützen und ob ein Interesse besteht, ihnen mehr als zwei oder drei "Klartext"- oder "Spitze Feder"- Seiten[243] zur Verfügung zu stellen, ist auf diesem Hintergrund fraglich.
Ein Punkt, der bei der Debatte um die Finanzierung von Straßenzeitungen in den Mittelpunkt gerückt ist, ist das Thema Werbung.[244] Werbeeinnahmen können die Projekte stützen. Selbst eine hohe Auflage ist jedoch keine Garantie für ein gutes Anzeigengeschäft. "Unsere Kunden sind nicht obdachlos", hört z.B. fiftyfifty immer wieder als Begründung der Geschäftswelt für das Desinteresse an der Schaltung von Anzeigen. "Daß die meisten Leser von fiftyfifty (bei einer Auflage von über 40 000) auch nicht obdachlos sind", reicht als Gegenargument offensichtlich nicht aus, um potentielle AnzeigenkundInnen vom Nutzen einer Anzeige zu überzeugen.[245] Manche Geschäftsleute sehen in den VerkäuferInnen der "Pennerblätter" auch eine unliebsame Konkurrenz, die durch die öffentliche Zurschaustellung ihrer Situation potentiellen KundInnen die Kauflaune zu verderben drohen. Deshalb werden auch immer wieder VerkäuferInnen von privat angestellten Sicherheitsdiensten verjagt.[246]
Ist man auf Werbung existentiell angewiesen, kann die inhaltliche Unabhängigkeit gefährdet werden. Die Warnung Erhard Epplers gilt sicherlich auch für Straßenzeitungen: "Seit Zeitungen Anzeigen publizieren und sich immer mehr auch dadurch finanzieren, werden sie aus Sprachrohren kritischer Citoyens zu wirtschaftlichen Unternehmen. Wer Spalten für Werbung möglichst teuer verkaufen will, muß um hohe Auflagen konkurrieren. Also muß er anbieten, was das »konsumierende Publikum« wünscht."[247]
Erfolgreiche Akquisition von WerbekundInnen setzt in jedem Fall eine passable Außenwirkung des Projekts voraus. Die in der Stadt stehenden VerkäuferInnen dürfen auch nicht zu abgerissen aussehen oder gar Alkohol oder andere Drogen zu sich genommen haben. Deshalb kontrollieren manche Projekte ihre VerkäuferInnen.
2. Straßenzeitungen mit sehr geringer Auflage haben für die Verkaufenden den Nachteil, in "ihrer" Stadt sehr wenig bekannt zu sein. Ich hatte z.B. den Eindruck, daß in Köln kaum jemand Bank Extra kennt. Sogar in Solingen, wo Die Straße immerhin monatlich mit einer Auflage von 10 000 Exemplaren verkauft wird, mußte ich einige Leute fragen, bis mir schließlich ein Mann darüber Auskunft geben konnte, wo die Straßenzeitungsverkäufer ihren Standort haben. Deshalb dürfte das Mißtrauen der Bevölkerung gegenüber den Verkaufenden "kleiner" Zeitungen eher größer, die Bereitschaft zum Zeitungskauf eher geringer sein. Bedingt durch oft längere Zeiträume zwischen dem Erscheinen der einzelnen Ausgaben ist es für die Verkaufenden auch schwieriger, eine einigermaßen konstante Einnahme durch den Zeitungsverkauf zu erzielen. Beinahe unmöglich ist dies bei unregelmäßig erscheinenden Blättern wie Nie Wo Los in Gelsenkirchen.
Einige Projekte, wie z.B. Bank Extra in Köln versuchen ihre Auflage durch eine Professionalisierung zu steigern. Die Kölner hatten einen Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr für die redaktionelle Arbeit angestellt. Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter machte ein professionelles Layout. Trotzdem ließ sich, anders als z.B. bei Hempels Straßenmagazin in Kiel, die Auflage bisher nicht steigern. Die professioneller gemachte Zeitung ließ sich mangels VerkäuferInnen nicht besser absetzen. Bei meinem Besuch in der Redaktionssitzung im Dezember 1997 stand die Frage im Raum: "Haben wir die Basis verloren?"
Sowohl die ganz großen, nach dem Profi-Konzept arbeitenden Blättern als auch sehr kleine Projekte brauchen also VerkäuferInnen, die einen, um alle Verkaufsplätze auszunutzen, die anderen, um überhaupt erst einmal bekannt zu werden und sich einen Leserkreis zu erschließen. Auf diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Wer braucht eigentlich primär wen? Brauchen die VerkäuferInnen die Projekte, die in wesentlich geringerem Maße als konzeptionell vorgesehen als Sprungbrett oder als Sprachrohr dienen, oder die Projekte die VerkäuferInnen, um weiterexistieren zu können?
4.2.2. Auswirkungen auf das Verhältnis der Projekte untereinander
1995, als sich viele Straßenzeitungsprojekte noch in der Wachstumsphase befanden, wurde auf dem ersten Treffen der Straßenzeitungen in Loccum das "Loccumer Abkommen" beschlossen. Hierin verpflichteten sich sämtliche 21 anwesenden Projekte, auf einem schon von einem anderen Projekt besetzten Markt keine Zeitungen zu verkaufen und auf in Gründung befindliche Projekte Rücksicht zu nehmen.[248] Als der Michelstädter Looser aus dieser Selbstverpflichtung ausscherte, wurde er 1996 vom 2. Straßenzeitungstreffen ausgeschlossen. Inzwischen machen jedoch auch weitere Projekte Anstalten, sich nicht mehr an das Loccumer Abkommen zu halten. Eine Vorreiterrolle hat hier die Hannoversche Zeitung Asphalt übernommen, die aufgrund großer finanzieller Schwierigkeiten gerne in die zweitgrößte niedersächsische Stadt Braunschweig expandieren möchte. Dort existiert jedoch bereits die von der "Selbsthilfegruppe ehemaliger Wohnungsloser" herausgegebene Zeitung Parkbank, die in einer Auflage von 2500 Exemplaren erscheint.[249] Asphalt will seine Expansionspläne von kleinen und kleinsten "»Auch-Straßenmagazine[n]«, die manchmal nur im Kopierverfahren hergestellt werden" nicht mehr länger blockieren lassen, mit der Begründung, dies könne "für größere Zeitungsprojekte wirtschaftliche Schwierigkeiten nach sich ziehen, wenn sie - wie das Asphalt-Magazin - vom Konzept her auf wirtschaftliche Rentabilität angelegt sind und auf öffentliche Gelder verzichten möchten."[250] Die Zeitung Parkbank ist mir nicht bekannt, es ist jedoch wahrscheinlich, daß Asphalt professioneller gemacht ist und deshalb aufgrund des vermeintlich besseren Preis-Leistungs-Verhältnisses das Selbsthilfeprojekt vom Markt verdrängen kann. Vielleicht wird den Braunschweigern auch angeboten, neben Lüneburg und Celle eine weitere Lokalredaktion von Asphalt zu betreiben. In beiden Fällen hätte jedoch die Braunschweiger Selbsthilfegruppe einen erheblichen Verlust an Autonomie zu beklagen.
Zu einer ähnlichen Entwicklung könnte es in Baden-Württemberg kommen. Trott-war, das früher noch den Beinamen "Die Straßenzeitung in der Region Stuttgart" führte und inzwischen unter "Die Straßenzeitung im Südwesten" firmiert, hat sich Richtung Südosten bis Ulm ausgedehnt und denkt nun über eine Expansion in die badischen Städte Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg und Freiburg nach.[251] Ob eine Einigung mit dem Ulmer Projekt Arbeit & Soziales zustande gekommen ist, ist mir nicht bekannt. Fraglich ist, ob sich das von einem ehemaligen Obdachlosen gegründete Selbsthilfeprojekt Heidelberger Rundschlag der neuen Konkurrenz aus Stuttgart wird erwehren können. Sollte Trott-war seinen Plan verwirklichen und in Heidelberg verkaufen, ergäbe sich dort eine sehr unübersichtliche Situation. In einer Stadt mit etwa 160 000 EinwohnerInnen gäbe es dann mit den beiden Darmstädter Zeitungen Jedermann und Streetworker, dem Michelstädter Looser[252], dem Heidelberger Rundschlag und Trott-war nicht weniger als fünf verschiedene Straßenzeitungen zu kaufen.
Hempels Straßenmagazin aus Kiel hält sich bislang an das Loccumer Abkommen. Ziel des expandierenden Projekts, das Ende 1997 die erste Lokalredaktion in Flensburg eröffnete[253], ist es, eine Straßenzeitung für ganz Schleswig-Holstein herauszubringen. Um diesem Ziel näher zu kommen, will Hempels mit Bessere Zeiten aus Lübeck und Die Jerusalämmer aus Neumünster kooperieren. Beide Projekte stehen jedoch einer Kooperation bisher eher ablehnend gegenüber. Bei meinem Besuch im Vertrieb von Hempels im Dezember 1997 hatte ich den Eindruck, daß ein damals anstehendes Gespräch mit dem Projekt aus Neumünster aus der Position des Stärkeren geführt werden soll. Kommt keine Einigung zustande, wäre eine eventuelle Expansion nach Neumünster "moralisch" sicher deshalb leichter zu verantworten, da sich die Herausgeber der Jerusalämmer aus Kieler Sicht nicht korrekt verhalten.[254]
Da darüber hinaus der Michelstädter Looser die Konfrontation sucht[255] und Jedermann; Streetworker, Darmstadt die Konferenzen der Straßenzeitungen gar nicht besucht und demnach dem Loccumer Abkommen auch nicht beigetreten ist, ist das Loccumer Abkommen gefährdet. Während Asphalt, Hannover und Trott-war, Stuttgart finanzielle Sachzwänge als Grund für ihr Expansionsstreben angeben, scheinen beim Michelstädter Looser und bei Jedermann; Streetworker keine Skrupel, andere Projekte eventuell zu gefährden, zu bestehen. Der Grund dürfte die Überzeugung sein, die einzig richtige Konzeption zu besitzen.
Im dichtbesiedelten Ballungsraum Köln/Düsseldorf/Ruhrgebiet kommt es aus einem anderen Grund zu Konkurrenzsituationen, auch wenn dies konzeptionell nicht gewollt ist. In einem Umkreis von nicht einmal 100 Kilometer sind dort insgesamt neun Straßenzeitungsprojekte mit einer Gesamtauflage von über 100 000 Exemplaren pro Monat ansässig. Dazu kommt die Essener Lokalredaktion des Michelstädter Loosers. Begünstigt durch ein gut ausgebautes Nahverkehrssystem mit recht günstigen Preisen können VerkäuferInnen ihre Zeitungen mühelos auch in anderen Städten verkaufen. So wird z.B. der Essener Wohnungsloser in Gelsenkirchen ebenso angeboten wie BODO, Bochum; Dortmund. In Gelsenkirchen berichtete mir ein Sozialarbeiter des Weißen Hauses von erheblichen Problemen, die ein Verkäufer des dortigen Blattes Nie Wo Los mit einem Konkurrenten aus Essen hatte, der ihn am Zeitungsverkauf gehindert haben soll.
Das Ende des Wachstums führt also auf zwei Ebenen zu Konkurrenzsituationen. Auf der Suche nach neuen Märkten versuchen expandierende Straßenzeitungsprojekte in attraktiv erscheinenden Städten ansässige kleinere Projekte zur Kooperation zu bewegen oder gar zu schlucken, auf der Suche nach neuen Verkaufsplätzen fahren VerkäuferInnen in angrenzende Städte, um dort ohne Rücksicht auf VerkäuferInnen des dort ansässigen Blattes ihre Zeitungen abzusetzen. Auf beiden Ebenen scheinen sich im Normalfall größere, auflagenstärkere Zeitungen durchzusetzen.[256] Ist es nicht grotesk, wenn ein Straßenzeitungsprojekt zum Wohl der "eigenen" VerkäuferInnen andere Projekte vom Markt zu verdrängen sucht? Hat es jedoch nicht auch eine innere Logik, wenn sich marktwirtschaftliche Prinzipien auch auf Sozialprojekte auswirken?
5. Straßenzeitungen in der Bundesrepublik Deutschland - Chancen und Grenzen
Straßenzeitungen sind inzwischen aus den meisten bundesdeutschen Großstädten nicht mehr wegzudenken. Sie haben sich etabliert und einen guten Ruf erworben. Sie wollen ernst genommen werden und werden auch ernst genommen.
Aus finanzieller Sicht existentielle Fragen[257] lassen eine Zielüberprüfung immer wieder in den Hintergrund rücken. In diesem Kapitel soll eine solche Zielüberprüfung versucht werden. Die in Punkt 2 dieser Arbeit dargestellten verschiedenen Konzeptionen werden mit der in Punkt 3 und in Punkt 4 behandelten Realität verglichen, um Chancen und Grenzen der verschiedenen Konzepte aufzuzeigen.
5.1. Das Profi-Konzept
Nach dem Profi-Konzept hergestellte Zeitungen haben in der Regel eine sehr große Resonanz in der Bevölkerung. Bis zu einem Zehntel der EinwohnerInnen der Stadt, in der die Projekte ihren Hauptsitz haben, kaufen eine Straßenzeitung.[258] Selbst unter der Prämisse, daß 70 Prozent der gekauften Zeitungen weggeworfen werden[259] und daß für viele KäuferInnen weniger der Inhalt als vielmehr das Helfermotiv handlungsleitend ist[260], haben große Straßenzeitungen eine große bewußtseinsbildende Macht. Wie kann diese Macht für die "Betroffenen" am besten genutzt werden?
JournalistInnen großer, nach dem Profi-Konzept arbeitender, Straßenzeitungen gelten auf lokaler Ebene als ExpertInnen für die Bearbeitung sozialer Themen.[261] Ihre Stimme hat im sozialpolitischen Diskurs vor Ort Gewicht. Diese von den konventionellen Printmedien nicht ausfüllbare Marktlücke gilt es m.E. konsequent zu füllen und schwerpunktmäßig soziale Themen der betreffenden Region oder Stadt zu behandeln, wie z.B. die in kommunaler Verantwortung liegende Umsetzung des Bundessozialhilfegesetzes. Trott-war ist z.B., obwohl es im Verhältnis zu Hinz & Kunzt, Hamburg oder Asphalt, Hannover relativ viele soziale Themen behandelt, nach Einschätzung eines Mitglieds in Anbetracht des gegenwärtig in Stuttgart stattfindenden Sozialabbaus viel zu zurückhaltend.
Nach dem Profi-Konzept arbeitende Zeitungen können offensichtlich ohne Werbeeinkommen nicht auskommen. Ob man sich allerdings vor potentiellen Werbekunden aus Industrie, Handwerk und Handel verbeugen sollte, ist sehr genau abzuwägen. Eine Konzentration auf soziale Einrichtungen und Kulturschaffende führt vielleicht weiter. Wie attraktiv eine Anzeige sein kann, zeigt z.B. die Tatsache, daß der Caritasverband in Stuttgart durch eine einzige Werbeanzeige für 2800 DM in Trott-war fast 200 000 DM an Spenden erhalten hat.[262]
Der Erlös aus dem Straßenzeitungsverkauf sollte als das benannt werden, was er ist: ein -für arme Menschen sehr notwendiges - Zubrot, das zu einem geringen Stundenlohn verdient wird. Hochfliegende Pläne, VerkäuferInnen durch den Straßenzeitungsverkauf von der Sozialhilfe unabhängig zu machen[263], sind in einer Zeit, in der der Rechtsanspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt zur Disposition steht, kontraproduktiv. Wenn ein anspruchsberechtigter Mensch entscheidet, von der Sozialhilfe unabhängig leben zu wollen, ist das seine Sache. Ein Straßenzeitungsprojekt, das sich den Einsatz für die Armen auf die Fahnen geschrieben hat, sollte dies aber nicht konzeptionell unterstützen und eine möglichst hohe Quote an VerkäuferInnen erreichen wollen, die allein vom Verkauf einer Straßenzeitung leben.[264]
Eine konzeptionelle Rückbesinnung auf das Wohl der "Betroffenen" muß diese ernster nehmen. Einer Zwei-Klassen-Gesellschaft, wie sie sich bei manchen Projekten sprachlich verrät, ist entgegenzusteuern. So findet sich z.B. in einigen Konzeptionen die Unterscheidung zwischen "Mitarbeitern" und "Verkäufern".[265] Formulierungen, die den Verdienst durch den Straßenzeitungsverkauf in die Nähe einer Gnadengabe rücken[266], sind auf die dahinterliegende Gesinnung kritisch zu überprüfen. Auch die bei BISS, München, Hinz & Kunzt, Hamburg und Trott-war, Stuttgart vorgenommene Trennung zwischen den von den "Profis" geschriebenen Artikeln und den Verkäuferrubriken "Klartext", "Forum" oder "Spitze Feder" ist zu hinterfragen. Bildet sich hier nicht eine Apartheid aus "wir" und "die" ab? Lernen könnte man hier von fiftyfifty, das eine solche Trennung nicht vornimmt oder vom Strassenfeger aus Berlin, der eine solche Extrarubrik wieder abgeschafft hat. Auch die z.T. rigorose Sprache, mit der die Kontrolle der Einhaltung der Verkäuferregeln beschrieben wird, müßte überprüft werden.[267]
Auch eine Zwei-Klassen-Gesellschaft aus Redaktion und Vertrieb ist zu vermeiden. Der Vertrieb ist bei Straßenzeitungen mit einer Auflage von mehreren Zigtausend pro Monat genau so wichtig wie die Redaktion. Im Sinne der Gleichbehandlung müßten, wenn man sich einmal entschieden hat, mit professionellem Personal zu arbeiten, auch die VertriebsmitarbeiterInnen, meist ehemalige Wohnungs- oder Langzeitarbeitslose, mit unbefristeten, vollbezahlten Arbeitsverträgen ausgestattet werden. Ist dies nicht finanzierbar, müßten die "geförderten" Stellen gleichmäßig auf Redaktion und Vertrieb verteilt werden. Arbeitet man mit nach §19 BSHG angestellten Personen, ist man ihnen gegenüber nach der Intention des Gesetzes verpflichtet, sie für den ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren, was in Spannung zu dem Eigeninteresse der Projekte steht. Bei Trott-war, Stuttgart z.B. ist man meinem Eindruck[268] nach daran interessiert, qualifizierte BSHG-Mitarbeiter zu behalten, um eine Kontinuität der Arbeit im Vertrieb zu gewährleisten.
Ein großes Plus vieler nach dem Profi-Konzept arbeitenden Straßenzeitungen ist das Vorhandensein eines Sozialdienstes. Haben VerkäuferInnen erst einmal Vertrauen zu dem Projekt gefaßt, ist es sicherlich leichter, individuelle Probleme mithilfe der SozialarbeiterInnen des Projekts anzugehen, als zu einer fremden Institution zu gehen. Durch den Bekanntheitsgrad und den guten Ruf, den sich die meisten Projekte erworben haben, ist es in vielen Fällen möglich, das dringlichste Problem vieler VerkäuferInnen, das Fehlen einer Wohnung, zu lösen. Bei Trott-war in Stuttgart z.B. bekommen alle VerkäuferInnen innerhalb weniger Wochen eine Wohnung angeboten.
Der Umgang mit der etablierten Wohnungslosenhilfe darf nicht von Konkurrenz um Ansehen, Spenden, BSHG-Stellen etc. geprägt sein. Schließlich ist die Zielsetzung der professionellen Wohnungslosenhilfe der Zielsetzung von Straßenzeitungsprojekten sehr ähnlich.[269] Eine latente Konkurrenz ist fast nicht auszuschließen, da viele Dienste der Wohnungslosenhilfe auf Spenden angewiesen sind, "so wie kein Zeitungsprojekt ohne Spenden auskommt."[270] Man muß sich dieser Konkurrenz jedoch bewußt sein. Ein beim Straßenzeitungsprojekt angesiedelter Sozialdienst macht durchaus Sinn, man sollte aber mit dem Aufbau von Parallelstrukturen zu bereits bestehenden Fachdiensten vorsichtig sein. Die Frontlinie verläuft nicht zwischen den verschiedenen Anbietern im Bereich der Wohnungs- und Arbeitslosenhilfe. Sie verläuft eher zwischen armen Menschen, für die alle Anbieter gleichermaßen Lobby sein wollen, und den Kommunen. Da die Kommunen zum Teil von der Bundesgesetzgebung hart betroffen werden, verläuft sie auch manchmal, wie z.B. bei der Frage des Wohngelds, zwischen Kommunen und Bund.
Zusammenfassend läßt sich sagen: Nach dem Profi-Konzept arbeitende Projekte erreichen sehr viele "Betroffene". Sie können dem/der einzelnen durch die Bereitstellung eines regelmäßig erscheinenden Produkts ein Zubrot, eine geregelte Tagesstruktur und ein im Verhältnis zu der arbeitslosen Zeit auf der Straße oder im Fernsehsessel erhöhtes Selbstwertgefühl bieten. Sie können ihm/ihr in vielen Fällen eine Wohnung verschaffen und sie/ihn bei Problemen wie der Schuldenregulierung oder der Vermittlung eines Therapieplatzes unterstützen. Inhaltlich können sie durch konsequente Lobbyarbeit Partei für Arbeitslose, Wohnungslose und andere Benachteiligte ergreifen, indem Gründe und Auswirkungen von Armut und Ausgrenzung thematisiert werden.
5.2. Selbsthilfeprojekte
Selbsthilfeprojekte sind i.d.R. wesentlich kleiner und überschaubarer als die nach dem Profi-Konzept arbeitenden Zeitungen der großen Städte. Man ist nicht so sehr von einer hohen Auflage, von Anzeigen, Spenden und Sponsoren abhängig.[271] An den meisten entscheidenden Stellen betätigen sich "Betroffene".
Bei den regional agierenden Selbsthilfeprojekten existiert keine strenge Trennung zwischen Schreibenden und Verkaufenden. Da die Zahl der MitarbeiterInnen[272] relativ gering ist und diese eine größere Verantwortung für das Ganze haben, ist es eher möglich, ein solidarisches Lebensumfeld zu erfahren. Man kennt sich persönlich, weshalb das Konkurrenzverhalten eher in den Hintergrund tritt. Der Strassenfeger, Berlin mit einer Auflage von rund 30 000 Exemplaren wird beispielsweise von nur rund 60 Personen gestaltet und vertrieben.[273]
Analog zu dem, was Paulo Freire in Brasilien als "Kultur des Schweigens" kennenlernte, gibt es auch in der Bundesrepublik Deutschland ein Schweigen der Unterdrückten.[274] Von Arbeitsmarkt, Konsum und politischer Partizipation ausgeschlossene Menschen erleben auch hier, daß sie "unter dem überwältigenden Eindruck der Macht ... ihrer inneren Selbständigkeit beraubt"[275] werden. Durch die selbständige Erstellung einer Straßenzeitung haben sie die Chance, die eigene Lage als "eine sie begrenzende Situation" zu erkennen, "die sie verändern können."[276] Der Schwerpunkt der Veränderung liegt jedoch nicht auf der individualistisch verkürzten Perspektive einer Normalisierung als Rückkehr in eine Normalität im Sinne einer Wiederanpassung.[277] Es geht vielmehr darum, selbst erlebte, Ungleichheit schaffende Strukturen zu erkennen, aufgrund dieser Erkenntnis Selbst-Bewußtsein zu entwickeln und durch Öffentlichkeitsarbeit an einem neuen Bewußtsein mitzuarbeiten.
Der Aspekt des Verdienstes ist in diesem Zusammenhang alles andere als unwichtig. Die Überwindung ungerechter Strukturen steht mit der gerechteren Verteilung von materiellen Ressourcen in einem unauflöslichen Zusammenhang. Eine Selbstausbeutung, wie sie tendenziell bei Von unge, Köln vorzuliegen scheint, führt dagegen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem moralischen Rigorismus und zu einer pauschalen Verurteilung (potentieller) MitstreiterInnen, wenn ihre Anstrengungen mit einer, wenn auch noch so bescheidenen, materiellen Verbesserung ihrer Lebenslage in Verbindung stehen.
Bei den bundesweit agierenden Straßenzeitungsprojekten sind die Verkaufsplätze im Regelfall weit vom Herausgabeort der Zeitungen entfernt. Deshalb reduziert sich das über die Situationsveränderung durch Gestaltung einer Zeitung Gesagte auf wenige Personen, die zum engen Zirkel vor Ort gehören. Die VerkäuferInnen befinden sich tendenziell noch weiter von den ErstellerInnen der Zeitungen entfernt als bei den nach dem Profi-Konzept arbeitenden Projekten.
Vom materiellen Gesichtspunkt her sind sie jedoch gegenüber ihren KollegInnen von den Profi-Zeitungen meist im Vorteil. Wer mobil genug ist oder in einer Stadt wohnt oder Platte macht, in der keine Straßenzeitung ansässig ist, hat relativ wenig Konkurrenz.[278] VerkäuferInnen von Jedermann oder Streetworker, Darmstadt haben darüber hinaus die Möglichkeit, an einer verkauften Zeitung mehr als das Doppelte zu verdienen als z.B. bei Hinz & Kunzt in Hamburg. Für sie bietet der Zeitungsverkauf hauptsächlich die Möglichkeit, sich materiell zu verbessern. Da sie jedoch die Zeitungen in Darmstadt kaufen müssen, wird ihre Seßhaftwerdung nicht unbedingt befördert. Am Verkaufsort selbst sind sie dann im Regelfall alleine, das solidarische Lebensumfeld, das eventuell am Entstehungsort der Zeitung herrscht, wird es dort ebensowenig geben wie das Angebot einer sozialdienstlichen Beratung, wie es ihre KollegInnen bei den "großen" Zeitungen vorfinden. Der Verkauf überregionaler Straßenzeitungen bietet sich also vor allem für Personen an, die sich für das Leben auf der Straße entschieden haben.
Alle Selbsthilfeprojekte erreichen im Vergleich mit den nach dem Profi-Konzept arbeitenden Projekten relativ wenige Personen. Sie haben viel weniger MitarbeiterInnen und im Verhältnis zu ihrem Verbreitungsgebiet auch viel geringere Auflagezahlen.[279] Ihr Einfluß auf den sozialpolitischen Diskurs vor Ort ist im Verhältnis zu den nach dem Profi-Konzept arbeitenden Blättern gering. Sie bieten jedoch für "Betroffene" die Chance, sich durch eigenständige Arbeit ihrer selbst bewußt zu werden und für sich und andere Ausgegrenzte aktiv werden. Sie können als Provokation wirken, da sich Personen, "deren Lage ein soziales Problem darstellt, insofern sie gesellschaftlich definiert ist als nicht-normale, als ungenügende gesellschaftliche Integration"[280] und die deshalb häufig als "Randgruppe"[281] bezeichnet werden, zu Wort melden, ohne es zu ihrem zentralen Ziel zu erklären, sich in die "nivellierende Mittelstandsgesellschaft" (wieder) einzureihen.
5.3. Von Ehrenamtlichen getragene Projekte
Von Ehrenamtlichen getragene Projekte stellen in der Bundesrepublik Deutschland, soweit ich sehe, eher eine Ausnahme dar. In den Arbeitsmarkt integrierte Menschen haben im Regelfall, auch wenn sie sehr engagiert sind, nicht so viel freie Zeit zur Verfügung, um auf ehrenamtlicher Basis monatlich eine Zeitung zu produzieren und deren Vertrieb und Verkauf professionell zu organisieren. Ehrenamtlich erstellte Zeitungen können daher ihren potentiellen Markt nicht voll ausschöpfen. Für "Betroffene", die in der Regel als Verkaufende arbeiten, ist es schwieriger, ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen.
Die Chance der Projekte liegt ähnlich wie bei den Selbsthilfeinitiativen in ihrer Überschaubarkeit.[282] Der oder die Verkaufende ist nicht eineR von vielen Hundert oder gar über Tausend. Er oder sie kann daher eher als bei den großen, nach dem Profi-Konzept arbeitenden Zeitungen ein solidarisches Umfeld erfahren. Dieses setzt sich - im Idealfall - anders als bei den Selbsthilfeinitiativen aus einer Mischung verschiedener gesellschaftlicher Schichten zusammen. Die Kontakte zu "nicht-betroffenen" MitbürgerInnen gründen anders als die durch den Straßenzeitungsverkauf entstehenden Kontakte[283] nicht auf der oberflächlichen Basis Geld gegen Ware[284]. Bei von ehrenamtlichen getragenen Projekten wird ein Stück Solidarität seßhafter BürgerInnen mit den Ausgegrenzten verwirklicht. Diese geschieht auch dadurch, daß berufliche Kenntnisse in Schulungen weitergegeben werden.[285]
Ehrenamtliche Projekte haben aufgrund ihrer Größe nicht dasselbe Gewicht im sozialpolitischen Diskurs vor Ort wie die nach dem Profi-Konzept arbeitenden Projekte.
Da die Letztverantwortung für die Zeitung in der Regel in Händen der Ehrenamtlichen liegt, ist der Aspekt der aktiven Veränderung der eigenen Situation durch die "Betroffenen" selbst, wie er in Punkt 5.2. beschrieben wurde, schwächer ausgeprägt. Die Chance der von Ehrenamtlichen geprägten Projekte liegt eher darin, daß verschiedene Gesellschaftsschichten sich begegnen und auf beiden Seiten bestehendes Mißtrauen abgebaut wird, indem gemeinsam an einem Projekt gearbeitet wird.
5.4. Von der Wohnungslosenhilfe geprägte Zeitungen
Bei den von der Wohnungslosenhilfe herausgegebenen Zeitungen arbeiten ExpertInnen in Sachen Wohnungslosigkeit an entscheidender Stelle mit. Dies sind je nach Konzeption schwerpunktmäßig SozialarbeiterInnen wie bei statt park, Essen oder ähnlich wie bei Selbsthilfeprojekten in der Hauptsache aktuell oder ehemalig Wohnungslose wie bei Abseits!?, Osnabrück oder bei Platte, Bingen. Hier besteht ein Potential an Wissen über Ursachen für Wohnungslosigkeit und das wirkliche Leben von Wohnungslosen. Durch die konzeptionelle und örtliche Ansiedlung in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe[286] ist die Hemmschwelle mitzuarbeiten relativ gering. Tendenziell können also auch Wohnungslose erreicht werden, die sich vielleicht bei nach dem Profi-Konzept arbeitenden Blättern nicht zu einer Mitarbeit entschließen würden. Ein einigermaßen regelmäßiger Verdienst, den die meisten StraßenzeitungsverkäuferInnen mir gegenüber als zentrales Motiv ihrer Mitarbeit nannten[287], ist bei den mir bekannten Projekten mit Ausnahme von Abseits!?, Osnabrück jedoch nicht zu erzielen.
Da die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in der Hauptsache nach dem ganz auf die Hilfe im Einzelfall zugeschnittenen BSHG arbeiten, wird Wohnungslosigkeit schwerpunktmäßig als individuelles Schicksal gesehen. Aufgrund der Erfahrung von und mit Wohnungslosen besteht jedoch die Chance, den interessierten Leserinnen und Lesern die Wirklichkeit "ganz unten" nahezubringen, ohne in die Versuchung zu verfallen, in der alle nach dem Profi-Konzept arbeitenden Blätter mehr oder weniger stehen: Die eigenen VerkäuferInnen als Durchschnitt der Wohnungslosen zu sehen, die sich, wenn sie nur wollen, durch den Verkauf der Zeitung bis hin zur Unabhängigkeit von Sozialhilfe oder zum Wechsel in den ersten Arbeitsmarkt selbst helfen können.
Der Schwerpunkt der Arbeit der professionellen Wohnungslosenhilfe liegt schließlich auf der "Sicherung der Grundversorgung durch Rechtsdurchsetzung"[288]. In Zeiten, in denen die Ökonomie die zentralen Normen setzt[289], könnte es geradezu kontraproduktiv sein, einer Strategie Vorschub zu leisten, die der Öffentlichkeit vorspiegelt, Wohnungslose könnten, wenn sie nur wollten, sich unabhängig von der Hilfe zum Lebensunterhalt über Wasser halten. Die MitarbeiterInnen der Wohnungslosenhilfe wissen sehr genau, daß in vielen Fällen die Erfolgsgeschichte "Aus der Gosse zurück in ein festes Wohn- und Arbeitsverhältnis" ein Märchen bleibt. Um die vielen, die es, aus welchem Grund auch immer, nicht "schaffen", nicht vorsätzlich ihres Rechtsanspruches zu berauben, jedoch auch, um keine oft unrealistischen Erwartungen zu wecken, sind die Ziele der von der Wohnungslosenhilfe initiierten Projekte vergleichsweise bescheiden[290].
Die Gefahr der von der Wohnungslosenhilfe herausgegebenen Zeitungen besteht darin, in eine Selbstrechtfertigung der eigenen Arbeit zu verfallen. Eine öffentliche Darstellung der eigenen Arbeit ist in Anbetracht der Tatsache, daß die "etablierte" Wohnungslosenhilfe im Vergleich mit den nach dem Profi-Konzept arbeitenden Straßenzeitungen eine sehr schlechte Lobby hat[291], sicherlich ein Stückweit notwendig. Der Versuchung, das eigene Konzept als das einzig richtige darzustellen, sollte man jedoch widerstehen.
Für Wohnungslose und andere ausgegrenzte Menschen bieten die von der Wohnungslosenhilfe herausgegebenen Blätter besonders durch die regelmäßige Veröffentlichung ausführlicher Adressenlisten eine wertvolle Hilfe. Ob man die "Betroffenen" darüber hinaus auch zu Wort kommen läßt oder lieber für bzw. über sie schreibt, hängt davon ab, ob man sich dem klassischen Fürsorgemodell der Versorgung der KlientInnen[292] verpflichtet fühlt oder eher die Selbstverantwortlichkeit[293] wohnungsloser Menschen fördern will. Dieses Modell verfolgt die von ihrer Außenwirkung her erfolgreichste Straßenzeitungen dieses Typs Abseits!? in Osnabrück. Dort werden im Verhältnis zur Einwohnerzahl wesentlich mehr Zeitungen verkauft als z.B. bei BISS in München.
5.5. Von "Betroffenen" und der Wohnungs-losenhilfe gemeinsam initiierte Projekte
Experten in Sachen Wohnungslosigkeit arbeiten auch bei den von "Betroffenen" und der Wohnungslosenhilfe gemeinsam initiierten Projekten zusammen. Der Unterschied zu den (nur) von der Wohnungslosenhilfe herausgegebenen Blättern besteht darin, daß "Betroffene" eigenverantwortlich an der Initiierung der Projekte beteiligt gewesen sind. Bei Bank Extra in Köln arbeiten die (ex)-wohnungslosen Gründungsmitglieder indes gar nicht mehr mit, das gleiche könnte bei dem Kieler Projekt Hempels Straßenmagazin passieren, wenn die inzwischen über BSHG angestellten Initiatoren wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen sollten. Durch diese für die einzelnen "Betroffenen" erfreuliche Entwicklung drohen die Projekte ihren Charakter zu verlieren. Da die Fluktuation unter den SozialarbeiterInnen im Regelfall geringer ist, droht der Selbsthilfegedanke geschwächt zu werden. Dies hängt weniger mit dem Unwillen der SozialarbeiterInnen zusammen als vielmehr mit einem Ungleichgewicht an Erfahrung. Wer z.B. wie bei Bank Extra in Köln im siebten Jahr eine Straßenzeitung herausgibt, hat schlicht einen ganz anderen Erfahrungshintergrund als jemand, der neu zu dem Projekt dazustößt. Dies ist völlig unabhängig davon, ob die neue Mitarbeiterin bzw. der neue Mitarbeiter wohnungslos oder seßhaft, arbeitslos oder Sozialarbeiter oder Journalistin ist. Von "Betroffenen" und der Wohnungslosenhilfe gemeinsam initiierte Projekte stellen daher eher eine Übergangsform dar. Im Falle der schon seit 1992 bestehenden Zeitung Bank Extra ist der Weg in Richtung der von der Wohnungslosenhilfe getragenen und auf der Straßen verkauften Blätter gegangen. Die Mitwirkung Wohnungsloser an entscheidender Stelle wieder zu erreichen, setzt einen langen Atem voraus. Ob dies in einer von einer Einrichtung der Wohnungslosenhilfe herausgegebenen Zeitung überhaupt möglich ist, nachdem die (ex)-wohnungslosen Verantwortlichen der ersten Stunde abgewandert sind, erscheint mir zweifelhaft. Die Chance besteht eher in einer Art "begleiteter" Selbsthilfe, wie sie etwa auch bei Abseits!?, Osnabrück geleistet wird.
Hempels Straßenmagazin in Kiel scheint sich dagegen zu einer ganz eigenen Mischform weiterzuentwickeln. Bedingt durch die Steigerung der Auflage hat das Blatt eine Anziehungskraft auf VerkäuferInnen ausgeübt, wie sie von den "großen" nach dem Profi-Konzept arbeitenden Projekten bekannt ist.[294] Die Inhalte werden jedoch im Wesentlichen von (Ex)-Wohnungslosen verantwortet, während zwei Sozialarbeiter finanzielle Belange und die Frage der Koordination managen.
Hempels Erfolg ist eine Anfrage an Konzeptionen, die "Betroffene" im Wesentlichen auf die Verkäuferrolle reduzieren und die Gestaltung der Zeitung ganz JournalistInnen, SozialarbeiterInnen und Ehrenamtlichen überlassen. Anscheinend ist die Bevölkerung sehr wohl an dem interessiert, was (Ex)-Wohnungslose zu sagen haben. Die Gefahr, daß sich im Zuge einer Professionalisierung eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zwischen Neu-Profis und Nur-VerkäuferInnen entwickelt, die sich eventuell noch um einen dritten Stand der Nur-Obdachlosen erweitert, ist jedoch nicht von der Hand zu weisen.[295]
6. Fazit
Straßenzeitungen müssen sich einerseits am Markt behaupten und arbeiten andererseits mit und für Menschen, die "der Markt" nicht haben will. In diesem Dilemma befinden sich alle Projekte, egal nach welcher Konzeption sie arbeiten. Die Hoffnung, durch die Beschäftigung in einem Straßenzeitungsprojekt wieder "fit" für den (Arbeits)markt zu werden, erfüllt sich nur für wenige. Straßenzeitungen bieten in den allermeisten Fällen kein "Sprungbrett" in die "gewünschte Lebens- und Wohnform" und können dies auch gar nicht bieten. Das Stufenmodell ist in der Realität ein Trichtermodell mit recht schmalem Hals.[296] Straßenzeitungsprojekte sollten deshalb dieses unrealistische Ziel fallen lassen, um KäuferInnen nicht irre zu führen und VerkäuferInnen keine falschen Hoffnungen zu machen. Stellt man das Ziel, Sprungbrett zu sein in den Mittelpunkt, wird eine aus strukturellen Gründen auch mittelfristig nicht für alle erreichbare "Normalität" als Norm gesetzt, aufgrund derer Wohnungs- und Arbeitslose schon einmal ausgegrenzt wurden. Schaffen sie es nicht, durch ihre Mitarbeit wieder "nach oben" zu kommen, werden sie ein zweites Mal ausgegrenzt.
Straßenzeitungen können das Versagen der Arbeitsmarktpolitik nicht korrigieren. Verkauf von Straßenzeitungen ist zweifelsohne harte Arbeit. Sie ist jedoch im Verhältnis zu abhängiger Erwerbsarbeit viel schlechter bezahlt. Dies sollte offensiver thematisiert werden. Es wäre fatal, wenn StraßenzeitungsverkäuferInnen zu VorreiterInnen einer neuen working-poor-class würden. Schon jetzt leben wir "in einer scharf segmentierten Gesellschaft, in der es dem einen Teil nach wie vor gut bis sehr gut geht, aber darunter besteht ein Schattenreich von Arbeitslosen, Kleinstrentnern und Obdachlosen."[297] Straßenzeitungen sollten nicht die Illusion nähren, "Betroffene" hätten durch ihre Mitarbeit eine große Chance, diesem Schattenreich zu entfliehen. Damit würde der Eindruck, "wer will, der kann" entstehen und letztlich Personen wie Herrn Henkel oder Herrn Hundt in die Hände gespielt werden. Erfolgsgeschichten wie über den ex-obdachlosen Hinz & Kunzt-Mitarbeiter, der als "ein absoluter Selfmade-Mann"[298] dargestellt wird, oder wie über eine "kleine Karriere" bei BODO[299] sollten deshalb die Ausnahme sein und vor allem als Ausnahme gekennzeichnet werden, um bei der Leserschaft keine falschen Ansprüche und bei den Verkaufenden keine falschen Hoffnungen zu wecken.
Durch die Präsenz von StraßenzeitungsverkäuferInnen in den Innenstädten verändert sich die Einstellung der "Normalbevölkerung" gegenüber Wohnungslosen.[300] "Viele Menschen rufen bei uns an und fragen: »Sind das wirklich alles Obdachlose?«"[301], so der leitende Redakteur von fiftyfifty, Düsseldorf. Aus dieser Beobachtung folgert er, "daß fiftyfifty das Bild, das sich die BürgerInnen bisher von Obdachlosen gemacht haben, verändert. Es sind eben nicht alles »Penner, Säufer, usw.«"[302] Diese Änderung in der Einstellung ist jedoch nicht nur positiv zu sehen. Die in der überwiegenden Mehrzahl als VerkäuferInnen arbeitenden "Betroffenen" stellen eine "Oberschicht" unter den Wohnungslosen dar. Rechnet man die gesamte Zahl der in der Bundesrepublik Deutschland vorhandenen Verkaufsausweise anhand bekannter Zahlen hoch, kommt man auf eine Zahl von maximal 8000.[303] Selbst unter Vernachlässigung der Tatsache, daß viele Verkaufende niemals wohnungslos waren, waren damit von allen alleinstehenden Wohnungslosen maximal vier Prozent jemals als MitarbeiterInnen von Straßenzeitungen tätig. Was ist mit den restlichen 96 Prozent? Was ist mit denen, die nach wie vor "Penner" oder "Säufer"[304] sind? Fühlt man sich im Wesentlichen den "eigenen" Leuten, nämlich den (ex)-wohnungs- und arbeitslosen MitarbeiterInnen verpflichtet oder will man eine Lobby für alle Ausgegrenzten schaffen?[305] Dies sind offene Fragen, denen sich die Projekte stellen müssen.
In diesem Zusammenhang zeigt sich ein weiteres Dilemma. Das Bewußtsein, der Weg vom "Penner" zum Straßenzeitungsmitarbeiter sei für alle gangbar, darf ebensowenig entstehen wie der Eindruck, Wohnungslose hätten überhaupt keine Selbstheilungskräfte mehr und würden, ob mit oder ohne Unterstützung, auf alle Fälle niemals aus ihrer Situation herauskommen. Thomas Waldherr, ehemaliger Redakteur des Looser aus Michelstadt, bringt dieses Dilemma auf den Punkt: "Was bedeutet Selbsthilfe der Armen? Soll das eine individuelle Selbsthilfe sein, die jeden gesellschaftspolitischen Anspruch von sich weist? Die gar nicht nach gesellschaftlichen und politischen Ursachen von Armut fragt, sondern Ursachen und Lösungen der Armutsprobleme alleine im einzelnen Menschen und dessen Verhalten sieht? Das wäre das eine Extrem. Das andere Extrem wäre eine Sichtweise, die die Möglichkeiten des Einzelnen in dieser Gesellschaft verneint, ihn als absolut ohnmächtig gegenüber den politischen und sozialen Entwicklungen ansieht und somit jedes individuelle Handeln als unsinnig abqualifizieren würde."[306]
In der Bundesrepublik Deutschland herrscht das Bewußtsein, Armut und Ausgrenzung seien im wesentlichen selbstverschuldet, vor. Diese Einstellung schlägt sich auch in einer entsprechenden Politik und Gesetzgebung nieder.[307] Deshalb sollten Straßenzeitungen als Gegengewicht eher die Position beziehen, die nach den gesellschaftlichen und politischen Ursachen der Armut fragt, eine Lobby für alle Armen und gesellschaftlich Ausgegrenzten bilden und die Notwendigkeit tiefgreifender Veränderungen thematisieren. Eine "bunte Themenmischung mit leicht sozialem Touch" reicht nicht aus. Die Begründung, das Produkt müsse marktgängig sein, kann als Argument gegen konsequente Lobbyarbeit nicht gelten. Sonst könnte man auch z.B. Zigaretten durch Wohnungs- und Arbeitslose verkaufen lassen. Der niedrige Verdienst der VerkäuferInnen ist nur zu rechtfertigen, wenn man sich konsequent auf die Seite der Arbeits- und Wohnungslosen stellt.
Bei Straßenzeitungen gibt es ein großes Potential an MitarbeiterInnen, die schon einmal "ganz unten" waren. Mit dieser Erfahrung im Hintergrund können sie öffentlich machen, daß die Kluft zwischen Armen und Reichen, zwischen Integrierten und Ausgegrenzten und zwischen arbeitenden und arbeitslosen Menschen immer größer wird. Sie können zeigen: Ein gesellschaftliches Leitbild, das die Menschenwürde von der Teilnahme am ersten Arbeitsmarkt abhängig macht, grenzt eine wachsende Zahl von Menschen aus. Deshalb muß nach einem anderen Leitbild gesucht werden. Die neoliberale Forderung der höheren "Eigenverantwortung" ist, weil sie Risiken wie Krankheit, Behinderung, Alter oder Arbeitslosigkeit pauschal durch Selbst-verschuldung zu erklären sucht, abzulehnen. Die Lage der Ausgegrenzten und die strukturellen Gründe für ihre ökonomische und soziale Deklassierung müssen ins Bewußtsein der "Normalbevölkerung" dringen, um einen Umdenkungsprozeß in Gang zu bringen, der vielleicht irgendwann zu einer Politik führt, die sich der Gerechtigkeit und der Solidarität (in dieser Reihenfolge) verpflichtet fühlt.
7. Literaturverzeichnis
7.1. Straßenzeitungen und Straßenmagazine:
Berlin:
motz, Ausgabe 18, 18.8.1997
motz, Ausgabe 19, 1.9.1997
motz, Ausgabe 23, 27.10.1997
Strassenfeger Nr.3, Februar/März 1997
Strassenfeger Nr.7, April/Mai 1997
Strassenfeger Nr.14, Juli/August 1997
Strassenfeger Nr.19, Oktober 1997
Strassenfeger Nr.20, Oktober/November 1997
Strassenfeger Nr.21, November 1997
Strassenfeger Nr.22, November 1997
Strassenfeger Nr.23, Dezember 1997
Strassenfeger Nr.24, Dezember 1997
Strassenfeger Nr.1, Januar 1998
Strassenfeger Nr.2, Januar 1998
Strassenfeger Nr.4, Februar 1998
Looser / Strassenfeger, März/April 1998
Bingen:
"Platte". Die Obdachlosenzeitung, Ausgabe 1, 1. Jahrgang, 1993
"Platte". Die Obdachlosenzeitung, Ausgabe 4, 2. Jahrgang, 1994
"Platte". Die Obdachlosenzeitung, Ausgabe 5, 2. Jahrgang, 1994
"Platte". Die Obdachlosenzeitung, Ausgabe 7, 3. Jahrgang, 1995
"Platte". Die Obdachlosenzeitung, Ausgabe 8, 3. Jahrgang, 1995
"Platte". Die Obdachlosenzeitung, Ausgabe 9, 3./4. Jahrgang, Dez. 1995 - März 1996
"Platte". Die Obdachlosenzeitung, Ausgabe 10, 4. Jahrgang, März - Juni 1996
"Platte". Die Obdachlosenzeitung, Ausgabe 11, 4. Jahrgang, Juni - September 1996
"Platte". Die Obdachlosenzeitung, Ausgabe 13, 4./5. Jahrgang, Dez.1996 - März 1997
"Platte". Die Obdachlosenzeitung, Ausgabe 14, 5. Jahrgang, März - Juni 1997
"Platte". Die Obdachlosenzeitung, Ausgabe 15, 5. Jahrgang, Juni - September 1997
"Platte". Die Obdachlosenzeitung, Ausgabe 16, 5. Jahrgang, Sept. - Dezember 1997
"Platte". Die Obdachlosenzeitung, Ausgabe 17, 5./6. Jahrgang, Dez. 1997 - März 1998
Bochum/Dortmund:
BODO. Das Straßenmagazin für Bo & Do und Umgebung, Nr.27, April 1997
BODO. Das Straßenmagazin für Bo & Do und Umgebung, Nr.28, Mai 1997
BODO. Das Straßenmagazin für Bo & Do und Umgebung, Nr.29, Juni 1997
BODO. Das Straßenmagazin für Bo & Do und Umgebung, Nr.30, Juli 1997
BODO. Das Straßenmagazin für Bo & Do und Umgebung, Nr.31, August 1997
BODO. Das Straßenmagazin für Bo & Do und Umgebung, Nr.32, September 1997
BODO. Das Straßenmagazin für Bo & Do und Umgebung, Nr.33, Oktober 1997
BODO. Das Straßenmagazin für Bo & Do und Umgebung, Nr.34, November 1997
BODO. Das Straßenmagazin für Bo & Do und Umgebung, Nr.35, Dezember1997
Darmstadt:
Jedermann. Kunst von der Straße, 3.Jahrgang für deutschsprachige Länder, Ausgabe Frühjahr 1998
Streetworker. Magazin: Für Kunst u. der Sozialen - Tragödie, Jahrgang 1, Ausgabe Winter/Frühjahr 1998
Düsseldorf:
fiftyfifty, Straßenmagazin für unsere Stadt, März 1997
fiftyfifty, Straßenmagazin für unsere Stadt, April 1997
fiftyfifty, Straßenmagazin für unsere Stadt, Juni 1997
fiftyfifty, Straßenmagazin für unsere Stadt, September 1997
fiftyfifty, Straßenmagazin für unsere Stadt, Oktober 1997
fiftyfifty, Straßenmagazin für unsere Stadt, November 1997
fiftyfifty, Straßenmagazin für unsere Stadt, Dezember 1997
fiftyfifty, Straßenmagazin für unsere Stadt, Sonderausgabe Nr.1, Texte von der Straße, 1997
Essen:
statt Park. Hilfen für Nichtseßhafte und Wohnungslose. Informationen für Bürger und Betroffene, Ausgabe 1, Dezember 1995
statt Park. Hilfen für Nichtseßhafte und Wohnungslose. Informationen für Bürger und Betroffene, Ausgabe 2, Juni 1996
statt Park. Hilfen für Nichtseßhafte und Wohnungslose. Informationen für Bürger und Betroffene, Ausgabe 3, Mai 1997
Wohnungsloser, Ausgabe 9, 1997/1998
Hamburg:
Hinz & Kunzt, Nr.56, Oktober 1997
Hinz & Kunzt, Nr.58, Dezember 1997
Hannover
Asphalt-Magazin, Dezember 1997
Kassel
Tagessatz, Nummer 3, 1997
Kiel
Hempels Straßenmagazin, Nr.18, Oktober 1997
Hempels Straßenmagazin für Kiel, Flensburg und Umgebung, Nr.20, Dezember 1997
Köln
Bank Extra. Kölns dienstälteste Obdachlosenzeitung, 6.Jahrgang, Nr.27, Oktober/ November 1997
Von unge. Kölsches Blatt, Nr.65, 6.Jahrgang, 12/97
Marl
Signal. Ausgabe 1, November 1995
Michelstadt
WOHNUNGS-Looser. Obdachlosenzeitung für die Bundesrepublik Deutschland, Nr.2 (März/April/Mai 1995)
Looser. Selbsthilfezeitung gegen Armut und Obdachlosigkeit für die Bundesrepublik Deutschland. In Zusammenarbeit mit Lobby-Press-Info-Service, Nr.5/1997
Looser. Selbsthilfezeitung gegen Armut und Obdachlosigkeit für die Bundesrepublik Deutschland. In Zusammenarbeit mit Lobby-Press-Info-Service, Nr.6/1997
Looser. Selbsthilfezeitung gegen Armut und Obdachlosigkeit für die Bundesrepublik Deutschland. In Zusammenarbeit mit Lobby-Press-Info-Service, Nr.7/1997
Looser. Selbsthilfezeitung gegen Armut und Obdachlosigkeit für die Bundesrepublik Deutschland. In Zusammenarbeit mit Lobby-Press-Info-Service, Nr.8/1997
Looser. Selbsthilfezeitung gegen Armut und Obdachlosigkeit für die Bundesrepublik Deutschland. In Zusammenarbeit mit Lobby-Press-Info-Service, Nr.9/1997
Looser. Lobby-Press-Info-Service. Selbsthilfezeitung gegen Armut und Obdachlosigkeit für die Bundesrepublik Deutschland, Nr.11/1997
Lobster. Die neue Zeitung von Lobby und Looser, 2/98, Februar/März 1998
Looser / Strassenfeger März/April 1998
München
BISS. Bürger in sozialen Schwierigkeiten, Juli/August 1997
BISS. Bürger in sozialen Schwierigkeiten, September 1997
BISS. Bürger in sozialen Schwierigkeiten, Oktober 1997
Osnabrück
Abseits. Erste Osnabrücker Straßenzeitung, Ausgabe Nr.6/1997, Dezember/Januar
Abseits. Erste Osnabrücker Straßenzeitung, Ausgabe Nr.1/1998, Februar/März
Abseits. Erste Osnabrücker Straßenzeitung, Ausgabe Nr.2/1998, April/Mai
Solingen
Die Straße. Das Straßenmagazin im Bergischen Land, 3.Jahrgang Nr.38 - Dezember 1997
Stuttgart
Trott-war. Die Straßenzeitung in der Region Stuttgart, November 1996, Nr.8
Trott-war. Die Straßenzeitung im Südwesten, Mai 1997, Nr.5
Trott-war. Die Straßenzeitung im Südwesten, Juli 1997, Nr.7
Trott-war. Die Straßenzeitung im Südwesten, August 1997, Nr.8
Trott-war. Die Straßenzeitung im Südwesten, September 1997, Nr.9
Trott-war. Die Straßenzeitung im Südwesten, Oktober 1997, Nr.10
Trott-war. Die Straßenzeitung im Südwesten, November 1997, Nr.11
Trott-war. Die Straßenzeitung im Südwesten, Januar 1998, Nr.1
Trott-war. Die Straßenzeitung im Südwesten, Februar 1998, Nr.2
Trott-war. Die Straßenzeitung im Südwesten, April 1998, Nr.4
7.2. Flugblätter, Selbstdarstellungen, Presseerklärungen
- Berlin (Strassenfeger):
- mob e.V.: Satzung des Vereins "mob - obdachlose machen mobil", Fassung vom 8.6.1997, Berlin 1997
Schneider, Stefan; Welle, Jutta (für den Verein "mob" e.V."): Editorial 3/97, Berlin 1997
Düsseldorf (Fiftyfifty):
Fiftyfifty, Düsseldorf (v.i.S.d.P.): Gegen Vertreibung! Die Straße gehört allen!, Düsseldorf 1997
Initiativkreis "Armut in Düsseldorf", Düsseldorf o.J.
N.N.: An die Lokalpresse: Hohe Akzeptanz für fiftyfifty, Meinungsumfrage war ein großer Erfolg, Düsseldorf, 21.8.1997 N.N.: Interview mit Hubert Ostendorf, Leitender Redakteur von fiftyfifty, Düsseldorf 1997
N.N.: Obdachlose helfen sich selbst. Düsseldorfer Straßenmagazin seit zwei Jahren erfolgreich, Düsseldorf 1996
Ostendorf, Hubert (V.i.S.d.P.): "Die Arbeit von Asphalt im Spiegel der Düsseldorfer Presse, o.J.
Hamburg (Hinz & Kunzt):
N.N.: Fragen und Antworten zu Hinz & Kunzt, Hamburg 1997
N.N.:Das Hamburger Straßenmagazin. "Hilfe zur Selbsthilfe für Hamburgs Obdachlose", o.J. (Leporello)
N.N.: Der Hinz & Kunzt Freundeskreis. Gesagt. Gelesen. Getan., o.J. (Leporello)
N.N.: Infobrief für den Freundeskreis 1/1996, 2/1996, 3/1996
N.N.: Hinz & Kunzt-Wohnungspool, Hamburg 1996 (Leporello)
N.N.: Hinz & Kunzt - 4 Jahre auf einen Blick, Hamburg 1997
Stolle, Martin: Hinz & Kunzt Verkäufer-Analyse. Bedarfserhebung zum Thema Wohnen und Arbeiten, Hamburg 1995
Michelstadt ([WOHNUNGS]Looser):
Selbsthilfeförderverein Arbeit und Wohnen e.V.: "Bauen mit Obdachlosen", Projektreader, Erbach 1997
München (BISS):
Denninger, Hildegard: BISS e.V. und Zeitschrift BISS, 1997
Honigschnabel, Klaus: Selbstdarstellung von BISS, München 1994
N.N.: BISS, Bürger in sozialen Schwierigkeiten, Kurzkonzept, o.J.
Nürnberg (Straßenkreuzer):
Straßenkreuzer: Der STRAßENKREUZER e.V. stellt sich vor, Nürnberg o.J..
Osnabrück (Abseits):
Kater, Thomas: Konzeption zur Erstellung einer Straßenzeitung in Osnabrück, Osnabrück 1995
Stuttgart (Trott-war):
N.N.:Pressemappe, Stuttgart o.J.
N.N.:TROTT-WAR. Die Straßenzeitung im Südwesten, o.J.
7.3. Rechtstexte
AFG (Arbeitsförderungsgesetz), AFG-LeistungsVO, AltersteilzeitG, Arbeits-erlaubnisVO, ArbeitslosenhilfeVO, SGB I, SGB IV, SGB X, 25.Aufl., München 1995
BSHG (Bundessozialhilfegesetz), abgedruckt in: Gastiger: Gesetzestexte für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, 29. Ergänzungslieferung, Stand 30.6.1997, Freiburg 1997
SGB V: Gesetzliche Krankenversicherung mit Gesundheits-Reformgesetz (Auszug), Sozialgesetzbuch Allgemeiner Teil, Gemeinsame Vorschriften für die Sozial-versicherung, 4.Aufl., München 1995
SGB VI: Gesetzliche Rentenversicherung mit Fremdrentengesetz, Fremdrenten- und Auslandsrenten-Neuregelungsgesetz, 2.Aufl., München 1992
7.4. Monographien, Zeitschriften- und Zeitungsartikel:
Aktuell '98. Das Lexikon der Gegenwart, Dortmund 1997
Appen, Kai von: Nackten in die Tasche greifen. Senat möchte bei Verkäufern der Obdachlosenzeitung "Hinz und Kunzt" abkassieren / Diakonie: "Projekt in Gefahr", in: taz, 17.11.1994
Arbeitskreis Wohnraumversorgung: Diskussionsgrundlage zur Almosenverteilung in Hamburg, in: wohnungslos 1/1996, S.21-24
Arlt, Manfred: Von der Straße auf den Weg zur Zeitung, in: Signal, Ausgabe 1, November 1995, S.3f
Asche, Friederike: Editorial, in: BODO Nr.33, Oktober 1997, S.3
Bad, Carl S.: Soziales Gewissen?, in: Strassenfeger Nr.23, Dezember 1997, S.4
Bauer, Martina: "Hinz & Kunzt" vermietet Appartements. Straßenzeitungen im Ruhrgebiet und in Kassel, in: Gefährdetenhilfe 4/1994, S.157f
Becker; Martina; Schmitz, Ralf: Schrei nach normalem Leben, in: Strassenfeger Nr.24, Dezember 1997, S.5
Bernd: Dank motz keine Beschaffungskriminalität, in: motz 19/97, S.12
Biedenkopf, Kurt: Stellungnahme des sächsischen Ministerpräsidenten zu den Vorschlägen der Partei- und Regierungskommission zur Rentenreform, in: Frankfurter Rundschau, 12.2.1997, S.16.
Birkenmaier, Werner: Es kommen härtere Tage. Entsolidarisiert sich die Gesellschaft?, Stuttgarter Zeitung, 6.12.1997, S.49
Bosch, Wilhelm: Abseits!? Unterwegs! Zu Besuch bei der Straßenzeitung "Brücke" in Erfurt!, in: Abseits Nr.2, April/Mai 1998, S.9f
Braun, Wolfgang: Hinz & Kunzt - Obdachlosenhilfe zwischen Sinnstiftung und Vermarktung, in: wohnungslos 1/95, S.32-34
Breiholz, Jörg: Bettel-Konkurrenz. Zeitung für Obdachlose gegründet, in: taz 28.10.1993
Breuer, Wilhelm; Engels, Dietrich: Bericht und Gutachten zum Lohnabstandsgebot. Bericht der Bundesregierung zur Frage der Einhaltung des Lohnabstandsgebotes nach § 22 Abs.3 Bundessozialhilfegesetz, Stuttgart; Berlin; Köln 1994
Broder, Henryk M.: Hilfe von Obdachlosen. Große Spendenaktion im Süden der Republik, in: Tagesspiegel, 1.12.1997, S.3
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V.: 930.000 Wohnungslose im Jahr 1996. BAG Wohnungslosenhilfe veröffentlicht neue Schätzung, in: wohnungslos 4/1996, S.167
Büsselberg, Günter: statt park setzt seine Informationsarbeit fort, in: statt park, Ausgabe 2, Juni 1996, S.1
C., Michael: DANKE INTEGO; TSCHÜß SOZIALHILFE, in: Wohnungsloser Ausgabe 9, 1997/98, S.22
cvs: Hinz & Kunzt feiert Erfolge, in: Hamburger Abendblatt, 31.12.1993
Denninger, Hildegard: BISS 1996 und 1997 - Worte, Zahlen, Ziele, in: BISS Juli/August 1997, S.36f
el: Straßenzeitung Trottwar für dieses Jahr gesichert, in: Evangelisches Gemeindeblatt für Württemberg, 22.2.1998, S.18
Engelen-Kefer, Ursula: "Behindertenfeindliche Tendenz schaukelt sich auf". Das Kölner Urteil und zynische Sprache in der Gesellschaft, in: Frankfurter Rundschau 26.1.1998, S.5
Eppler, Erhard: Kavalleriepferde beim Hornsignal. Die Krise der Politik im Spiegel der Sprache, Frankfurt am Main 1992
Eulenberger, Klaus: Macht matt, was satt macht?, in: Junge Kirche 3/1997, S.138-142
Flethe, Horst: Abseits!? In der Schule. Besuch in der Agnes-Miegel Realschule, in: Abseits!? Nr.2/1998, April/Mai, S.8
Flethe, Horst: Abseits!? In der Bonnuskirche zu Osnabrück! Obdachlos = Abseits?, in: Abseits!? Nr.2/1998, April/Mai, S.8
Freire, Paulo: Pädagogik der Unterdrückten, 3.Aufl. Stuttgart 1973
Gerald: Pennertagung?, in: Strassenfeger Nr.22, November 1997, S.21
Goddar, Jeannette: Die Neue Selbständigkeit. Immer mehr Arbeitslose verschwinden aus der Statistik, weil sie sich selbständig machen. Doch viele der jungen Unternehmen müssen scheitern, in: tageszeitung, 14./15.2.1998, S.15
Grohall, Karl-Heinz: Zwischen den Stühlen! Über die Inkompatibilität von Hilfe- und Lebenssystem, in: wohnungslos 3/1996, S.98-103
Grüner, Ulf: Ohne das Gejammere, in: Die Zeit 24.12.1993
Hammel, Manfred: Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, Beschluß vom 10.Oktober 1997, Az: 4L 1062/97: Auch ein mittelloser "wohnungsloser Durchreisender" verfügt über einen Rechtsanspruch auf einen ungekürzten Regelsatz der Hilfe zum Lebensunterhalt, in: wohnungslos 4/1997, S.170-172
Hannes: Obdachlosigkeit - ein Teil unserer Gesellschaft, in: Platte Ausgabe 15, Juni bis September 1997, S.6f
Heins, Rüdiger: Obdachlosenreport. Warum immer mehr Menschen ins soziale Elend abrutschen, Düsseldorf 1993
Heinz: Vorurteile? Vorurteile!, in: Bank Extra, Oktober/November 1997, S.14
Henke, Martin: Beispielhafte Hilfen zur dauerhaften Wohnraumversorgung für Wohnungsnotfälle des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, in: wohnungslos 1/1997, S.36-42
Henke, Martin: "Sozialhilfe: Ihr gutes Recht" - auch ohne Wohnung? Zur Sozialhilfegewährung für Wohnungslose in Nordrhein-Westfalen, in: Gefährdetenhilfe 1/1994, S.4-7
Herber, Günther: Im "statt-Park" lesen, anstatt im Stadtpark leben, in: statt park, Ausgabe 1, S.1
Höpfner, Rolf: Von Loccum nach Berlin, in: Asphalt, Dezember 1997, S.22
Huster, Ernst-Ulrich: Armut in Europa. Analysen: Politik - Gesellschaft - Wirtschaft, Band 58, Opladen 1996
Jörg: Zwei Jahre BODO - so war's für mich, in: BODO 6/1997, S.22f
Josef: Knast, in: Platte Ausgabe 15, März bis Juni 1997, S.10
Justus, Kaisa: Laßt die Armen in der Stadt. fiftyfifty-Verkäufer gegen Vertreibung, in: fiftyfifty, September 1997, S.4
Kater, Thomas:
Liebe Leserinnen und Leser ..., in: Abseits Nr.6/1997, Dezember/ Januar, S.3
KNA: Hamburger Abendblatt: Presserat gibt "Hinz und Kunzt" recht, in: epd 15.2.1996
Knake-Werner, Heidi: Erstes SGB III-Änderungsgesetz, in: Streetworker Winter/ Frühjahr 1998, S.7f
Krampitz, Karsten: Neuer Job mit alter Arbei, in: Strassenfeger Nr.20, Oktober/ November 1997, S.9.
Krampitz, Karsten: Obdachlosenzeitungen. Betr.: "Schreiben und Wohnen", taz vom 21.9.96, in: Homepage Stefan Schneider, zosch @fub46.zedat.fu-berlin.de
Lange, Ernst: Einführung, in: Freire, Paulo: Pädagogik der Unterdrückten, 3.Aufl. Stuttgart 1973, S.7-28.
Lely, Uwe van der: Sozialhilfe. Weniger Kleidung im Winter, in: BODO 11/1997, S.9
Lermann, Gabriele: Loccum - Tagung zwischen großen Ideen und Kleinkrämerei. Lobby, Straßenfeger und Looser übernehmen ideologische Vorreiterrolle, in: Looser 11/1997, S.29
Lermann, Gabriele: Looser-Verkäufertreffen in Essen/Steele: Künftig eine eigene Lokalredaktion, in: Looser / Strassenfeger Februar / März 1998, S.22
Lermann, Gabriele: Vom Verbrechen, Sozialhilfeempfänger zu sein, in: Looser 9/1997, S.4-6
Lermann, Gabriele: Zeitung machen, in: Looser / Strassenfeger März/April 1998, S.20f.
Lewy, Anna: Mit "fiftyfifty" begann das neue Leben. Ein Jahr Obdachlosen-Zeitung - Über 160 000 DM für die Armen, in: Neue Rhein Zeitung, abgedruckt in: Ostendorf, Hubert (V.i.S.d.P.): "Die Arbeit von Asphalt im Spiegel der Düsseldorfer Presse, o.J.
Lutz, Ronald: Zur Pädagogik der Wohnungslosen, in: neue praxis 3/96, S.217-228
Manfred; Blümlein, Ralf: Absprung, in: Platte Ausgabe 18, März bis Juni 1998, S.8f
Marek: Nur eine Anzeige?, in: Strassenfeger Nr.7, April/Mai 1997, S.15.
Marx, Karl: Ökonomisch-philosophische Manuskripte von 1844, in: Marx Engels Werke, Ergänzungsband 1.Teil, Berlin 1968, S.467-588
Mathies, Christian, Bundesinitiative wohnungsloser Menschen e.V.: Die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements für Wohnungslose, in: wohnungslos 3/1997, S.98f
May, Michael: "Penner verschenken Computer". Kleine Geschichte der motz: "Die Arbeit war nicht immer einfach, aber es hat Spaß gemacht.", in: motz 23/97, 27.10.1997, S.14f
Meister, Martina: Was tun, wenn die Arbeit ausgeht? André Gorz löst in Frankreich abermals eine Debatte um die Zukunft der Industriegesellschaft aus, in: Stuttgarter Zeitung, 11.10.1997, S.41
Merten, Roland: Wohnungsnot - Der lautlose Abbau des Sozialstaats, in: neue praxis 6/94, S.475-489
Möhnle, Alexander: Wieder zurück auf die Straße? Obdachlosenzeitung "Trott-war" vor dem Aus, in: Sonntag Aktuell, 18.1.1998, S.5
Müller-Classen, Birgit: Es geht ums Geld, in: Hinz & Kunzt Nr.58, Dezember 1997, S.2
N.N.: Am Arbeitsmarkt droht ein neues Tief. Institut rechnet mit 4,46 Millionen Erwerbslosen, in: Frankfurter Rundschau, 15.4.1998, S.1
N.N.: Arbeitslosigkeit. Gericht hält zehn Anträge im Monat für "zumutbar", in: Frankfurter Rundschau, 10.3.1998, S.5
N.N.: Arbeitsplätze in Deutschland. Anzahl der Erwerbstätigen im Jahresdurchschnitt, in: Frankfurter Rundschau, 30.4./1.5.1998, S.17 (Schaubild)
N.N.: Aus der Statistik 1995 der Beratungsstelle (in Essen), in: statt park, Ausgabe 2, Juni 1996, S.3
N.N.: Bescherung zum ersten Advent erfreut Händler nicht. Bürger ohne Kauflaune/Streik in Nordrhein-Westfalen abgewendet/Forderungen nach Einschnitten ins Sozialsystem, in: Frankfurter Rundschau, 1.12.1997, S.11
N.N.: BODO-Projekt. Wird Hilfe gestrichen?, in: BODO 10/1997, S.9
N.N.: Darmstadt - eine Chance für das Bauprogramm?, in: Looser 7/1997, S.10f
N.N.: Editorial, in: Signal, Ausgabe 1, November 1995, S.2
N.N.: Eine Mark von jeder Zeitung für den Verkäufer. Deshalb überall Lokalredaktionen gründen!, in: WOHNUNGSLooser Nr.2, März / April / Mai 1995, S.3
N.N.: Endlich Arbeit ..., in: WohnungsLOOSER Nr.2, März / April / Mai 1995, S.2
N.N.: Erfolg für Hinz & Kunzt", in: Altländer Tageblatt 4.11.1996
N.N.: FDP: Sozialsystem jetzt überwinden, in: Stuttgarter Zeitung, 22.2.1997, S.1
N.N.: Gemeinsam gegen Armut. Drittes Arbeitstreffen bundesdeutscher Straßenzeitungen stand unter starkem Zeichen der Zusammenarbeit, in: Wohnungsloser Ausgabe 9, 1997/98, S.15
N.N.: Heer der Armen wächst weiter. 2,7 Millionen Menschen benötigten 1996 Sozialhilfe, in: Frankfurter Rundschau, 25.11.1997, S.1
N.N.: "Hinz & Kunzt", in: Bild 8.11.1993
N.N.: Keine Chancen auf dem normalen Arbeitsmarkt, in: statt park Ausgabe 1, Dezember 1995, S.11
N.N.: Pool hilft Obdachlosen bei der Wohnungssuche, in: Die Welt, 17.10.1995
N.N.: Preiswürdig, in: taz 19.9.1996
N.N.: Steigendes Engagement Essener Bürger, in: statt park, Ausgabe 2, Juni 1996, S.10
N.N.: Tabelle Wirtschaftswachstum und Beschäftigung, in: Stuttgarter Zeitung 23.11.1996, S.13
N.N.: Wohnen. Zweite Miete legt kräftig zu, in: Frankfurter Rundschau, 13.1.1998, S.11)
Noldin, Detta: Ein Rucksack als Zuhaus! Eine Fortsetzungsgeschichte, in: Abseits!? 6/1997, Dezember/Januar, S.19, 1/1998, Februar/März, S.23, 2/1997, April/Mai, S.22
Norbert: Früher Bettler . Jetzt Verkäufer. Jetzt lohnt es sich wieder zu träumen, in: WOHNUNGS-Looser Nr.2, März/April/Mai 1995, S.10
PDS - Bundestagsgruppe: Asylbewerberleistungsgesetz, in: Streetworker Winter/Frühjahr 1998, S.4-6
Peuckert, Rüdiger: Familienformen im sozialen Wandel, Opladen 1996
Pott, Hans-Georg: Freude, in: Hempels Straßenmagazin, Nr.20, Dezember 1997, S.7
Rat der Evangelischen Kirchen in Deutschland; Katholische Deutsche Bischofskonferenz: Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, Hannover; Bonn 1997
Reidegeld, Eckart; Reubelt, Beatrice: Die Mahlzeitennothilfe in Deutschland. Historische Anmerkungen und aktuelle Situation, in: neue praxis 2/95, S.167-182
Reifenrath, Roderich: Nachdenken übers Abräumen. Konsens, Globalisierung und Demokratie, in: Frankfurter Rundschau 27.12.1997, S. ZB 4
Repp, Thomas: Hafenspitze - das 1.Hempel's-Kind!, in: Hempels Straßenmagazin Dezember 1997, S.7
Repp, Thomas: Straßenmagazin-Treffen in Loccum , in: Hempels Straßenmagazin Dezember 1997, S.11
Reuter, Norbert: Arbeitslosigkeit bei ausbleibendem Wachstum - das Ende der Arbeitsmarktpolitik?, in: Aus Politik und Zeitgeschehen, Beilage zur Wochenzeitung "Das Parlament" vom 35/97 vom 22.8.1997, Bonn 1997
Riek, Markus (verantwortlicher Redakteur): Wege aus der Obdachlosigkeit, 19.12.1996 Freies Radio Stuttgart
Riemenschneider, Hans: Abseits!? In der Kirche. "Obdachlos = Abseits?", in: Abseits!?, Nr.6/1997, Dezember/Januar, S.14
Riemenschneider, Hans: Zuschauer im Konsumland Deurschland. Die psychosozialen Folgen von Arbeitslosigkeit und Armut, in: Abseits!?, Nr.2/1998, April/Mai, S.14
Rolf: "Es wird merklich kälter!", in: BODO 12/1997, S.2
Rosenke, Werena: "Bunte Blätter": die bundesdeutschen Straßenzeitungen haben sich etabliert. Eine Bestandsaufnahme, in: wohnungslos 4/1995, S.154-160
Rosenke, Werena: Bürgerschaftliches Engagement in der sozialen Arbeit. Konkurrenz oder Kooperation, in: wohnungslos 3/1997, S.93-97
Rosenke, Werena: Dritte Tagung der Straßenzeitungen Evangelische Akademie Loccum 27. bis 29.Oktober 1997, in: wohnungslos 4/1997, S.176
Rosenke, Werena: "Obdachlosigkeit - Eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung". Der Bericht der Bundesregierung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit - Entschließungsantrag der SPD-Fraktion zur Unterrichtung durch die Bundesregierung, in: wohnungslos 1/1997, S.51f
Rosenke, Werena: Straßenzeitungen. Dauerbrenner oder Strohfeuer?, in: Gefährdetenhilfe 2/1994, S.73-77
Rosenke, Werena: Tagungsbericht: Erste Tagung der bundesdeutschen Straßenzeitungen, in: wohnungslos 4/1995, S.166f
Rosenke, Werena: Tagungsbericht: Zweite Tagung der Straßenzeitungen Berlin 25. bis 27.Oktober 1996, in: wohnungslos 4/1996, S.170f
Schmid, Helmut H.: Intro, in: Trott-war, Februar 1998, S.3
Schmidt, Sven: "Ich hatte eine Farm in Afrika, ..", in: TagesSatz Nr.3 (1997), S.24
Schmilinsky,Michael: "Mitarbeiter, die so fit sind wie die GSG 9". Michael Schmilinsky (61) aus Genf ist Betriebswirt und berät seit 11 Jahren Unternehmen, wie sie effektiv ihre Krankenrate senken und die Leistungsbereitschaft ihrer Belegschaften steigern können, in: tageszeitung 24./25.1.1998, S.3
Schneider, Stefan: Editorial, in: Strassenfeger Nr.7, April/Mai 1997
Schneider, Stefan: "motz & Co" - Jetzt weltweit im Internet, in: wohnungslos 3/1995, S.115f
Schnelle, Katrin: "Armut kann jeden treffen", in: BODO 10/1997, S.22f
Schroeder, Fe-Rhun: Obdachlos und nun? Sozialarbeiterische Unterstützung beim Strassenfeger, in: Strassenfeger Nr.1, Januar 1998, S.30.
Schumacher, Vera; Winkelhorst, Udo: Alternativer Medienmarkt der Straßenzeitungen. Eine neue Bewegung im gesellschaftlichen Unten? In: Soziale Arbeit 2/97, S.54-61
Sidler, Nikolaus: Am Rande leben, abweichen, arm sein. Konzepte und Theorien zu sozialen Problemen, Freiburg 1989
Simon, Titus (Hrsg.): Treibgut. Ein Erlacher Lesebuch aus der Lebenswelt von Wohnungslosen, Bielefeld 1991
Simone: Wie ich zu motz kam, in: motz 19/97, S.13
Specht, Walther: Löcher im Netz. Wie Armut in Deutschland zu überwinden ist, in: Evangelische Kommentare, März 1998, S.127-130
Stadlmayer, Tina: Frauen werden bei Steuern und Renten nicht gehört, in: tageszeitung, 6.3.1997, S.5
Steinert, Jürgen: Ein Staat, der in dieser Situation seine Wohnungen verkauft, handelt unklug". Gespräch mit GdW-Präsident Jürgen Steinert über Geldwäsche, Reformbedarf und Sozialmanagement in von Verslumung bedrohten Stadtteilen, in: Frankfurter Rundschau, 27.10.1997, S.14
Stolzenberg, Karl: Die "neue"Arbeitslosigkeit für den Anspruch auf Arbeitslosengeld oder - wie schafft man neue Arbeitslose?, in: Streetworker Winter/Frühjahr 1998, S.11.
Tein, Jo: In eigener Sache. Hempels Straßenmagazin im Wandel der Zeit. Eine Bestandsaufnahme, in: Hempels Straßenmagazin, Nr.20, Dezember 1997, S.4-6.
Thole, Hubert: Wichtige Änderungen ab dem 01.Januar 1998. Arbeitslos und keine Nebenjobs, in: Abseits!?, Nr.6/1997, Dezember/Januar, S.8.
Thon, Manfred: Demografische Aspekte der Arbeitsmarktentwicklung - die Alterung des Erwerbspersonenpotentials, in: Mitt AB 3/95, S. 290-299
Tommy: Gute Zeiten, schlechte Zeiten bei BODO, in: BODO 5/1997, S.2
Tommy: Solider Lebenswandel, in: BODO 6/1997, S.2
Umlauft, Reinhard A.: Nachdenkliches zum Vorurteil: Wer arbeiten will, der findet auch Arbeit, in: Abseits !?, Nr.2/1998, April/Mai, S.24
Vesper, Michael: "Ohne höheres Wohngeld ist Reform undenkbar". FR-Interview mit Nordrhein-Westfalens Bauminister Michael Vesper / Töpfer-Nachfolger soll Konfrontation beenden, in: Frankfurter Rundschau, 21.11.1997, S.5
Waldherr, Thomas: Selbsthilfe der Armen. Hilfe für den Einzelnen oder gesellschaftliche Strategie?, in: Looser 8/1997, S.16
Wallmann, Johannes: Kirchengeschichte Deutschlands II, Frankfurt/Main; Berlin; Wien 1973
Wagenfeld, Dinny: Editorial, in: BODO 4/1997, S.3
Watenphul, Jens: Editorial, in: BODO 11/1997, S.3
Wermelskirchen, Axel: Die neuen Unwörter sind da. Wieder hat sich die Jury nicht geschont / "Tote spenden nicht", in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.1.1998
Werner, Matthäus: "Am ersten Dienstag eines jeden Monats..., in: fiftyfifty, November 1997, S.2
Werner, Matthäus: Seit fast drei Jahren..., in: fiftyfifty, Dezember 1997, S.2
Wilmer, Martin: "Ein großer Schritt vorwärts" (Interview mit Yvonne Legner), in: draußen 6/97, S.15
Zeuner, Anke: Die Menschmaschine. Kritische Geschichte der Psychiatrie, in: Strassenfeger, Nr.2, Januar 1998, S.12f.
Zglinicki, Claudia von: Redaktionskonferenz beim "Strassenfeger". Nicht auf Mitleid hoffen, sondern Unterstützung fordern, in: Freitag 1/1998, abgedruckt in: Looser/Strassenfeger, März/April 1998, S.23-25
8. Adressen:
(ACHTUNG: DATEN VON 1998 - MÖGLICHERWEISE ÜBERHOLT)
Aachen:
AC-Htung Redaktion
Reihestr. 4 - 52062 Aachen
Augsburg:
BISS Augsburg c/o Wärmestube
Klinkertorstr. 18 - 86152 Augsburg
Berlin:
KARUNA - Hilfe für suchtgefährdete und suchtkranke Kinder und Jugendliche Int. e.V.
Zeitdruck-Verlag
Kaskelstraße 15 - 10317 Berlin
motz & co
Zossener Str. 56 - 10961 Berlin
Strassenfeger
Kopernikusstr. 2 - 10243 Berlin
Bingen:
Platte Die Obdachloseninitiative Rheinland-Pfalz
Dammstr. 10 - 55411 Bingen
Bochum/Dortmund:
BoDo Straßenmagazin
Märkische Str. 205 - 44147 Dortmund
Braunschweig:
Parkbank Straßenzeitung
Rchternstr. (?) 12 - 38100 Braunschweig
Darmstadt:
Jedermann/Streetworker
Herausgeber: Verlag JEDERMANN
Landgraf Phillips Anlage 52 - 64322 Weiterstadt
Dresden:
DROBS e.V. (Dresdner Obdachlosen-Straßenzeitung)
Kreuzstr. 7 - 01067 Dresden
Düsseldorf:
asphalt e.V. / fiftyfifty
Ludwigshafener Str. 33d - 40229 Düssseldorf
Erfurt:
Brücke Kontakt in Krisen - Verein für mobile und gemeindenahe Sozialarbeit
Magdeburger Allee 114 - 99086 Erfurt
Essen:
statt Park c/o Erwerbsbehinderten-Arbeitsstätte gem.GmbH
Grabenstr.101 - 45141 Essen
Wohnungsloser c/o INTRGO
Schornstr.12 - 45128 Essen
Gelsenkirchen:
Nie Wo Los Gelsenkirchen, Redaktions-Team "das Weiße Haus"
Hochstr.80 - 45894 Gelsenkirchen - Buer
Gifhorn:
Straße ohne Ausweg c/o Tagestreff Moin Moin
Braunschweiger Str.56 - 38518 Gifhorn
Hamburg:
Hinz & Kunzt Redaktion
Curienstr. 8 - 20095 Hamburg
Hamm:
"Draußen in Hamm"
c/o Ilse Rikermann
Schellingstr. 7 - 59063 Hamm
Hannover:
Asphalt Redaktion
Knochenhauerstr. 42 - 30159 Hannover
Heidelberg:
Heidelberger Rundschlag
c/o Rolf Ficker
Oberbadgasse 10 - 69117 Heidelberg
Kassel:
Tagessatz Redaktion
Sickingenstr. 6-8 - 34117 Kassel
Kiel:
Hempels Straßenmagazin
Hopfenstr. 3 - 24114 Kiel
Köln:
Bank-Extra OASE Benedikt-Labre-Hilfe E.V.
Karlsstr.11-13 - 50679 Köln
Von unge
Elsaßstr.34 - 50677 Köln
Leipzig:
Kippe Die Leipziger Straßenzeitung
A.-Kästner-Str. 80a (oder 69) - 04275 Leipzig
Lübeck:
"Bessere Zeiten"
Wahmstr.60 - 23552 Lübeck
Lüneburg:
Asphalt (Lokalredaktion von Hannover) Lüneburg e.V.
Auf der Altstadt 39 - 21335 Lüneburg
Marl:
"Signal" Solidargemeinschaft von und für Obdachlose
Creiler Platz 1 - 45768 Marl
Michelstadt/Odenwald:
Looser, Selbsthilfeförderverein Arbeit und Wohnen e.V.
Waldstr. 17 - 64720 Michelstadt/Odenwald
München:
BISS
Königinstr. 77 - 80539 München
Münster:
draußen! e.V. c/o text design
Warendorfer Str. 165a - 48145 Münster
Nürnberg:
Straßenkreuzer e.V.
Wirthstr. 36 - 90459 Nürnberg
Offenburg:
"Herbstwind" c/o St.Ursula-Heim
Vogesenstr.1-3 - 77652 Offenburg
Osnabrück:
Abseits !? Erste Osnabrücker Straßenzeitung
Sozialdienst Katholischer Männer Osnabrück e.V.
Lohstr.42 oder Kommenderiestr.32 - 49074 Osnabrück
Rostock:
Strohhalm
Gerber Bruch 29 - 18055 Rostock
Schwerin:
Start e.V. Beratung Bildung Förderung schwer vermittelbarer Arbeitsloser
Perlebergerstr. 22 - 19063 Schwerin
Solingen:
"Die Straße" c/o Jugendberufshilfe e.V.
Forststr.38 - 42697 Solingen
Stuttgart:
Trott-War e.V.
Tübinger Str.17 a - 70178 Stuttgart
Ulm:
Arbeit & Soziales Arbeitslosenselbsthilfeinitiative Ulm/Neu Ulm
Fort Unterer Kuhberg 16 - 89077 Ulm
Vollständiges Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- 1. Strukturelle Armutsursachen in der Bundesrepublik Deutschland
- 2. Straßenzeitungen in der Bundesrepublik Deutschland
- 2.1. Begriffsklärung
- 2.2. Versuch einer Systematisierung
- 2.2.1. Von JournalistInnen verantwortete Projekte, oder: Das Profi-Konzept
- 2.2.2. Selbsthilfeinitiativen
- 1. Regional agierende Projekte
- 2. Bundesweit agierende Projekte
- 2.2.3. Von Ehrenamtlichen getragene Projekte
- 2.2.4. Von der Wohnungslosenhilfe geprägte Zeitungen
- 1. Auf der Straße verkaufte Blätter
- 2. Kostenlose Blätter
- 2.2.5. Von "Betroffenen" und der Wohnungslosenhilfe gemeinsam initiierte Projekte
- 2.3. Gibt es gemeinsame Ziele aller Straßenzeitungen? Eine Zwischenbilanz
- 3. Die Verkäuferinnen und Verkäufer
- 3.1. Ein methodisches Problem und sein Erkenntniswert
- 3.2. Ergebnisse der VerkäuferInnenbefragung
- 3.2.1. Wohnliche und finanzielle Situation
- 3.2.2. Motive für den Zeitungsverkauf
- 3.2.3. Verdienst
- 3.2.4. Dauer der Mitarbeit
- 3.2.5. Identifikation mit dem Projekt
- 3.2.6. Weitere Beobachtungen
- 3.3. Zwischenbilanz
- 4. Probleme von Straßenzeitungen und ihre Auswirkungen
- 4.1. Probleme von Straßenzeitungen
- 4.2. Auswirkungen
- 4.2.1. Auswirkungen auf die einzelnen Projekte
- 4.2.2. Auswirkungen auf das Verhältnis der Projekte untereinander
- 5. Straßenzeitungen in der Bundesrepublik Deutschland - Chancen und Grenzen
- 5.1. Das Profi-Konzept
- 5.2. Selbsthilfeprojekte
- 5.3. Von Ehrenamtlichen getragene Projekte
- 5.4. Von der Wohnungslosenhilfe geprägte Zeitungen
- 5.5. Von "Betroffenen" und der Wohnungslosenhilfe gemeinsam initiierte Projekte
- 6. Fazit
- 7. Literaturverzeichnis
- 7.1. Straßenzeitungen und Straßenmagazine
- 7.2. Flugblätter , Selbstdarstellungen, Presseerklärungen
- 7.3. Rechtstexte
- 7.4. Monographien , Zeitschriften- und Zeitungsartikel:
- 8. Adressen
Sonja Kemnitz
Berliner Obdachlosenzeitungen
oder was die Konkurrenz so alles kaputtmacht
Mit dieser Nullnummer der motz tritt nicht die fünfte Berliner Obdachlosenzeitung auf den Markt. Im Gegenteil ist sie der Versuch, eine Entwicklung umzukehren, die im Dezember 1993 begann und nicht nur bei vielen Lesern die Frage provozierte: Warum arbeitet ihr eigentlich neben- oder sogar gegeneinander?
- Der Anfang
- In Berlin
- Plötzlich hatten es alle sehr eilig
- Ein Rettungsversuch
- Diese Aufteilung
- Pfingsten 1994
- In der mob-Redaktion
- Die Berliner Fehler
- Motz und Konsorten
Der Anfang
aller Berliner Projekte lag nicht in Berlin. Die Idee dieser Zeitungen zur Selbsthilfe kam aus den USA nach Europa. Über Londons "Big Issue" und die französische "Macadam" kamen Zeitungsieen nach Deutschland. Hier engagierten sich kirchliche Kräfte - Pater Barabas in München für die Zeitung "Biss" und der Chef der Diakonie in Hamburg für die Zeitung "Hinz und Kunz(t)". Beide schlugen ein wie eine Bombe. Resultat: Gründungsfieber in mehreren deutschen Städten, vor allem in Berlin.
In Berlin
arbeiteten mehrere Gruppen oder Personen, unabhängig voneinander an ihrern Projekten. Herr Kußmaul träumte von seinem "Eckensteher", doch fehlte ihm das Geld und das Know-How. Die verdienstvolle Berliner Initiative gegen Wohnungsnot (BIN e.V.) gab seit mehreren Jahren ein Blatt mit dem Namen BINFO heraus. Diese lesenswerte Publikation hatte einen festen, aber beschränkten Leserkreis, insbesondere unter Sozialarbeitern. Die Idee, BINFO zu einer Straßenzeitung auszubauen, lag also nahe. Aber mit welchem Know-How? Parallel dazu kam ein Trupp aus Paris, Vertreter der Pariser Obdachlosenzeitung "Le Reverbere" mit der festen Entschlossenheit, in Berlin eine weitere Zeitung zu eröffnen. Diese Gruppe verfügte sowohl über Geld als auch über das in Paris bewährte Know-How. Und dann gab es eine kleine Gruppe von obdachlosen und nichtobdachlosen Träumern, hervorgegangen aus der Mahnwache am Engelbecken. Sie füllten zum Heiligen Abend 1993 vier Seiten in der TAZ mit Beiträgen zur Obdachlosigkeit. Credo dieser Arbeit war: auf und von der Straße geschrieben. Auch dieser Gruppe fehlte jedes Know-How oder Geld. So erkundigten sich aller der Reihe nach in Hamburg nach beidem und lernten sich als Berliner über Hamburg kennen.
Plötzlich hatten es alle sehr eilig.
Anstatt sich die Zeit für ein Miteinander zu nehmen, wollte jeder der erste sein. Am schnellsten waren die Kollegen aus Paris mit ihrem Geld und ihrem Know-How. Doch stand die Frage: würde in Berlin tragen, was in Paris trägt? Der Clochard in Frankreich gilt kulturhistorisch immer als positiv, er gehört einfach dazu. Der deutsche Penner ist immer negativ besetzt, ausgegrenzt, verdrängt, bevormundet. So betonte BIN e.V. zu Recht, eine solche Zeitung von unten, muß unter denen verwurzelt sein, über die sie berichtet und mit denen sie entsteht. Herr Kußmaul informierte sich bei allen nacheinander. Das einzige langfristig vorbereitete Projekt "Zeitdruck", mit der speziellen Clientel obdachloser Jugendlicher, erklärte, am 1.Mai 1994 in jedem Fall mit seiner ersten Ausgabe zu erscheinen.
Ein Rettungsversuch
um ein gemeinsames Projekt in Berlin zu etablieren, wurde gestartet. Ein "runder Tisch" im Haus der Demokratie brachte alle Beteiligten zusammen. Dieser Termin war mindestens eine Woche vorher bekannt. Dennoch bestand BIN e.V. auf einer Pressekonferenz einen Tag vor dem vereinbarten Treffen. Am 18. Februar präsentierten drei eilig eingestellte Redakteure die Zeitung "mob". Was also konnte das Treffen am 19.Februar noch bringen? Am Ende dieser Runde warfen die Pariser die Null-Nummer ihrer HAZ auf den Tisch, layoutet und gedruckt in Paris. Noch am selben Abend verständigte sich Herr Kußmaul mit den Parisern und beschloß, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die Nullnummer der HAZ mußte wegen ungeklärter Copyright-Rechte neu gedruckt werden. Die erste "mob" erschien am 18. März 1994.
Diese Aufteilung
war kein Zufall. Alle diese Zeitungsprojekte stehen vor dem Problem, sich am Markt zu bewegen, also geschäftsmäßig zu arbeiten und zugleich, sich auf einen Lebensrhytmus einzulassen, der chaotisch, unstetig ist. Entscheidend sind die Ziele, die mit der Zeitung verfolgt werden. Jeder weiß, es geht ums Geld, um die Einnahmen. Entscheidend ist, wofür werden sie verwendet, wer entscheidet darüber und wie transparent sind die Geldbewegungen. BIN e.V.,wie die Leute von den TAZ-Seiten einer sozialkrtischen Denkweise verpflichtet, erklärten vehement ihre Gemeinnützigkeit. Die Pariser und Herr Kußmaul betonten den privatwirtschaftlichen Aspekt, sichtbar in der Marktform einer GmbH, - und gerieten sich genau darüber in die Haare.
Pfingsten 1994
trennte sich Herr Kußmaul von seinem Pariser Herausgeber und brachte die "Platte" auf den Markt. Von Geldtransfers nach Paris war die Rede, einem Vorwurf, den die haz bis heute nicht loswurde. Von Diebstahl und Betrug sprachen die Pariser. Allerdings wurden diese Vorwürfe nie zur Anzeige gebracht. Die "Platte" entwickelte sich schnell. Dennoch kam es immer wieder zu Spannungen und Entlassungen. Ein ehemaliger Chefredakteur der "Platte" erstattete inzwischen Strafantrag.
Die Pariser hielten an ihrer Idee fest. Sie brachten mit einer neuen Redakteurin schnell eine neue haz auf den Markt, komplett erdacht und hergestellt in Berlin. Nach enormen Startschwierigkeiten, eroberte sich diese Zeitung wieder einen festen Platz.
In der mob-Redaktion
gab es andere Schwierigkeiten. Der enorme Zeitdruck, das mangelnde Know-How und unterschiedliches redaktionelles Verständnis führten zu Spannungen. Nich ausdiskutiert, endeten sie in der fristlosen Kündigung einer Redakteurin. Darauf antworteten Verkäufer mit einer Besetzung der Redaktion. Sie forderten mehr Transparenz und Mitsprache sowie die Wiedereinstellung der Redakteurin. Der Herausgeber ließ polizeilich räumen und verlor so vor den Obdachlosen seine Glaubwürdigkeit. "mob" war gefährdet und rappelte sich wieder raus. Nach seiner Trennung vom Herausgeber wurde "mob" ein wirklicher Selbsthilfeverein, der die Selbstverwaltung der Obdachlosen betonte. Resultat: der geschäftsmäßige Aspekt wurde vernachlässigt. Für die Obdachlosen war die Zeitung mehr ein zu Hause als ein Unternehmen. Für manche wurde er zum Selbstbedienungsladen.
Die Berliner Fehler
erkennt man am besten im Vergleich mit Hinz und Kunz(t) in Hamburg. Dort arbeitete erst ein Selbsthilfeprojekt. Aus diesem entstand die Idee der Zeitung. Sechs Monate Vorbereitungszeit sicherten ein klares redaktionelles Selbstverständnis und eine durchdachte Vertriebslogistik. Der Chef der Diakonie, ein durch alle politisachen Lager als integer anerkannter Mann, leistete unverzichtbare Lobbyarbeit im Vorfeld. Die Erstausgabe erschien am Beginn der Kälteperiode, also zu einer Zeit, als das Thema in den Köpfen der Leute stärker präsent ist. Damit war eine sichere Leserschar gegeben. In Berlin fehlte durch die Konkurrenz jede Vorbereitungszeit. Außer bei "Zeitdruck" gab es kein Selbsthilfeprojekt. Ohne geschützte Räume, in denben sich die Verkäufer mit ihrer Zeitung identifizieren können, funktioniert nach meiner Übrezeugung so ein Projekt nicht. Hier geht es nicht nur um Tageseinnahmen für die Verkäufer, sondern um ein gemeinschaftliches zu Hause. Alle diese Zeitungen sind in hohem Maße Familienersatz.
Letztendlich verhinderte die nicht verhinderte Konkurrenzsituation, daß die Berliner Obdachlosenzeitungen ihre eigene Dynamik von innen heraus entfalten konnten. Ihr Bewegungsrhytmus war von außen diktiert, geschäftsmäßig und einzig allein vom Geld.
Motz und Konsorten
versucht, diese zerstörerische Entwicklung zu stoppen und umzudrehen. Wir haben aus unseren Fehlern die Konsequenzen gezogen. Arbeitsbereich und Wohnbereich werden strikt getrennt. Unser Sozialprojekt sind die Wohnräume für Obdachlose in der Kleinen Hamburger Straße., Arbeitsbereich wird die Boxhagener Straße. Gemeinnützigkeit ist beantragt, wir können also auch Spenden annehmen. Redaktionell binden wir alle zusammen, die bisher in verschiedenen Redaktionen arbeiteten. Und wir betreiben keine Politik, die den Verdacht nährt, daß im Namen des Herausgebers die zweite Mark, die den Verkäufern gehört, über zweifelhafte Projekte wieder in die eigenen Taschen fließt.
Darin sehen wir unsere Chance. Und wir nutzen sie.
Sonja Kemnitz









